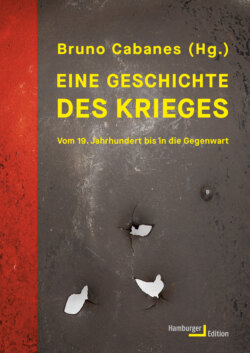Читать книгу Eine Geschichte des Krieges - Группа авторов - Страница 40
Samuel Moyn Krieg und Recht
ОглавлениеDie Entwicklung der Militärpraktiken im 19. Jahrhundert, insbesondere die beispiellose Brutalität der Kämpfe, offenbarte das Fehlen juristischer Normen, die die Anwendung von Gewalt regulierten. 1864 führte ein erstes internationales Abkommen das moderne Kriegsrecht ein. Bedeutet die Reglementierung des Krieges jedoch nicht zugleich seine Perpetuierung?
»Denn unter den Waffen schweigen die Gesetze« (»Inter arma enim silent leges«): Ciceros Sentenz ist fraglos der berühmteste Ausspruch über die Gesetze im Krieg. Doch auch in den biblischen Grundlagen der westlichen Kultur sowie in den ursprünglichen Kriegspraktiken wurden bestimmte Verhaltensregeln als sakrosankt erachtet, wenngleich sie nicht immer Gesetzeskraft besaßen. So stellt Moses im Deuteronomium an erste Stelle »die Ermahnungen und Gebote und Rechte« (Dtn 4,45), die fordern, den Einwohner*innen einer gegnerischen Stadt die Möglichkeit zu bieten, sich zu ergeben, bevor man sie belagert, und die dazu verpflichten, die Frauen, Kinder und das Vieh aller Nationen zu schonen, mit Ausnahme der erbittertsten Feinde Israels. Doch die meisten Beschränkungen der Kriegführung, von denen wir wissen – zum Beispiel in Afrika das Verbot, die Brunnen gegnerischer Stämme zu vergiften –, wurden dem Ermessen der kriegführenden Parteien überlassen.
Ciceros römische Weisheit musste mit ungleichen Waffen mit den moralisierenden Strömungen des Christentums konkurrieren. Diese empfahlen während des Mittelalters und darüber hinaus, nur in den Krieg zu ziehen, wenn man sich auf ein gerechtes Anliegen berufen konnte und sich während der Kämpfe an eine bestimmte Zahl an Beschränkungen hielt. Das Christentum führte in der Tat eine wichtige Unterscheidung ein, die eine gewaltige Tragweite hatte: die zwischen dem ius ad bellum (Regeln über die Bedingungen für das Führen eines Krieges) und dem ius in bello (die Regeln für die Kriegshandlungen). Die Ritter wiederum lebten – oder gaben dies jedenfalls vor – nach einem aristokratischen Ehrenkodex, der ihr Verhalten im selben, wenn nicht höheren Maße bestimmte, als es das philosophische und religiöse Denken jemals vermochte.
Mit der Rückkehr einer gewissen Amoralität, die sich mit der düsteren Weisheit Ciceros und vor allem Tacitus’ verband, kam man in den Anfängen der Moderne zu dem Schluss, dass sich das Mittelalter geirrt hatte in dem Glauben, entscheiden zu können, ob die Gründe eines Krieges gerecht waren oder nicht. Manche suchten weiterhin nach einem Konsens; doch die Reglementierung des Krieges neigte sich immer mehr der Seite des ius in bello – der Regelung dessen, was nach Ausbruch eines Krieges erlaubt war – zu als der Seite des ius ad bellum – den moralischen Regeln, die den Ausbruch der Feindseligkeiten selbst legitimierten oder untersagten. Diese Vorkehrungen betrafen natürlich lange Zeit nur die innereuropäischen Konflikte. Wie ein in Indien stationierter britischer Offizier bemerkte: Dies gilt nicht »gegen die wilden Stämme, die sich nicht an die Regeln des zivilisierten Krieges halten«.1