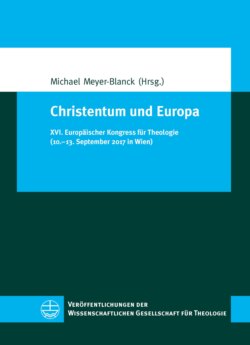Читать книгу Christentum und Europa - Группа авторов - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Konkretisierungen 3.1 Exklusive religiöse Entscheidungen
ОглавлениеDer wichtigste Ausgangspunkt all der Entwicklungen scheint die Individualisierung religiöser Entscheidung zu sein, wie es jüngst wieder eindringlich hervorgehoben worden ist.11 Matthäus lässt Jesus eine provozierende Äußerung machen. Als er einen Mann zum Jünger beruft, erklärt dieser, er müsse zunächst seinen Vater begraben, und Jesus antwortet: »Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben!«12 Wenngleich die jüngere neutestamentliche Forschung einiges dafür getan hat, den jüdischen Hintergrund jener Worte zu erhellen, verdichtet sich in diesem Satz das Potential der christlichen Lehre, Zeitgenossen zu irritieren. Aufgrund einer persönlichen religiösen Entscheidung sollten alle anderen sozialen Verpflichtungen hintangestellt werden, sogar eine der höchsten familiären und religiösen Aufgaben jener Zeit überhaupt, die Bestattung des eigenen Vaters. Die Entscheidung für das Eine, für die Nachfolge Jesu, war untrennbar mit der Entscheidung gegen das Andere verbunden.
Da dies eben sowohl eine Entscheidung für etwas als auch gegen etwas war, erhielt die Hinwendung zu einer bestimmten religiösen Auffassung oder Praxis eine ganz andere Bedeutung, als man sie sonst kannte.13 Denn in die Kulte der Familie, von Polis und res publica wurde man hineingeboren: Wer einer Athener Familie entstammte, pflegte selbstverständlich die Kulte der Polis Athen, die er im Laufe seiner Sozialisation kennenlernte; er führte ebenso selbstverständlich familiäre kultische Traditionen fort. Die Teilnahme daran war ein Privileg und zugleich eine Pflicht des Bürgers und der Bürgerin, deren Status oft erst im Kult performiert wurde. Das schloss nicht aus, dass dauerhafte Bewohner der Stadt wie die Athener Metöken, ja selbst Sklaven an den Kulten beteiligt waren. Aber die religiöse Praxis erwuchs auch hier nicht aus einer individuellen Entscheidung, sondern aus sozialer Zugehörigkeit.
Viele Priesterämter wurden auf die gleiche Weise wie andere Funktionen in der Polis vergeben, obgleich bisweilen Erblichkeit und andere Modi der Personalauswahl vorkamen. In der römischen Gesellschaft gehörten die wichtigsten Priesterwürden zur senatorischen Karriere und die Stratifikation der Priesterschaften entsprach gerade in Rom der sonstigen gesellschaftlichen Hierarchie. Kein Consul, der nicht mindestens ein hohes Priesteramt bekleidete – ohne dass dafür eine besondere religiöse Anteilnahme gefordert wurde. Der Kaiser agierte seit 12 v. Chr. zugleich als pontifex maximus. Religiöses und politisches System waren unlösbar verbunden.
Individuelle religiöse Entscheidungen besaßen gleichwohl große Bedeutung. Angebote gab es reichlich. Neben den Göttern von Polis und res publica mochte man noch andere, selbst fremde Götter verehren, von deren Wirken man erfahren hatte. Viele vornehme Athener und Römer ließen sich in Mysterienkulte einweihen. Andere Kulte standen bei Eliten in einem schlechten Ruf und konnten dennoch in Rom Teil der sacra publica werden, wie es sich an der Geschichte des Kultes der Isis zeigt, der immer wieder verboten, doch schließlich von der Flavischen Dynastie im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts gefördert wurde.14 Manche Gebildete mochten über diese Kulte spotten und für sich eine philosophische Form der Religion wählen; das mündete aber nicht in die Forderung nach Ausrottung solcher Kulte. Wenn sie unterdrückt wurden, dann, weil ihre Anhänger die öffentliche Ordnung störten.
Einen Sonderfall bildete der Kaiserkult, weil er über einzelne Städte hinausgriff und in manchen Provinzen zentral organisiert wurde. Hier fällten die Verehrer ihre Entscheidung, den Kaiser zu verehren, ebenfalls gewöhnlich als Kollektiv. Gerade (klein)asiatische Städte rangen darum, eine Neokorie zu erlangen, das Recht, einen Kaisertempel zu errichten. Die Konkurrenz der Kulte schuf Probleme, da die Gefahr bestand, dass sie sich gegenseitig Ressourcen entzogen, die man für den Unterhalt des Tempels oder die Vorbereitung der Opfer benötigte. Aber das Nebeneinander verschiedener Kulte war grundsätzlich akzeptiert, auf der kollektiven wie auf der individuellen Ebene. Tempel vieler Götter erhoben sich in den antiken Städten; dieselbe Person konnte Jupiter, Isis und den Kaiser verehren; in demselben Tempelbezirk konnten Kultstätten für verschiedene Götter koexistieren.
Hier nahmen Christen typischerweise eine andere Position ein:15 Das Bekenntnis zu ihrem Gott verlangte den ganzen Menschen und schloss die Verehrung anderer Götter als des christlichen aus; der Glaube war exklusiv. Die Christen, die sich durchsetzen sollten, vertraten die Auffassung, dass sie am herkömmlichen Kult der Poleis oder des Kaisers nicht mehr teilnehmen dürften. Sie entwickelten eigene Formen der Gemeinschaft, die um die Verkündigung und das Herrenmahl kreisten.
Da religiöse und politische Organisation in der Antike, wie erwähnt, unlösbar miteinander verbunden waren, hatte diese Einstellung beachtliche Weiterungen: Solche Christen mussten sich von öffentlichen Feiern, von Spielen, von Ämtern zurückziehen. Denn all dies war mit rituellen Opfern verbunden. Aus polemischen Texten etwa Tertullians wissen wir indes von Christen, die diese Konsequenz nicht zogen und etwa gerne Theater und Amphitheater besuchten oder anderweitig bei Festen mitfeierten. Inschriften bezeugen Männer, die sich als Christen verstanden und Bouleuten (Ratsherren) waren.16 Aber für eine erhebliche Zahl brachte die Hinwendung zum christlichen Glauben eine tiefgreifende Veränderung des Lebenswandels mit sich. Das ging mit der Ablehnung aller nicht-christlichen Praktiken einher, wobei sich die Definition dessen, was als nicht-christlich galt, nicht selten wandelte.
Entscheidend jedoch ist: Den individuellen Überzeugungen maßen Christen höhere Bedeutung zu als familiären und städtischen Traditionen. Wie weit das gehen konnte, zeigte sich besonders deutlich im Bereich der Sexualität. Zu den wesentlichen Aufgaben eines antiken Bürgers und einer antiken Bürgerin gehörte es, durch die Zeugung und Geburt von Kindern die Zukunft von Polis und res publica abzusichern. Insofern war eine gewisse Praxis der Sexualität Teil der Bürgerpflichten. Christen dagegen ordneten die Sexualität der Ausrichtung auf ihren Gott unter. So konnten viele die Ehe und die Zeugung von Kindern akzeptieren, als zweitbeste Lösung gegenüber der Enthaltsamkeit, wie schon Paulus betont hatte. Wichtiger als der Fortbestand der Gemeinschaft war diesen Christen ihre individuelle Entscheidung für ihren Gott, die ihnen idealerweise die Stärke verlieh, auf die Praktizierung von Sexualität zu verzichten. Insofern wohnt dem Christentum, wenngleich es sich heute ganz anders gebärdet, eine gewisse Familienfeindlichkeit inne, die sich im Zölibat fortsetzt.17 Diese Haltung konnte man in der Antike als egoistisch werten – und das ist ein Einwand, der europäischen, auf individuellen Rechten beruhenden Werten oft aus Asien entgegenschlägt.
Ohne Zweifel bestand schon vorher die Vorstellung, dass der Einzelne gegenüber den anderen eine überlegene Erkenntnis besitzen könne – der Athener Philosoph Sokrates war vorbildhaft für solche Haltungen –, doch wenn eine Gruppe von Menschen bewusst die Verbindung von politischer und religiöser Ordnung aufbrach, so war dies ungewöhnlich. Bezeichnenderweise lässt Platon seinen Sokrates sich an seinem Lebensende an die Verpflichtung erinnern, dem Asklepios noch einen Hahn zu opfern (Phaidon 118a). Zeitgenossen mochten sich bei den Christen an Kyniker erinnert fühlen, die sich ebenfalls über alles andere hinwegsetzten; allerdings entwickelten diese keine eigenen Riten und keine eigene Organisation, anders als es Christen taten.
Der Gedanke der individuellen religiösen Entscheidung, die zur Ablehnung aller anderen Vorstellungen führte, bildete eine Grundlage für die Idee der Religionsfreiheit als eines subjektiven Rechts. Im öffentlichen Geschichtsbild gelten die heidnischen Gesellschaften als frei, da die Götter die Menschen noch nicht an ihrem Gängelband geführt hätten. In der Tat ist der erste Eindruck von der antiken Welt der einer enormen religiösen Vielfalt; jeder Besucher einer antiken Stadt sieht eine Vielzahl von Tempeln für unterschiedliche Götter. Oft ist dann kurzschlüssig von Toleranz die Rede.18 Doch eine Andeutung zum Verbot von Isiskulten habe ich bereits gemacht – und das war nicht das einzige Verbot, das römische Institutionen aussprachen. Zwar duldete man eine hohe Zahl fremder Kulte, aber keine Norm der Religionsfreiheit. Fragen der öffentlichen Ordnung dienten leicht als Argument, um religiöse Einrichtungen zu verbieten. Typischerweise erfolgte dies als lokale Maßnahme. Die vorherige Bemerkung zur Unterbindung der Isisverehrung bezog sich auf die Stadt Rom und nicht auf die zahlreichen anderen Kultstätten im ganzen Reich. Es ging nicht darum, eine andere Religion zu eliminieren, sondern darum, die öffentliche Ordnung in einer konkreten Stadt wiederherzustellen, bisweilen immerhin darum, Freveln vorzubeugen.
Auf der anderen Seite bestand insofern ein religiöser Zwang, als viele Poleis die Bürger darauf verpflichteten, an den städtischen Kulten in einer bestimmten Weise, etwa weiß gekleidet, teilzunehmen – das bezeugen verschiedene Inschriften. Die Weiterführung der Kulte galt nicht zuletzt deswegen als wichtig, weil die Unterbrechung den Zorn der Götter auf die Bürgerschaft ziehen konnte. Aus den erwähnten Inschriften geht zugleich hervor, dass nicht wenige Bürger sich diesen Pflichten entzogen. Das kann durchaus aus pragmatischen Gründen geschehen sein; von einem Widerstand aufgrund des Arguments der religiösen Freiheit ist nichts bekannt.
Im Falle der Christen ging es um Prinzipien. Im 1. Jahrhundert entwickelte sich die schiere Behauptung, Christianum esse – Christ zu sein – zu dem zentralen Vorwurf, den man durch die Darbringung eines Opfers widerlegen konnte. Bemerkenswert ist, dass die römischen Gesetzgeber offenbar nicht in der Lage oder willens waren, diese Unterdrückungsmaßnahmen gegen Christen als Verbot einer Religion zu formulieren, sondern sich auf die Bezeichnung Christiani konzentrierten, die sich auf die Anhängerschaft gegenüber einer bestimmten Person bezog, die ebenso politischen Motiven entspringen konnte.
Die decischen Maßnahmen in der Mitte des 3. Jahrhunderts verpflichteten alle Bürger zum Opfer und trafen daher Christen, beabsichtigt oder nicht, besonders hart – sie nahmen Kaiser Decius (249–251) als Christenverfolger wahr. Einer der Gründe für die neue Dimension der Verfolgungen dürfte gewesen sein, dass die constitutio Antoniniana des Jahres 212/3 fast alle freien Einwohner des Reiches zu römischen Bürgern gemacht hatte und damit zu Angehörigen einer Kultgemeinschaft, wie Caracalla in dem entsprechenden Gesetz betont. Das war ein deutlicher Unterschied zur Lage vorher.
Die Verfolgungssituation der christlichen Minderheit löste einen bemerkenswerten Reflexionsprozess über die Frage der Religionsfreiheit aus, dessen Ergebnis sich in einem 197 entstandenen Werk des christlichen, karthagischen Philosophen Tertullian niederschlägt, dem Apologeticum:
»Mag der eine Gott verehren, der andere Jupiter; mag der eine dem Himmel seine flehenden Hände emporstrecken, der andere zum Altar der Fides seine Hände; mag der eine (wenn ihr das denn meint) die Wolken zählen im Gebet, der andere die Kassetten der Deckentäfelung; mag der eine seine Seele seinem Gott weihen, der andere das Leben eines Bockes. Denn schaut, ob nicht gerade das auf die Liste der Gottesfrevel gehört, einem die Freiheit der Religionsausübung (libertas religionis) zu nehmen und die Wahl der Gottheit zu untersagen, so dass ich nicht verehren darf, wen ich will, sondern gezwungen bin zu verehren, wen ich nicht will. Niemand wird von einem Widerstrebenden verehrt werden wollen, nicht einmal ein Mensch.«19
Die Junktur libertas religionis, Religionsfreiheit, ist zum ersten Mal 197 im Apologeticum bezeugt; es findet sich, soweit ich sehe, auch kein früheres Äquivalent im Griechischen. Der Gedanke, niemand dürfe in religiösen Dingen einem Zwang unterliegen, war indes nicht neu – namentlich stoische Denker hatten ihn schon geäußert. Tertullian aber formuliert ihn als ein persönliches Recht. Vereinzelt wiederholten Christen diesen Gedanken, er taucht in der Mailänder Vereinbarung zwischen Konstantin dem Großen und Licinius auf und erscheint im 4. Jahrhundert dann bei heidnischen Autoren, die sich gegen christliche Unterdrückungsmaßnahmen verwahrten. Großes Gewicht hatte er jedoch nicht. Während der Spätantike geriet er vollends in den Hintergrund, wurde jedoch in der Moderne wiederentdeckt und entfaltete als Exaptation eine ganz andere nachhaltige Wirkung. Dort verbindet er sich mit einer politischen Haltung der Toleranz auf der Grundlage der Achtung vor dem anderen als freiem Vernunftwesen, die gerade nicht Tertullians Weltbild entspricht. Vielmehr insinuiert er, die Christen seien eigentlich überlegen, was ihre Unterdrückung um so unverständlicher erscheinen lässt.
Die Betonung eines Rechtes auf Religionsfreiheit erlaubte es, politische und religiöse Ordnung getrennt zu denken, Ansätze zur Ausdifferenzierung eines religiösen Systems zuzulassen. Tatsächlich entwickelten sich entsprechende Ansätze, begünstigt dadurch, dass religiöse Funktionsträger bei den Christen ohnehin keine politischen Ämter besaßen, da die christlichen Gemeinden unabhängig von der politischen Organisation bestanden. Um nicht missverstanden zu werden: Die Christianisierung des Römischen Reiches bedeutete nicht die Trennung von Religion und Staat – beides sollte bald während der Spätantike wieder sehr eng zusammenkommen. Aber sie zeigte: Beides konnte getrennt gedacht werden und teils auch funktionieren, wie dies in späteren Epochen geschehen sollte.