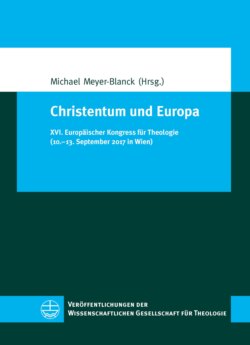Читать книгу Christentum und Europa - Группа авторов - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Reflexivwerden von Glauben
ОглавлениеAntiken Menschen musste der christliche Glauben als defizitär erscheinen: Die Christen verfügten über kein eigenes Heiligtum und wurden wiederholt des jüdischen Tempels verwiesen; sie hatten noch nicht einmal einen Leichnam vorzuzeigen; sie mussten erst neue Rituale und Gruppenstrukturen entwickeln. Was sie anboten, waren Berichte von Erfahrungen, über die sie sprechen konnten und die sie begründen mussten. Dem Druck zum Reflexivwerden waren die Christen eben wegen ihrer Schwäche von Anfang an ausgesetzt29 – dafür bedurfte es keines Prozesses der Hellenisierung. Der Zwang zum Explizitwerden schlägt sich in der frühen Bedeutung von Glaubensbekenntnissen nieder, die aus Tauffragen erwuchsen.30 Die nachdrückliche Rede über die Gehalte des Glaubens führte zur Entstehung eines speziellen Begriffs der Religion, der lange als normativ galt, dass nämlich eine Religion von bestimmten Glaubensinhalten und heiligen Schriften her zu bestimmen sei. Inzwischen wird dieser Begriff stark problematisiert; es steht sogar in Frage, ob man den Begriff der Religion überhaupt auf nicht-christliche Verhältnisse anwenden könne.31
Während die Glaubensbekenntnisse nach innen wirkten, unterlagen die Christen dem Zwang zum Reflexivwerden auch nach außen, gegenüber Heiden und Juden. Hier mussten sie für ihren neuen Glauben in einer für Nichtchristen plausiblen Weise argumentieren; besonders deutlich ist dies bei den sogenannten Apologeten. Selbst wenn diese sich faktisch stärker an zweifelnde Gemeindemitglieder gewandt haben sollen, wie heute oft vermutet wird, so waren dies Menschen, die offenbar mehr benötigten als ein Glaubensbekenntnis, die vielmehr nach Argumenten fragten. Die Apologeten konterten Attacken auf die Christen und verwiesen auf die hohe Moralität ihrer Glaubensbrüder, die offenbar durchaus anerkannt war. Dies konnte als Ausdruck einer besonders erfolgreichen Philosophie verstanden werden, die auffälligerweise sogar Ungebildete zu einem besseren Leben führte. Außerdem beriefen sich Apologeten gerne auf die gemeinsame Grundlage der Vernunft und beanspruchten entsprechende Argumente für ihren Glauben. Sie argumentierten in der Tradition von Rhetorik und Logik ihrer Zeit.
Die Auseinandersetzung mit Juden war insofern anders gelagert, als Christen und Juden eine gemeinsame Textgrundlage besaßen, den Tanach. Hier diskutierte man auf der Basis jener philologischen Methoden, die im Hellenismus vor allem in der Auseinandersetzung mit der Überlieferung Homers entstanden waren. In beiden Fällen gab es mithin einen neutralen Bereich, auf dessen Grundlage man argumentieren konnte, da beide Seiten ihn akzeptierten. Damit gewann intellektuelle Autorität eine hohe Bedeutung unter Christen. Bezeichnenderweise erhoben viele Bischöfe darauf Anspruch.
Der Zwang zum Reflexivwerden führte zu einer der größten und wirkungsmächtigsten intellektuellen Leistungen der Antike, die oft von Altertumswissenschaftlern nicht hinreichend gewürdigt wird: der christlichen Theologie. Der Zwang zu argumentieren sollte die Geschichte der Christen begleiten, bei vielen inneren Konflikten, ebenso jedoch in der Auseinandersetzung mit Nicht-Christen, eben weil Europa nie allein christlich wurde und mit dem Islam eine weitere Religion entstand, die es nötig machte, Argumente für den eigenen Glauben vorzubringen. Die Notwendigkeit, von einem neutralen Bereich aus zu argumentieren, sich also nicht allein auf die eigene Glaubenstradition zu beziehen, bewahrte überdies das Potential zur Selbstkritik. Die jeweiligen Zustände der Kirchen ließen sich in Hinblick auf die Praktiken oder die Glaubenslehren kritisieren, und zwar nicht allein durch Inhaber von Ämtern, sondern ebenso von Trägern intellektueller Autorität. Die auf die Nöte des Anfangs zurückgehende Reflexion des Glaubens wirkt unter anderem insofern im Sinne des Konzepts der Exaptation, dass sie eine institutionalisierte Kirche immer neu zum Nachdenken zwang.
Ein weiterer Effekt des Drucks, sich verständlich zu machen und zugleich dem universalen Anspruch zu folgen, ist die Polyphonie, die Mehrsprachigkeit der Christen, die keineswegs selbstverständlich war. Zwar kam es seit dem Hellenismus vor, dass heilige Schriften nicht-klassischer Religionen übersetzt wurden – das berühmteste Beispiel ist die Septuaginta –, aber keine Religion hat so massiv dazu beigetragen, zuvor kaum verschriftlichten Sprachen zu einer neuen Blüte zu verhelfen wie das Christentum. Erinnert sei nur an das Syrische und das Koptische. Sprachliche Vielfalt konnte durchaus von Christen unterdrückt werden, so wie zeitweise im lateineuropäischen Mittelalter, aber die Forderung nach allgemeinverständlichen Texten erhob sich immer wieder, gerade auf der Grundlage des universalen, auf persönlichen Entscheidungen beruhenden Anspruchs der Christen. Die Bereitschaft zum Umgang mit sprachlicher Vielfalt gehört vielleicht zu den wichtigsten Hinterlassenschaften des Christentums an die multilinguale Welt Europas.