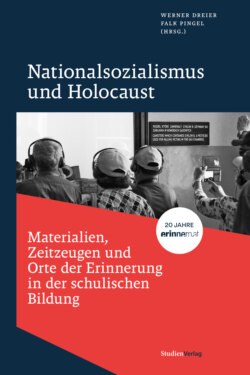Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 11
Historische Bildung als orientierender Kompass im schulischen Umgang mit dem Thema Holocaust
Оглавление„Weshalb soll über den Holocaust unterrichtet werden?“ (IHRA, 2019, S. 12). Auf diese Frage gibt es eine Vielzahl von Antworten (vgl. z. B. Brüning, 2018; Eckmann, 2017; Fracapane, 2014). Die IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) formuliert dazu in ihren Empfehlungen für das Lehren und Lernen über den Holocaust, dass der schulische Umgang mit dem Holocaust eine wichtige Möglichkeit bietet, „kritisches Denken, gesellschaftliches Bewusstsein und die Entwicklung der Persönlichkeit zu fördern“ (IHRA, 2019, S. 13). Geschichtsvermittlung scheint in diesem Zusammenhang in erster Linie für die Wissensvermittlung zuständig: „Lehrende in Institutionen (wie z. B. in Schulen) und informellen Umfeldern (wie z. B. in Museen und vergleichbaren Einrichtungen) können Lernende durch interdisziplinäre Zugänge, die auf gesichertem historischen Wissen basieren, motivieren.“ (IHRA, 2019, S. 13).
Zweifellos sind aus theoretischer Sicht interdisziplinäre Zugänge zum Thema Holocaust und fächerverbindende Vorgehensweisen angemessen, aber für die schulpraktische Vermittlung ergibt sich dadurch ein gravierendes Problem: Weil Schule heute nach wie vor und aus gutem Grunde nach Fächern gegliedert und mit dem Stundenplan rhythmisiert ist (Künzli, 2012; Schneuwly, 2018), haben es interdisziplinäre Vermittlungsanliegen schwer, ihren Platz im Schulalltag zu finden. Entweder fallen sie weg, oder sie finden einen Ort in einem disziplinär orientierten Lehrplan, was beim Thema Holocaust mit dem Fach Geschichte der Fall ist.
So entstanden in den letzten Jahren viele Vorschläge zum Lehren und Lernen über den Holocaust im Fach Geschichte. Dort, wo die Ziele für diese Vermittlung explizit ausgewiesen wurden, gingen sie weit über Wissensvermittlung hinaus und legten dar, welchen Beitrag die schulische Thematisierung des Holocaust zur Kompetenzentwicklung leistet. Da sich die Kompetenzmodelle von Land zu Land unterscheiden, unterscheiden sich auch die Argumentationen für dieselben Unterrichtsvorschläge von Land zu Land (Gautschi, 2017; Gautschi, 2015; Barricelli, 2012).2 Kompetenzen sind, laut der oft zitierten Definition von Franz E. Weinert, „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2002).
Wer nun aber als Lehrerin oder Lehrer im Geschichtsunterricht Überlebende des Holocaust in die Schulklasse einlädt, mit den Schülerinnen und Schülern in eine KZ-Gedenkstätte fährt, videografierte Zeitzeuginnen oder Zeitzeugen zu Wort kommen lässt oder Quellen und Darstellungen zu den Verbrechen analysiert, will den Lernenden weder in erster Linie Wissen vermitteln, noch will er sie prioritär befähigen, ein Problem zu lösen. Hier stehen oft andere Anliegen im Zentrum, z. B. „die Verknüpfung unseres Ichs mit der Welt“, wie das Wilhelm von Humboldt schon 1793 formulierte, als er „Bildung“ beschrieb (Humboldt, 1903, S. 283). Im Geschichtsunterricht im Allgemeinen und bei der Thematisierung des Holocaust im Besonderen geht es nicht um bloße Anpassung des Einzelnen an eine ihm vorgegebene Welt und deshalb nicht ausschließlich um das Lösen von bestimmten Problemen in dieser Welt. Vielmehr geht es um eine vielfältige Auseinandersetzung, „bei der der Einzelne seine je eigene Form des Menschseins in dieser Welt entwickeln kann – sich also selbst bildet“ (Sander, 2014, S. 11; Sander, 2018). Bildung – so lässt sich kurz und populär zusammenfassen – spiegelt einen reflektierten Umgang mit sich selber, mit anderen und mit der Welt (Wikipedia, 2020).
Jetzt hat sich die Geschichtsdidaktik in den letzten Jahren kaum mehr explizit mit historischer Bildung im Humboldt’schen Sinne beschäftigt. Die einschlägigen Werke sind an einer Hand abzuzählen (Henke-Bockschatz, 2005; Mayer, 2005; Dressler, 2012; Mütter, 1995; Buschkühle, 2009), und nicht einmal im Wörterbuch Geschichtsdidaktik kommt „historische Bildung“ vor. Bildung bezeichnet sowohl eine Entwicklung (Bildungsprozess) als auch einen Zustand (gebildet sein) (Sander, 2018). Historisch gebildet sind Menschen mit ausdifferenzierten personalen und sozialen Identitäten, die offen und neugierig dem Universum des Historischen begegnen, die über gut entwickelte Kompetenzen im Umgang mit Vergangenheit, Geschichte und Erinnerung verfügen und die darauf aufbauend die eigenen Handlungsspielräume in Gegenwart und Zukunft sehen und nutzen sowie die Chancen historischer Bildung erkennen und sich weiterhin bilden wollen (Gautschi, 2019b).
Wenn im Folgenden diese Definition entlang der drei Dimensionen Umgang mit Geschichte, Umgang mit sich selber und Umgang mit Gesellschaft ausdifferenziert wird, dann zielt dies auf eine Konkretisierung und Sichtbarmachung fachspezifischer Prinzipien und Konzepte. Es versteht sich von selber, dass historische Bildung – wie Bildung generell – ein lebenslanger Prozess ist und also nicht mit einer Inszenierung erreicht werden kann. Beschrieben wird ein Ideal und nicht etwa Lernziele für eine Unterrichtssequenz oder gar für eine konkrete Schulgeschichtsstunde. Es ist darüber hinaus klar, dass Bildung in den genannten drei Dimensionen auch von anderen Disziplinen angeboten wird. Aber historisches Denken, das als mentale Bewegung verstanden werden kann, die aus der Gegenwart ins Universum des Historischen und wieder zurück in die Gegenwart führt und auf diese Weise Sinn bildet, die das Handeln in Gegenwart und Zukunft beeinflussen kann, hat in allen drei Dimensionen besonderes Potential, das es zu erkennen und zu nutzen gilt. Um dies deutlich zu machen, sind in der folgenden Aufzählung exemplarische, themenspezifische Fragen aufgeführt.
Historisch gebildete Menschen können gut mit Geschichte umgehen. Sie …
(1.) … haben sich gesellschaftlich relevante Basisnarrative angeeignet (Gautschi 2012, S. 332–334) und kennen einschlägige Begriffe und Konzepte. Wenn sie die Phrase „Arbeit macht frei“ lesen, kommt ihnen das Eingangstor von Konzentrationslagern, z. B. zum KZ Auschwitz in den Sinn, und sie erkennen in diesem Ausspruch die zynische Verschleierung der menschenverachtenden Behandlung in den Konzentrationslagern während des Holocaust.
(2.) … erzählen und analysieren Geschichten (Narrativität/Konstruktivität) (Pandel, 2013, S. 86–105). Dabei verknüpfen sie sich erzählend mit der Welt (Humboldt, 1903) und zeigen, wie sie selber „in Geschichten verstrickt“ (Schapp, 2012) sind. Sie fragen beispielsweise: Was geht mich der Holocaust an? (Yad Vashem, 2012)
(3.) … nehmen das Vorher und Nachher (Temporalität), Kontinuität und Wandel (Historizität) (Pandel, 2005, S. 10–15) sowie Ursachen und Folgen von Prozessen, in diesem Fall des nationalsozialistischen Völkermords, in den Blick: Woran haben die Mitlebenden erkennen können, dass die Nationalsozialistische Partei die Jüdinnen und Juden systematisch vernichten wollte? Was geschah mit den Täterinnen und Tätern nach dem Zweiten Weltkrieg?
(4.) … unterscheiden Faktizität und Fiktionalität: Was genau ist von den Geschehnissen in einem ausgewählten Spielfilm zum Holocaust faktisch überliefert, was erfunden? (Moller, 2018; Fink, 2018)
(5.) … setzen Multiperspektivität und Kontroversität um (Lücke, 2017): Wie argumentierten jene Schweizerinnen und Schweizer, welche die Aufnahme von Flüchtlingen im Zweiten Weltkrieg ablehnten, und wie jene, welche sie befürworteten?
(6.) … streben nach Objektivität (Rüsen, 1997; Pandel, 2017) und sind sich bewusst, dass sie nie das Ganze sehen, aber reflektieren, inwiefern sich im Konkreten das Allgemeine zeigt (Exemplarität).
Historisch gebildete Menschen können gut mit sich selbst umgehen. Sie …
(7.) … haben eine ausdifferenzierte Identität und sind offen für Alterität (Identitätsbewusstsein) (Rüsen, 2020; Rüsen, 2013, S. 267–271; Bergmann, 1997): Was hätten wir Schweizerinnen und Schweizer im Zweiten Weltkrieg anders machen können oder müssen? Sie kennen darüber hinaus handelnde und leidende Menschen aus der Vergangenheit und können deren Handlungsspielräume einschätzen (Personalisierung/Personifizierung) (Schneider, 2017): Welche Schweizerinnen und Schweizer wurden als „Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet, und was war die Motivation für ihr Handeln? (Wisard, 2007)
(8.) … können in die Geschichte eintauchen (Immersion) und auch eine reflektierende Distanz einnehmen (Reflexionsfähigkeit) (Knoch, 2020): Wie gelingt es mir nachzuvollziehen, was die Menschen damals auf der Flucht erlebten? Welche Quellen helfen mir dabei?
(9.) … können mit Menschen mitfühlen (Emotion) und Prozesse analysieren (Kognition) (Brauer, 2013): Kann ich gleichzeitig mit den Opfern mitfühlen und ihr Schicksal reflektiert analysieren?
(10.) … denken kritisch, nehmen also Sachen nicht einfach so hin, wie sie scheinen, sondern fragen sich, ob die Sachen wirklich so sind, wie sie scheinen (Fink, 2017): War es wirklich so, dass die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs nicht mehr Flüchtlinge hätte aufnehmen können, als sie es tat? (Bonhage, 2006, S. 106–115)
(11.) … orientieren ihr Sein und Handeln an Werten (Moralisches Bewusstsein) (Pandel, 2005, S. 20): Welche Möglichkeiten gibt es, dass sich Auschwitz nicht wiederholt?
Historisch gebildete Menschen können gut mit Gesellschaft umgehen. Sie …
(12.) … sind in der Lage, ihr Sein und Handeln an der Gegenwart und der Lebenswelt zu orientieren und sich gleichzeitig auch davon zu lösen (Buck, 2012; Gatzka, 2019): Drohen auch heute in unserer Welt Völkermorde, und was kann ich dazu beitragen, sie, wenn immer möglich, zu verhindern?
(13.) … kennen und thematisieren ausgewählte Episoden aus der Vergangenheit, um daran Schlüsselprobleme der gegenwärtigen Gesellschaft zu zeigen (Klafki, 1985): Gibt es einen gerechten Krieg?
(14.) … haben die gesellschaftlichen Grundbedürfnisse (Ernährung, Wasser/Luft, Kleidung, Wohnen, Zusammenleben, Bildung, Arbeit/Erholung, Kommunikation u. a. m.) im Blick und stellen sich die Frage, welche Faktoren in dieser und jener Zeit die Befriedigung der Bedürfnisse erleichtert und welche sie erschwert haben (Gautschi, 2019a, S. 50): Welche Auswirkungen hatten die Nürnberger Rassengesetze auf das Alltagsleben von Jüdinnen und Juden in Deutschland ab dem Jahr 1935?
(15.) … thematisieren Inklusion und Exklusion (Völkel, 2017): Was waren die ersten Anzeichen für die Exklusion von Jüdinnen und Juden, und welche Möglichkeiten hätte es gegeben, dies zu verhindern?
Historische Bildung, Entwicklung und Zustand von Menschen in drei Dimensionen: im Umgang mit Geschichte, mit Gesellschaft und mit sich selbst. 3
Lehren und Lernen über den Holocaust dient also der Verpflichtung, Jugendlichen historische Bildung anzubieten und sie zu befähigen, gut mit Geschichte, mit Gesellschaft und mit sich selber umzugehen. Bei der Thematisierung von Holocaust scheinen auf exemplarische Art und Weise viele Grundfragen des menschlichen Handelns auf, die mit Grundfragen historischer Bildung zusammenhängen.
Natürlich ist es weder möglich noch erstrebenswert, mit jeder schulischen Thematisierung des Holocaust alle Aspekte historischer Bildung zu vermitteln oder alle Grundfragen menschlichen Handelns zu stellen. Die oben genannten Aspekte und Fragen dienen jedoch als orientierender Kompass für die Entwicklung von Inszenierungen, wie im Folgenden am Beispiel der App „Fliehen vor dem Holocaust“ aufgezeigt werden soll (vgl. dazu Gautschi, 2018).