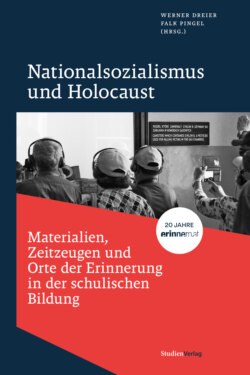Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 6
Werner Dreier „Wissen und Erinnerung sind dasselbe …“. Eine Rede anlässlich des Gedenktags 5. Mai1
ОглавлениеIm März 1938, als Österreich Teil des nationalsozialistischen Deutschen Reichs geworden war, schreibt in Wien Thomas Chaimowicz, ein 14 Jahre alter Gymnasiast, in sein Tagebuch: „Am 11. März, als die Würfel endgültig gefallen waren und wir … vor dem Radioapparat saßen, hörten wir Schuschniggs Abschiedsworte: ‚Gott schütze Österreich‘. Als dann, zum letzten Mal, die ehrwürdige Melodie der Haydnhymne ertönte … erhob sich mein Vater und wir alle mit ihm, mit Tränen in den Augen. Was meinen Vater damals wohl am meisten erschütterte, war meine Feststellung: ‚Nun sind wir die Armenier des Dritten Reiches.‘“
Der Schüler bezog sich auf den Völkermord an den Armeniern, der damals vor gut zwanzig Jahren stattgefunden hatte.
Am 24. April jeden Jahres gedenken wir des Völkermordes an den Armeniern, dem zwischen etwa 800.000 und 1.5 Mio. Armenier sowie assyrische bzw. aramäische Christen und Griechen zum Opfer gefallen waren.
Dieser Völkermord an den Armeniern war in den 1930er-Jahren in Deutschland und Österreich bekannt – auch, aber nicht nur durch den 1933 erschienenen historischen Roman „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ von Franz Werfel. Werfel war auf einer Orientreise 1929 in Damaskus auf verelendete armenische Kinder aufmerksam geworden, auf Waisen, deren Eltern ermordet worden waren. 1934 wurde der Roman in Deutschland wegen „Gefährdung öffentlicher Sicherheit und Ordnung“ verboten.
Der Roman wurde von vielen Juden während der nationalsozialistischen Verfolgungen gelesen. Als 1943 im Ghetto von Bialystok (Polen) dort Eingeschlossene diskutierten, ob bzw. wie sie sich wehren könnten, bezogen sie sich auf den Roman von Franz Werfel. Nur dass es im Gegensatz zum Roman in Bialystok keinen 40. Tag gab, an dem französische Kriegsschiffe die Rettung gebracht hätten.
Es gab auch personelle Verbindungen vom Völkermord an den Armeniern zum Nationalsozialismus.
Ein Beispiel dafür ist der damalige deutsche Konsul von Erzurum (Türkei), Max Erwin von Scheubner-Richter, der während des Ersten Weltkrieges über den Völkermord an das Auswärtige Amt berichtet hatte, nach 1920 der NSDAP beitrat und erster „politischer Generalstabschef“ von Adolf Hitler wurde. Er wurde beim „Marsch auf die Feldherrnhalle“ am 10. November 1923 von der Polizei erschossen. Scheubner-Richter war einer derjenigen, denen Hitler sein Buch „Mein Kampf“ widmete.
Wir können wohl davon ausgehen, dass Hitler genau wusste, wovon er sprach, als er vor dem Überfall auf Polen die Vernichtung der polnischen Eliten anwies und zynisch die rhetorische Frage stellte: „Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“
Doch es gibt auch andere Verbindungen vom Völkermord an den Armeniern in die Zeit des Nationalsozialismus: