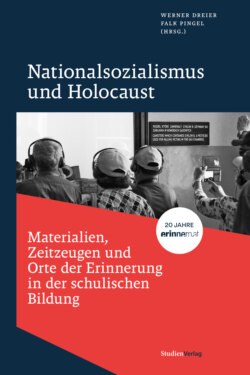Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 19
Lehren und Lernen in heterogenen Klassenzimmern
ОглавлениеDer faktische Zustand der „Migrationsgesellschaft“ ist in der Integrations- und Bildungspolitik vielerorts die längste Zeit verdrängt und vernachlässigt worden. Erst in den letzten Jahren sind im deutschsprachigen pädagogischen Diskurs über die Thematisierung und Vermittlung von Nationalsozialismus und Holocaust die Begriffe „Migrationsgesellschaft“ und „globalisiertes Klassenzimmer“ zentral geworden. Für beide ist längst eine Hybridität charakteristisch, die imaginierte Bilder einer homogenen Gemeinschaft korrigiert. Nationale Gedächtnisdiskurse und eine bislang mehrheitlich hegemoniale Geschichtsschreibung werden durch unterschiedliche Akteurinnen und Akteure der Migrationsgesellschaft herausgefordert, ergänzt und infrage gestellt.
Aushandlungsprozesse über Geschichtsbilder und über gegenwärtige und künftige gesellschaftspolitische Entwicklungen finden insbesondere auch im Klassenzimmer statt. Jugendliche unterschiedlicher Herkunft, mit eigener Fluchtund Migrationserfahrung oder mit Flucht und Migration als Teil der Familiengeschichte, lernen gemeinsam über die NS-Zeit, besuchen Gedenkstätten, treffen Zeitzeuginnen und -zeugen. Lerngruppenzusammensetzungen sind folglich von einer hohen (sozio-)kulturellen Diversität und von diversifizierenden Präkonzepten aller Teilnehmenden geprägt. Während sich für Jugendliche die Frage nach individueller und kollektiver Identität und ihrer Position zur österreichischen bzw. deutschen Vergangenheit und „Verantwortungsgemeinschaft“ stellt, stehen Lehrerinnen und Lehrer sowie außerschulische Pädagoginnen und Pädagogen vor der Herausforderung, nationalstaatliche Narrative und homogenisierte Erinnerungsperspektiven auszuweiten und jene von zugewanderten Lernenden miteinzubeziehen. Der schulbuchbasierte Unterricht ist im deutschsprachigen Raum immer noch ein weitgehend national orientierter; über die NS-Verbrechen in Südosteuropa und die Schauplätze des Zweiten Weltkrieges in den kolonialisierten Ländern erfahren Schülerinnen und Schüler erstaunlich wenig. „In den Bezugsangeboten bleiben sie daher oft in der Trias TäterInnen-Opfer-ZuseherInnen angerufen, die offensichtlich wenig Raum für andere Perspektiven lässt (wie etwa für Widerstandsdiskurse der PartisanInnen oder für postkoloniale Bezüge, aber auch für widersprüchliche Erinnerungskontexte, wie etwa in Algerien, dem Iran, Palästina etc.).“ (Sternfeld, 2016)
Die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust ist als globale Geschichte mit globalen Auswirkungen zu vermitteln; die Erinnerung daran kann sich demzufolge ebenfalls nicht an nationalstaatliche Grenzen halten. Angesichts der globalen Dimensionen von Weltkrieg und Holocaust ist es zudem nicht unwahrscheinlich, dass migrierte Jugendliche einen familiären Bezug zu den verhandelten Themen haben. Wesentlich ist, Erinnerungen nicht als miteinander in Konkurrenz stehend zu begreifen oder zu hierarchisieren.
Pädagogisch-didaktisch reflektierte schulische oder außerschulische Vermittlung von Nationalsozialismus und Holocaust sollte interkulturelle Perspektiven insofern berücksichtigen, dass der Fokus auf der „Migrationsgesellschaft als Kontext statt auf Migrant[Inn]en als Zielgruppe“ liegt (Kühner, 2008). Als soziale Kondition betrifft „Migrationsgesellschaft“ schließlich sämtliche Teilhabende, unabhängig von ihrer Herkunft. Astrid Messerschmid formuliert die Anforderung so: „Die Wissensvermittlung über den Holocaust – sein Ausmaß, die Art der Durchführung und seine ideologische Begründung – kann keiner Selbstbestätigung dienen über das eigene moralisch gefestigte Geschichtsbewusstsein oder über einen nationalkollektiven Konsens der Aufarbeitung“ (Messerschmidt, 2010).
Nicht hegemoniale Wissensproduktion, sondern Heterogenität in der Vermittlerpraxis sowie eine stärkere Subjektorientierung sollten als zentrale Ziele der Geschichtsvermittlung in post-migrantischen Gesellschaften formuliert werden.