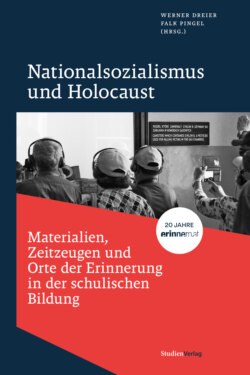Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 5
Martina Maschke und Manfred Wirtitsch 20 Jahre _erinnern.at_ – Das Bildungsministerium als Auftraggeber
ОглавлениеSeit Mitte der 1970er-Jahre hat sich die für Politische Bildung zuständige Abteilung des jeweiligen für Unterrichtsangelegenheiten zuständigen Bundesministeriums intensiv für eine Vermittlung der österreichischen NS-Vergangenheit eingesetzt. Unter anderem wurden seit 1976 regelmäßig Überlebende des Holocaust aus den unterschiedlichsten Opfergruppen als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in den Schulunterricht eingeladen, anfangs sogar von Historikerinnen und Historikern österreichischer Universitäten begleitet.
1978 wurde erstmals ein Zeitzeugenseminar durchgeführt, bei dem Lehrkräfte gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen intensiv Inhalte für den Zeitgeschichteunterricht erarbeiteten, Kontakte für Zeitzeugenbesuche in Schulen knüpfen konnten und damit zu einer guten Verankerung von Zeitzeugenbesuchen im Schulunterricht beitrugen. Diese Seminarreihe wurde seither kontinuierlich weitergeführt, sämtliche Kosten wurden vom Unterrichtsministerium getragen. Dennoch muss eingestanden werden, dass damit noch keine systematische und flächendeckende Auseinandersetzung – wie ab den 2000er-Jahren – erfolgte.
Eine neue Dynamik erhielt die Auseinandersetzung um die österreichische Vergangenheit durch die seit Mitte der 1980er-Jahre geführten nationalen und internationalen Debatten. Die sogenannte Waldheim-Affäre löste einen breiten gesellschaftlichen Diskurs in Österreich aus, der Grundlage für ein langsam sich formierendes Umdenken wurde: hin zu einer Aufgabe des Opfernarrativs – dieser durch die Politik beförderten Entlastungshaltung, die auf einer verkürzten Bezugnahme zur Moskauer Deklaration beruht, die besagt, „dass Österreich das erste freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden soll“. In diesem Narrativ wurde der zweite Satz mit nicht minder folgenschwerer Bedeutung von Beginn an ausgeblendet: „Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann, und dass anlässlich der endgültigen Abrechnung Bedachtnahme darauf, wieviel es selbst zu seiner Befreiung beigetragen haben wird, unvermeidlich sein wird.“ Die internationale Gemeinschaft mahnte daher Österreich vehement, seinen verhaltenen Umgang mit der Vergangenheit zu einer aufrichtigen, (selbst-)reflexiven und den internationalen historiografischen Standards entsprechenden Auseinandersetzung hinzuführen. Die berühmte Rede von Bundeskanzler Franz Vranitzky 1993 in der Knesset schließlich stellte das erste internationale offizielle Eingeständnis Österreichs seiner Mitverantwortung für die Schrecknisse des Zweiten Weltkrieges und der Shoah dar. Dieser Paradigmenwechsel ebnete den Weg zur Stabilisierung der israelisch-österreichischen Beziehungen.
Im Bildungsministerium führte dies in der Folge zu einer erheblichen Zunahme diplomatischer Vorsprachen von Delegationen aus Israel und den USA, die sich nach dem Stand der bildungspolitischen Maßnahmen im Bereich der Holocaust Education erkundigten. Damit verbunden war auch die Einladung, mit der nationalen israelischen Holocaust Gedenk- und Forschungsstätte Yad Vashem in Kontakt zu treten.
1996 wurde das erste bilaterale Memorandum zwischen Israel und Österreich in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur unterzeichnet. Damit konnte erstmals eine bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Holocaust Education verankert werden. Das vom damaligen österreichischen Unterrichtsministerium ins Leben gerufene Projektteam „Nationalsozialismus und Holocaust – Gedächtnis und Gegenwart“ (später wurde der Name in _erinnern.at_ umgewandelt) entwickelte gemeinsam mit Yad Vashem für österreichische Lehrkräfte ein eigenes Fortbildungsseminar in Israel, das im Jahr der EU-Sanktionen gegen Österreich (2000) seine erstmalige Umsetzung fand. Diese Seminare bildeten den Beginn von _erinnern.at_.
In Zusammenarbeit der Abteilungen „Bilaterale Internationale Angelegenheiten“ und „Politische Bildung“ wurden Überlegungen und neue Zugänge zu Nationalsozialismus und Holocaust, Erinnern und Gedenken aufgegriffen. Das Vermittlungsprogramm für Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an Schulen haben viele Lehrkräfte dabei gut als Grundlage bzw. Ausgangspunkt genutzt, um eine ehrliche, offene, den demokratischen Prinzipien entsprechende politisch-historische Bildung bei jungen Menschen in den Schulen anzubahnen und zu festigen. Die vielfach vorliegenden Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung – auch zahlreicher nationaler Forschungsvorhaben – zu Verstrickung von Österreicherinnen und Österreichern in die NS-Strukturen, zu Gewaltstrukturen und Gewaltausübung des NS-Regimes, zu Widerstand sowie zu Verfolgung und Ermordung von tausenden Menschen auf ehemals österreichischem Staatsgebiet entsprachen dem internationalen Stand der Forschung und es lag nahe, dass diese auch Eingang in den Schulunterricht finden sollten. Selbst wenn Lehrpläne und Schulbücher diese Thematik nicht ausließen, erschienen Aussagen von Schülerinnen und Schülern durchaus glaubhaft, dass diese Themen im Unterricht nicht vorkämen oder bloß oberflächlich behandelt werden würden.
Relativ früh wurde dabei für beide Abteilungen im Ministerium offensichtlich, dass es zur Weiterentwicklung der schulischen Erinnerungskultur einer Projektstruktur bedurfte, die flexibler und rascher auf Anforderungen aus der Lehrerschaft und den Bildungseinrichtungen reagieren konnte, als es die etablierten Institutionen zu diesem herausfordernden Thema vermochten. Insbesondere die beginnende, formal durch das Memorandum of Understanding gestützte Zusammenarbeit zwischen Israel und Österreich und daraus resultierende Fortbildungsseminare für Lehrpersonen in der Gedenk- und Lehrstätte Yad Vashem erforderten neue Strukturen in Österreich, um Lehrkräfte vor und nach dem Besuch von Yad Vashem-Seminaren zu begleiten, sie im Unterricht zu unterstützen, begleitende Fortbildungen zu organisieren, Projekt- und Unterrichtsberatung anzubieten und dadurch Holocaust Education mit vielfältigen und innovativen Ansätzen sukzessive im österreichischen Schulwesen zu etablieren.
Die neuen Strukturen sollten mit guten, konkreten Angeboten für die Unterrichtenden zusammenwirken. Mit der Etablierung eines Projektbüros in Bregenz konnte ein gut funktionierender Nukleus etabliert werden, um kontinuierlich am weiteren Aufbau eines „dezentralen Netzwerks“ in den Bundesländern, einer Website als wichtiger Ressource für Lehrkräfte sowie an der Entwicklung eines seither jährlich stattfindenden „Zentralen Seminars“ zu arbeiten. Zudem hatte das Projektbüro, das nunmehr die „Zentrale“ von _erinnern.at_ bildete, die Aufgabe, die Vor- und Nachbereitungsseminare für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Yad Vashem-Seminaren inhaltlich und organisatorisch zu planen und durchzuführen. Dadurch gelang es, _erinnern.at_ als Marke und „das Holocaust-Education-Institut“ des Bildungsministeriums zu etablieren und bekannt zu machen.
Die Kooperation mit anderen wichtigen nationalen Akteuren wie dem Nationalfonds des österreichischen Parlaments für Opfer des Nationalsozialismus, der als wichtiger Partner für die zentralen Seminare gewonnen werden konnte, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und dem Wiener Simon-Wiesenthal-Institut förderte einen engen inhaltlichen, wissenschaftlichen und zunehmend internationalen Austausch und eröffnete neue Perspektiven. Internationale Kooperationsanfragen, Projektangebote, Mitarbeit und Zusammenarbeit in und mit internationalen Organisationen wie dem Europarat, der UNESCO, der OSZE, im Rahmen der IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), mit Partnern in Deutschland, den USA, Frankreich und Holland usw. lenkten auch eine neue internationale Aufmerksamkeit auf Österreichs Umgang mit seiner Vergangenheit – und zogen durchwegs große Anerkennung nach sich.
Alle Ministerinnen und Minister seither – Elisabeth Gehrer, Claudia Schmied, Gabriele Heinisch-Hosek, Sonja Hammerschmid, Heinz Faßmann, Iris Rauskala und aktuell wieder Heinz Faßmann – konnten sich davon überzeugen, mit welcher Qualität _erinnern.at_ arbeitet und wie erfolgreich diese Arbeit national wie auch international wahrgenommen wurde und wird. Ihnen allen gebührt großer Dank dafür, dass sie sich – trotz ihres sehr fordernden politischen Amtes – dennoch immer die Zeit genommen haben, die Arbeit von _erinnern.at_ wertzuschätzen und es als große Bereicherung für den Bildungsbereich mitzutragen.
In einer 20 Jahre-Bilanz dürfen aber auch Themen wie anfängliche Vorbehalte, immer wiederkehrende Budget-Restriktionen, Personalfluktuation oder schwierige Projektsituationen nicht unausgesprochen bleiben. Wie bei jedem neuen Projekt waren auch bei _erinnern.at_ zu Beginn Euphorie und Skepsis häufige Partner. Das zwang zu gut überlegten Schritten, kostete mitunter aber auch Energie und führte zeitweilig zu Enttäuschungen, weil manches nicht so gelang, wie man es vermeinte. Projektfortschritte oder -abschlüsse führten zu Abschieden, personelle Wechsel zu anderen Herausforderungen, aber auch zur Hereinnahme von neuen Personen mit vielen neuen Ideen, neuen Energien, neuen Ansprüchen und dem Willen, dieses Projekt erfolgreich weiterzuführen.
Einen organisatorischen Meilenstein stellte die 2007 erfolgte Gründung des Vereines _erinnern.at_ dar. Damit konnte das bisherige Projekt als juristische Person auftreten; die Geschäftsführung war endlich von individueller Haftung befreit, gleichzeitig konnten Projektanträge gestellt werden, die zuvor nicht möglich gewesen waren. Hier ist zu erwähnen, dass aufgrund einer schon längeren Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres zur Neugestaltung der pädagogischen Arbeit an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen auch die Gedenkstätte im Vereinsvorstand vertreten ist und damit die enge Kooperation im Rahmen von _erinnern.at_ auch formal ihren Niederschlag gefunden hat.
Mit der Vereinsgründung war _erinnern.at_ zu einer echten Institution geworden – nicht mehr bloß ein „Projekt“. Auch international konnte _erinnern.at_ dadurch mehr und mehr als Institution, als Marke, als das „Holocaust-Education-Institut“ des Bildungsministeriums verortet und zu jenem Stellenwert hingeführt werden, den _erinnern.at_ national wie international einnimmt.
An dieser Stelle gilt es einer Person Dank auszusprechen, die federführend an der Gründung des Vereins _erinnern.at_ beteiligt war und die schulische Erinnerungskultur in Österreich seit Anbeginn entscheidend geprägt hat: Werner Dreier, der Geschäftsführer des Projekts und späteren Vereins, hat diesen Prozess über die letzten zwei Jahrzehnte mit großer Umsicht und mit Fachwissen, mit politischem Gespür und höchstem Engagement vorangetrieben, weiterentwickelt und begleitet. Er war und ist für das Bildungsministerium ein Ideengeber, unverzichtbarer Partner und genießt sowohl national als auch international als Experte größte Anerkennung. Als spiritus rector von _erinnern.at_ hat Werner Dreier mit seinem ausgezeichneten Kernteam in Bregenz im österreichischen Bildungswesen neue Maßstäbe für einen adäquaten Umgang mit Nationalsozialismus und Holocaust sowie mit dem Themenfeld Antisemitismus gesetzt.
Neben Werner Dreier möchten wir – exemplarisch für alle Mitwirkenden – drei besonders unterstützende Personengruppen erwähnen, die entscheidend zum Erfolg von _erinnern.at_ beitragen:
Die Netzwerkoordinatorinnen und -koordinatoren in den Bundesländern leisten hervorragende, intensive „Feldarbeit“, betreiben regionale Forschung, unterstützen und initiieren an Schulen Erinnerungs- und Gedenkprojekte. Sie sorgen für deren Verankerung in der Gedächtnislandschaft, ermöglichen Seminare und Fortbildungen an Pädagogischen Hochschulen sowie Schulen und stellen schlicht die „Community“ von _erinnern.at_ her. Ohne ihr Zutun und Engagement wäre _erinnern.at_ kaum diese Verankerung im Schulwesen gelungen.
Das Israel-Begleitteam übernimmt jährlich die anspruchsvolle Aufgabe, jene Lehrkräfte, die zur Fortbildung nach Israel reisen, zu unterstützen. Unsere Begleiterinnen und Begleiter entwickeln zusammen mit der internationalen Schule von Yad Vashem konsequent die jährlichen Programme weiter und betreuen die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer mit hoher Sensibilität. Für viele Lehrpersonen ist die Auseinandersetzung mit dem israelischen/jüdischen Narrativ der Shoah oftmals eine große Herausforderung, die nicht unterschätzt werden darf.
Der wissenschaftliche Beirat hat _erinnern.at_ von Beginn an begleitet, die wissenschaftliche Reflexion gewährleistet und vielfach Mentorenschaft übernommen. Dabei ist es gelungen, wissenschaftliche Zugänge und Perspektiven mit unterschiedlichen inhaltlichen und institutionellen Hintergründen zu eröffnen, zusammenzuführen und damit die wissenschaftsgeleitete Basis für alle Aktivitäten von _erinnern.at_ herzustellen. Zahlreiche wissenschaftliche Projekte auf nationaler wie internationaler Ebene basieren auf der Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat, den über all die Jahre Falk Pingel vom Georg-Eckert-Institut in Braunschweig (Deutschland) umsichtig und stets auf Fortschritt und Erfolg von _erinnern.at_ bedacht geleitet hat.
Seit etlichen Jahren schon hat der Vorstand Überlegungen angestellt, wie _erinnern.at_ nachhaltiger und über einen mittelfristigen – besser noch: längerfristigen – Zeitraum gut abgesichert werden könnte, um die erfolgreiche Arbeit auch für die Zukunft garantiert zu wissen. Aufgrund der Initiative von Bundesminister Heinz Faßmann zeichnet sich nun mit einer Integration von _erinnern.at_ in die OeAD-GmbH, die österreichische Agentur für Bildung und Internationalisierung, eine Lösung ab, die der bisherigen Arbeit von _erinnern.at_ gerecht wird und diese auch für die Zukunft sichert.
In diesem Sinne: ad multos annos.