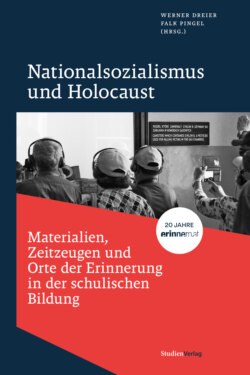Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 17
Lehren und Lernen über Nationalsozialismus und Holocaust im digitalen Zeitalter
ОглавлениеDie in den letzten Jahrzehnten massiv vorangeschrittene digitale Transformation hat insgesamt zu großen Veränderungen bei Bildungsangeboten, Nutzungsverhalten und Partizipationsmöglichkeiten geführt. Digitale bzw. virtuelle Angebote wie Apps und Online-Spiele entsprechen dem Lebensumfeld von Schülerinnen und Schülern, welche quasi rund um die Uhr online sind und weitgehend ein eigenes Smartphone und/oder ein anderes Endgerät besitzen. Die Technik an sich stellt für sie als digital natives zumeist keine relevante Herausforderung dar. Lehrpersonen aber agieren bei der Nutzung virtueller Räume für das historische Lernen immer noch zurückhaltend. Digitale Medien sind erst in jüngster Vergangenheit durch die krisenbedingte Umstellung auf Fernlehre vermehrt erprobt worden. Relevant für die Vermittlung sind sie zweifelsohne insofern, als dass der Transfer von Wissen mittels gewohnter Kommunikationsmittel erfolgt. Geschichten von Verfolgten des Nationalsozialismus, die immer seltener „aus erster Hand“ gehört werden können, sind mittels digitaler Technologien in moderner, kreativer und ansprechender Form zu erzählen, zu verbreiten und im Prinzip jederzeit zu nutzen. Die Social Media Serie „eva.stories“1 hat beispielsweise gezeigt, wie über den Kanal Instagram eine Geschichte des Holocaust erzählt und sehr schnell eine hohe Anzahl an Menschen erreicht werden kann.
Geschätzte 15.000-mal ist die von _erinnern.at_, der Pädagogischen Hochschule Luzern und der Fachhochschule Dornbirn entwickelte App „Fliehen vor dem Holocaust. Meine Begegnung mit Geflüchteten“2 zwischen 2018 und 2020 heruntergeladen worden. Die Lern-App ist aus dem Projekt SISAT (Shoah im schulischen Alltag) hervorgegangen, das darauf abzielte, durch videografierte-Interviews mit Zeitzeuginnen und -zeugen angeregtes historisches Lernen im regulären Geschichtsunterricht in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu erforschen – auch im Hinblick auf ein besseres Verständnis dafür, wie solche Lernangebote gestaltet sein müssen, damit Lernende den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen (Bibermann, 2018). Die mehrfach ausgezeichnete App erschließt Jugendlichen ab 14 Jahren über das Medium Film einen Zugang zu den historischen wie gegenwärtigen Phänomenen Flucht und Vertreibung. Schülerinnen und Schüler lernen Erinnerungen mit historischen Dokumenten zusammenzubringen sowie beide quellenkritisch zu betrachten. Die App kann individuell oder in einer Klasse bzw. Gruppe verwendet werden, im Präsenzunterricht, im Plenum oder in Einzel- bzw. Partnerarbeit, ferner im „Flipped Classroom“, einer Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht.
Mit Blick auf die Erfahrungen in der Corona-Krise lässt sich bereits bilanzieren, dass digitale Medien und Lernangebote für viele – vor allem junge – Menschen ein niedrigschwelliger Einstieg in die Beschäftigung mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust sein können. Der schnellen Verbreitung und Zugänglichkeit steht allerdings gegenüber, dass vor allem der interaktive Social Media Bereich sich weitgehend einer institutionellen, wissenschaftlichen oder didaktischen Regulierung, eines Kontrollmechanismus bzw. einer Art Autorisierung entzieht. Bei allen Angeboten ist es unabdingbar, didaktisch-kritische Zusatzangebote (historischen Kontext, Aufgabenstellungen etc.) zur Verfügung zu stellen, um die Lernenden im multimedialen und fordernden, möglicherweise überfordernden Umfeld gut anzuleiten und zu begleiten. Was den Einsatz von digitalen Medien im (Geschichts-)Unterricht betrifft, muss die Medien- und Informationskompetenz von Jugendlichen gestärkt werden, um diese gegen Stereotypen, Verschwörungstheorien und Manipulationsversuche zu wappnen. Lehrende können Lernende durch multimediale Tools und interdisziplinäre Zugänge, die auf gesichertem historischen Wissen basieren, motivieren.