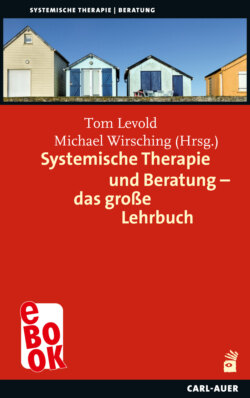Читать книгу Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch - Группа авторов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.3Soziale Arbeit
ОглавлениеWolf Ritscher
Systemische Soziale Arbeit hat sich als ein spezifisches Theorie-Praxis-Konzept für die Soziale Arbeit entwickelt, das mit anderen Basistheorien der Sozialen Arbeit (vgl. von Spiegel 2011) einige grundlegende Perspektiven teilt. Das Ziel Sozialer Arbeit ist vor allem die Unterstützung von Menschen in psychosozialen Notlagen bzw. deren Verhinderung oder Milderung sowie die Entwicklung von Kompetenzen für erfolgreiche Alltagsbewältigung in ihrer Lebenswelt und ihrem Sozialraum. Der Alltags- und Lebensweltbezug (Kraus 2006) ist dabei entscheidend, denn die als Auftraggeber der Sozialen Arbeit (Ritscher 2012, S. 182 ff.) verstandenen Klienten werden als Teil sozialer Netzwerke gesehen; das macht ihr Verhalten verstehbar und hilft bei der Suche nach Ressourcen. Mit den Klientinnen sind Ziele und Aufträge auszuhandeln – mit Rück-Sicht auf andere beteiligte Personen und auf Institutionen und Organisationen, die als Strukturelemente des Gemeinwesens bzw. des Sozialraumes verstanden werden.
Soziale Arbeit ist zugleich eine Profession, deren Fachkräfte sich im Rahmen einer wissenschaftlich fundierten Ausbildung ethisch reflektierte Grundlagentheorien und Handlungskompetenzen erworben haben (Heiner 2010).
Systemische Soziale Arbeit orientiert sich über diese grundlegenden Perspektiven hinaus an einer systemischen Metatheorie, deren Mitte der Begriff des Systems ist. Es gibt unterschiedliche Entwürfe, die sich zwar begrifflich unterscheiden lassen, aber viele Gemeinsamkeiten aufweisen (Hollstein-Brinkmann u. Staub-Bernasconi 2005).
Im systemisch-sozialen Konzept ist die gesellschaftstheoretische Fundierung Sozialer Arbeit, ihr Bezug auf durch gesellschaftliche Verhältnisse induzierte Probleme und die Verknüpfung des Individuums mit seinen Bezugsgruppen, der Gesellschaft und der ganzen (einen) Welt von zentraler Bedeutung. In Abgrenzung zu einem radikalkonstruktivistischen Verständnis wird die soziale Realität als eigene Kategorie jenseits aller subjektiven Konstruktion von Wirklichkeit anerkannt. Der Sozialen Arbeit kommt dabei als Menschenrechtsprofession die Aufgabe zu, mit dem politischen Anspruch auf eine gerechte Welt zu agieren. Vor allem die Schweizer Sozialarbeitswissenschaftlerin Staub-Bernasconi steht für diesen Ansatz (Staub-Bernasconi 2007).
Im systemisch-strukturellen Konzept bzw. ökosozialen Systemmodell (Bronfenbrenner; vgl. Ritscher 2007, S. 66 ff.) geht man von einer Beschreibung der innersystemischen Strukturen und der System-Kontext-Beziehungen aus. Die Symptome z. B. eines als auffällig bezeichneten Kindes, das in unterschiedlichen Systemen – Familie, Schule, Peers – agiert und sie durch sein Handeln in Beziehung bringt, werden durch die Dynamik in und zwischen diesen Systemen verstehbar. Die Beschreibung dieser zirkulären Prozesse vollzieht sich als »subjektive Rekonstruktion von Wirklichkeit« im Dialog von Adressatinnen und Fachkräften im Rahmen des »Unterstützungssystems« (Ritscher 2012, S. 182 ff.). Hinsichtlich Diagnostik und Intervention stützt man sich auf eine Kombination von Konzepten der Sozialen Arbeit (z. B. Komm- vs. Gehstruktur, Gemeinwesen- und Netzwerkarbeit) und Methoden der systemischen Therapie/Familientherapie (Ritscher 2007, 2012).
Das systemtheoretisch-konstruktivistische Konzept stützt sich auf die Rezeption der Theorie sozialer Systeme Niklas Luhmanns, die im vergangenen Jahrzehnt eine starke Position im Diskurs der Sozialen Arbeit eingenommen hat (vgl. Abschn. 1.2.4 und 1.3.6). Soziale Arbeit wird als autonomes gesellschaftliches Funktionssystem gesehen, das als autopoietisches System selbstorganisiert dem Code »Hilfe vs. Nichthilfe« folgt und nach Maßgabe eigener, systeminterner Hilfe-»Programme« operiert. Den Wirklichkeitskonstruktionen des Hilfesystems stehen die Konstruktionen der Klientensysteme gegenüber. Der Erfolg konkreter Hilfeprozesse ist daran gebunden, dass hier eine »strukturelle Koppelung« der verschiedenen Systeme gelingt, was am ehesten durch eine strikte Ressourcenorientierung erreicht werden kann (Kleve 2003; Hosemann u. Geiling 2005).
Im Zentrum des systemisch-entwicklungsorientierten Konzepts steht die von Rogers und Satir vertretene prinzipielle Entwicklungsoffenheit des Individuums mit dem – konzeptuell vorgegebenen – Entwicklungsziel einer größtmöglichen Kongruenz des Selbst (»Authentizität«) und seiner Selbstverantwortung. Entscheidend ist dabei der sichere Selbstwert in den Beziehungen zwischen dem Selbst und seinen sozialen anderen. Soziale Arbeit hat die Aufgabe, das Subjekt dabei zu unterstützen, internale und externale Barrieren gegen dieses Ziel zu überwinden (Germain u. Gitterman 1999).
All diese unterschiedlichen Richtungen treffen sich im Begriff des Systems, das als Denkmodell unterschiedliche Facetten von Wirklichkeitswahrnehmungen, Bedeutungszuschreibungen und sozialen Strukturen zu integrieren vermag (Ritscher 2012, S. 28 ff.).
Aus den vorgestellten theoretischen Modellen lassen sich vier zentrale Aufgabenbereiche einer systemischen Sozialen Arbeit ableiten. Das Unterstützungssystem (Ritscher 2007) besteht aus den Adressatinnen, den Fachkräften und anderen involvierten Faktoren in einem Setting gemeinsamer Auftrags- und Zielklärung, Problembeschreibungen und Problemlösungsversuche. Die Kontextualisierung aller Ereignis-, Beziehungs- und Problembeschreibungen (Ritscher 2012, S. 254) ergibt sich aus der System-Kontext-Struktur. Die Moderationsfunktion Sozialer Arbeit in sozialen Netzwerken nimmt die Abgrenzung unterschiedlicher Unterstützungssysteme und ihrer Kooperation in den Blick (Ritscher 2007, S. 59 ff.), und aus dem gesellschaftlichen Unterstützungsauftrag Sozialer Arbeit ergibt sich ein auch politisch verstandenes Engagement für sozial benachteiligte Personen und Gruppen.
Daraus ergeben sich Anforderungen an eine ethisch und theoretisch begründete Haltung, an Konzepte für Settinggestaltung, Diagnose, Intervention und Evaluation und die Entwicklung dafür hilfreicher Methoden. Die Haltung ist durch Allparteilichkeit, Interesse, Neugier, Respekt und eine Ressourcenstatt Defizitorientierung gekennzeichnet. Bezüglich der Sozialarbeiterinnen selbst zeichnet sie sich durch eine stete Reflexion der persönlichen Hilfemotive, ihres gesellschaftlichen Auftrags und der Akzeptanz des unauflösbaren Widerspruchs zwischen Wirksamkeitsinteresse und »nichtinstruktiver Interaktion« aus. Hinsichtlich des Hilfesystems geht es um Kooperation, Akzeptanz wechselseitiger Abhängigkeit und »Hilfe zur Selbsthilfe«. Letzteres Konzept enthält grundlegende Forderungen Sozialer Arbeit nach Transparenz, Partizipation und Empowerment (Germain u. Gitterman 1999). Diagnose und Intervention sind zwei Seiten des systemischen Handelns (Ritscher 2004) und gestalten sich in der Struktur von »Angebot« (Stichwort: Freiwilligkeit), »Eingriff« (Stichwort: Zwangskontext) und »gemeinsamem Handeln« (Stichwort: Kooperation; vgl. Müller 2012).
Jenseits einer durch den gesellschaftlichen Mainstream beförderten lösungsorientierten Perspektive muss betont werden, dass es nicht immer Lösungen geben kann, mit denen sich Soziale Arbeit überflüssig macht. Es gibt Fälle langfristiger oder lebenslanger Begleitung, bei denen es mehr um eine begrenzte Sicherung des Alltags als um strukturelle Veränderungen geht. Damit ist eine Gratwanderung zwischen der Gefahr einer professionell erzeugten Chronifizierung einerseits und der Akzeptanz begrenzter Ressourcen für die Alltagsbewältigung andererseits verbunden.