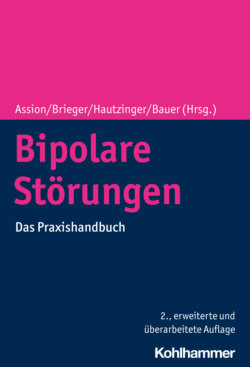Читать книгу Bipolare Störungen - Группа авторов - Страница 82
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.2 Evidenz zu potenziellen Risikofaktoren
ОглавлениеAus retrospektiven Studien ergaben sich Hinweise auf mögliche Risikofaktoren für die Entwicklung bipolarer Störungen, welche mittlerweile teils auch durch prospektive Daten (welche weniger mit dem Risiko von Verzerrungen einhergen) gestützt werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse von systematischen Übersichtsarbeiten (Pfennig et al. 2017) zusammengefasst.
Eine Familienanamnese für eine bipolare Störung ist der bestbelegteste Risikofaktor (Duffy et al. 2014). McGuffin et al. fanden bei einer Kohorte des Maudsley Twin Registry eine Konkordanzrate (d. h. Übereinstimmungsrate der Diagnose) von 67 % bei monozygoten und 19 % bei dizygoten Zwillingen. Die Heritabilität (d. h. die Erblichkeit der Eigenschaft, bei deren phänotypischer Ausbildung sowohl die Gene als auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen) wurde auf 0,85 geschätzt (95 % Konfidenzintervall 0,73–0,93) (McGuffin et al. 2003), was sehr hoch, und höher als bei jeder anderen psychiatrischen Störung, ist.
Darüber hinaus können depressive und unterschwellige (hypo-)manische Symptome Vorläufersymptome bzw. erste Symptome einer bipolaren Störung sein (Beesdo et al. 2009; Mesman et al. 2013). Inwieweit eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) das Risiko für die Entwicklung einer bipolaren Störung erhöht, ist aktuell nicht abschließend geklärt, mindestens eine Teilmenge der Patienten könnte ein erhöhtes Risiko tragen (Faedda et al. 2014; Wang et al. 2016).
Zusätzlich werden folgende potenzielle Risikofaktoren diskutiert: (a) kritische/stressreiche Lebensereignisse in der Vorgeschichte (Garno et al. 2005; Kessing et al. 2004), (b) Angstörungen in der Vorgeschichte, oder Besorgtheit/Ängstlichkeit/überhöhte Wachsamkeit/überhöhte Empfindsamkeit (Hafeman et al. 2016; Egeland et al. 2003), (c) Stimmungsschwankungen und beeinträchtigte Emotionsregulation (Thompson et al. 2003), (d) Veränderungen im Schlaf und der circadianen Rhythmik (Lenox et al. 2002), (e) Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit (Rush 2003) (dabei am ehesten bezogen auf Tetrahydrocannabidiol (THC) und Alkohol), und (f) bestimmte Persönlichkeits-, Temperaments- und Charakterzüge (wie bspw. hohe Extraversion, Novelty seeking (d. h. eine Tendenz zur Reizsuche), erhöhte Kreativität, eine hohe Belohnungssensitivität, ehrgeizige Zielstrebigkeit, ein zyklothymes/hyperthymes Temperament) (Mesman et al. 2013; Alloy et al. 2012; Blechert und Meyer 2005). Vor allem zu den Bereichen Lebensereignisse, Kognition, Immunologie sowie Hirnstruktur und -funktion liegen noch keine substanziellen Daten aus prospektiven Studien vor (Pfennig et al. 2017).
Die bis dato relativ gut belegten, potenziellen Risikofaktoren, die aktuell bereits im klinischen Alltag erfragt bzw. eingeschätzt und im Verlauf beobachtet werden sollten, sind in der o. g. S3-Leitlinie gelistet und werden in Kasten 6.2 wiedergegeben.
Kasten 6.2: Bis dato relativ gut belegte potenzielle Risikofaktoren für die Entwicklung einer bipolaren Störung
• Positive Familienanamnese für bipolare Störungen
• Angststörungen in der Kindheit
• Veränderungen im Schlaf bzw. Schlafprobleme
• Unterschwellige hypomanische Symptomatik
• Spezifische Persönlichkeits-, Temperaments- und Charakterzüge (hohe Extraversion, Novelty seeking, Dysregulation des Behavioral Approach Systems (d. h. der Annäherung vs. Hemmung als Verhaltens-/Temperamentszug)).