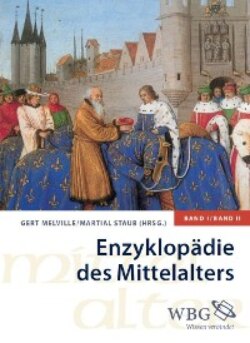Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 12
1. Gesellschaft
ОглавлениеDemographische Voraussetzungen. „Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei“ (Gen 2,18). Der alttestamentliche Schöpfungsbericht zeigt die Menschen als gesellige Wesen. Auch die mittelalterlichen Menschen lebten vergesellschaftet. Weil jedoch das Mittelalter eine „vorstatistische“ Epoche ist, stehen keine kohärenten Daten über Menge und Dichte der Bevölkerung zur Verfügung. Punktuelle Zählungen beginnen erst im 15. Jahrhundert. Der berühmte „Catasto“, ein penibles Herdsteuerverzeichnis für Florenz, stammt aus dem Jahre 1427. Schätzungen, die diese klaffende Lücke überbrücken sollen, sind dementsprechend ungenau, ihre Basisannahmen sind grob. Eine deutliche Zunahme der Bevölkerung ist aber in ihrer dramatischen Wucht unverkennbar. J. C. Russel etwa rechnete für das Jahr 650 (nach dem Einbruch des 6. Jahrhunderts) mit ca. 18 Millionen Menschen in ganz Europa, für 1000 mit etwa 38,5 Mio., für 1340 mit 73,5 Mio., für 1450 mit 50 Mio. (für Frankreich, England, das deutsche Reich und Skandinavien sind seine Schätzungen für 650 etwa 5,5 Mio., für 1000 12 Mio., für 1340 35,5 Mio., für 1450 22,5 Mio.). Diese Annahmen bewegen sich an der unteren Grenze sonstiger Vermutungen. Die Gründe der Differenzen zu diskutieren, erscheint zwecklos. Ein besonnenes historisches Urteil wird auf die quantitativen Dimensionen und die relative Dynamik dieser Zahlen, nicht jedoch auf ihre absolute Größe blicken.
In Kerneuropa hat die Bevölkerung seit dem 7. Jahrhundert bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts kontinuierlich mit explosiven durchschnittlichen Wachstumsraten (von jährlich 1 % bis 2 %!) zugenommen, der hohen Mortalitätsrate wie der geringen durchschnittlichen Lebenserwartung zum Trotz. Das mittelalterliche Europa hatte eine „jugendliche“ und wachsende Bevölkerung. Am Ende der Wachstumsphase hatte sich die Menschenzahl bis auf das etwa Sechsfache der Ausgangsgröße gesteigert. Im einzelnen freilich muß man dieses globale Bild sowohl regional als auch nach Zeitabschnitten wesentlich differenzieren. Allein die Hungerkrisen bei Mißernten (wie zu Beginn des 14. Jahrhunderts), Naturkatastrophen, Kriegswirren, Krankheiten und Seuchenzüge führten zu einem örtlichen, regionalen und – im äußerst seltenen Extremfall – auch allgemeinen punktuellen oder dauerhaften Absturz der Wachstumslinie. Der „Schwarze Tod“ (Beulenpest), der um die Mitte des 14. Jahrhunderts selektiv, aber doch weiträumig bis zu einem Drittel der Menschen dahinraffte und seither bis ins 18. Jahrhundert Europa immer wieder heimsuchte, sorgte für einen allgemeinen demographischen Einbruch [↗ Heilkunde und Gesundheitspflege]. Gleichwohl begann unmittelbar im Anschluß daran eine neue Konsolidierung der Bevölkerung und ein weiteres Wachstum, das zwar die alte Höhe bis zum Ende des Mittelalters kaum erreichte, jedoch die Lücke wieder auffüllte.
Die positive Dynamik war regional von Schwankungen begleitet, die dem hohen Zuwachs an Lebens- und Wirtschaftskraft auch in der Wahrnehmung der Zeitgenossen im Wege standen. Wachstumskrisen sorgten je und dann dafür, daß immer wieder die „gute alte Zeit“ Lobredner fand. Gleichwohl füllte sich das Land immer stärker mit Menschen; die Dichte der Besiedlung nahm in zuvor ungeahntem Maße zu. Rodung der Wälder, Besiedlung des Ödlandes, Vermehrung der landwirtschaftlichen Produktion [↗ Ländlicher Raum] sind ein allgemeines Phänomen, wenngleich es mit exakten Zahlen hier ebenfalls nicht gut steht. Der früh- und hochmittealterliche „Landesausbau“, der immer neue Flächen in Nutzung nahm, bis die weiteste Ausdehnung des Ackerbaus im späteren Mittelalter durch Umsiedlungen und Wüstungsvorgänge fast überall in Europa wieder eingeschränkt werden mußte, die Differenzierung von ländlichen Regionen, all das sorgte für weitere Aufnahmefähigkeit. In den zentralen Städtelandschaften Europas [↗ Städtischer Raum], in Norditalien, Südfrankreich, am Nieder- und Oberrhein drängten sich bald immer mehr Menschen. Die Quote der Stadtbewohner konnte am Niederrhein bereits im 15. Jahrhundert etwa ein Drittel, in einigen herausgehobenen Bezirken an der Wende zum 16. Jahrhundert sogar fast 50 % erreichen. Für das Herzogtum Brabant hat (1435) eine Feuerstellenzählung 92.418 Feuerstellen notiert, was auf etwa eine halbe Million Menschen schließen läßt. Demnach ist hier eine Dichte von bis zu 45 Menschen je Quadratkilometer anzunehmen. Für das Bistum Posen hat man dagegen für das Spätmittelalter weniger als ein Zwanzigstel dieses Wertes (2,1) ausgemacht. Im Gebiet des Deutschen Ordens zählte man im Kulmerland etwa 25 Menschen pro Quadratkilometer, in der Komturei Christburg nur etwa halb so viele.
Derartige Differenzen können keineswegs allein aus „natürlichen“ Unterschieden herrühren. Sosehr das Mittelalter die Menschen in kleinräumigen Regionen einband, ja gefangenhalten konnte, eine solch weitgespreizte Häufigkeitsverteilung ist ohne starke Wanderungsbewegungen nicht zu verstehen. Zu dem (wechselhaften) Druck der Bevölkerungsvermehrung tritt Fluktuation durch Migrationen, die freilich nicht ausschließlich weite Entfernungen großräumig durchmaßen. Die Kreuzzüge [↗ Kreuzzüge] exportierten sogar Menschen für längere Zeit über den vorherigen Rand der eigenen Welt hinaus. Auf Migrationen mußten die Menschen reagieren, sie konnten als Bedrohung oder als Chance erfahren werden, ja als beides zugleich. Die stabilitas loci, die einem Benediktinermönch abverlangt wurde [↗ Klösterlicher Raum], war eine kontrastive Idealforderung, die keine Allgemeingültigkeit besaß. Sie setzt vielmehr Wandern geradezu als Normalfall voraus. Die Grundstruktur der mittelalterlichen Gesellschaftsbildung ist also von Dynamik geprägt, nicht von Stillstand und Beharrung.
Wirtschaftlicher Rahmen. Bedingung und Folge der demographischen Dynamik war eine zuvor nicht gekannte Steigerung der agrarischen Produktion. Durch Ausdehnung der bewirtschafteten Flächen und durch Verbesserung der Produktionsbedingungen Nahrung für die Menschen zu gewinnen, war eine Aufgabe, die nicht ohne allseits gewaltige Anstrengungen lösbar wurde. Das Mittelalter ist eine Zeit der extensiven und intensiven Ausweitung des Ackerbaus und innovativer Wirtschaftsleistungen. Der „Landesausbau“ seit der Karolingerzeit [↗ Sozialräume], technische Erfindungen, Innovationen im gewerblichen und häuslichen Leben [↗ Praxis der Technik] zeigen die Menschen anpassungswillig und anpassungsfähig.
Die technische Verbesserung der Arbeitsgeräte war begleitet von Verbesserungen der Transporttechnik [↗ Transport und Verkehr]: Die Ausbreitung vierrädriger Wagen, die Verbesserung der Anschirrtechnik ermöglichten einen erhöhten Einsatz tierischer Energie. Eisen gewann zunehmend Anteil am bäuerlichen Arbeitsgerät, nicht nur beim Pflug, auch bei Sichel oder Sense, auch dem Spaten, der schon im Mittelalter den „Grabstock“ oder das „Grabscheit“ abzulösen beginnt [↗ Agrartechnik].
Verbesserungen des Werkzeugs begünstigten und erzwangen auch Änderungen in der Arbeitsorganisation. Das konnte sich mit tiefgreifenden sozialen Wandlungen verschwistern [↗ Bauerntum]. Allein, daß sich der schwere Räderpflug von einer Mehrzahl von Rindergespannen besser durch die Ackerflur ziehen ließ, legte einen Verbund der Arbeit nahe und machte ihn zugleich möglich. Wie weit dabei herrschaftliche Organisation, wieweit genossenschaftliche Kooperation eingriffen, entzieht sich unserer Kenntnis. Demgemäß streitet die Forschung hartnäckig um ein angemessenes Verständnis. Der durch die sogenannte „Dreifelderwirtschaft“ hervorgerufene Umbruch läßt sich in seinem Hergang nicht mehr im einzelnen verfolgen, nur in seinen Ergebnissen und in seiner Bedeutung für das Leben ermessen [↗ Landwirtschaft].
Intensivierung hatte ihren gesellschaftlichen Preis. Die neue Technik der Bewirtschaftung erzwang auch eine Disziplinierung der Dorfgemeinschaft, da die Arbeit witterungsbedingt in einem sehr schmal bemessenen Rhythmus erledigt werden mußte. Auch konnte der regelmäßige Fruchtwechsel nicht in Streulage der Einzelfluren gelingen. So begegnen wir in Verbindung mit der Dreifelderwirtschaft einer „Verzelgung“ der Dorffluren, in der durch Flurzwang der Fruchtwechsel geregelt wurde. Die Dreifelderwirtschaft setzt also einen hohen (höheren) Grad sozialer Organisation voraus, und sie erzwingt ihn auch.
Die Relation von Land- und Stadtbewohnern veränderte sich. Während in der Antike 8 bis 9 Landbewohner auf einen Bewohner in der Stadt kamen, waren es im Mittelalter schließlich (trotz Neusiedlung und Waldrodung) nur noch 4 bis 5. Die agrarische Produktivität ermöglichte ein größeres Gewicht der gewerblichen (städtischen) Produktion. Stadt und Land traten in fließenden Übergängen in ein neues Verhältnis [↗ Sozialräume]. Der stete Bevölkerungsdruck mündete in die langdauernden Prozesse der Stadtentstehung, Stadtgründung, Stadtentwicklung [↗ Städtische Genossenschaften]. Das 13. und 14. Jahrhundert hatten hier eine akzentuierte Rolle zu spielen. Der steile Anstieg der Bevölkerungszahl bedeutete nicht allein eine pure Vermehrung der Siedlungen; er führte vielmehr zugleich zu einer Binnendifferenzierung der Bevölkerung, zu neuen, urbanen Strukturen. Die Siedlungsbewegung setzte bereits im 9. Jahrhundert ein, verstärkte sich dann, um später fast überall das Bild zu bestimmen. Die Initiative zur Gewinnung neuen Siedellandes konnte wiederum von verschiedenen Seiten ausgehen, von den Bewohnern eines Siedelraumes gemeinsam, von einer Grundherrschaft, die ihre Besitzungen intensiver zu nutzen hoffte. Somit scheint für den mittelalterlichen Landesausbau beides verantwortlich, genossenschaftliche Anstrengung vieler und herrschaftlicher Ordnungswille einzelner; beides wirkte hier ineinander.
Von den Vorgängen selbst haben wir nur ein recht diffuses Bild. Wo wir genauer Einblick nehmen können, verdanken wir das in aller Regel den Besitzaufzeichnungen der großen geistlichen Grundherrschaften [↗ Grundherrschaft], die uns durch die Listen der Zugänge gleichsam einen Negativabdruck der Herrschaftskomplexe des Laienadels aufbewahrten. Im Augenblick, da eine Liegenschaft durch fromme Schenkung den ursprünglichen Verband der adligen Grundherrschaft verläßt, können wir sie erfassen, jetzt als Teil des klösterlichen Besitzes. Bei günstiger Überlieferungslage und angemessener Fragestellung lassen sich recht genaue Aufschlüsse über die Sozialstruktur einer Region gewinnen (klassisch die Studie von G. Duby zum Mâconnais). Wenn Siedlungsverträge und Freiheitsurkunden, Rechtsverleihungen, Kaufverträge und dergleichen uns ein genaueres Bild ermöglichen, wird klar, daß Neusiedlung bald nicht nur die Zwischenräume zwischen den alten Siedlungskammern erfaßte, sondern auch unbesiedeltes Land „am Rande“ der Siedlungszonen erschloß.
Ein Siedlungswilliger, der sich der mühseligen Rodungsarbeit stellen mochte, hatte eine Wahl, auch wenn sich seine Alternativen nicht regelmäßig allzu breit fächerten: zu armselig waren die Wegeverhältnisse, zu beschwerlich eine Aufsiedlung, zu kümmerlich die Nachrichten. Wo herrschaftliche Initiative Siedlungen in Gang setzte, da mußte dem Neusiedler, der nicht primär aus eigener Initiative gerade dort siedeln wollte, auch ein attraktives Angebot gemacht werden. Doch günstige Konditionen versprachen Erfolg, wenn er in den eingegangenen Bindungen dauerhaft bleiben und am Weiterziehen gehindert werden sollte. Was ihm angeboten wurde, brauchte sich natürlich nicht überall zu gleichen. Hier finden sich erhebliche Unterschiede, chronologisch – je früher das Angebot erfolgte, desto magerer erscheint es meist heute – und erst recht natürlich regional. Nicht überall auch hat sich das Geflecht der sozialen Beziehungen in die gleiche Richtung entwickelt. Der Grundzug freilich, daß alte Bindungen in Bewegung gerieten, daß neue Strukturen sich bildeten und dann allmählich verfestigten, ist überall in Europa zu beobachten.
Intensivere Bewirtschaftung führte zur Spezialisierung, die ebenfalls höhere Leistungen erbringen konnte. Ein Prozeß der Differenzierung, Spezialisierung und neuen Gewichtsverteilung begleitete sichtbar die agrarische Produktion. Wirtschaftliche und soziale Folgen fallen ins Auge. Die Einsicht, daß ohne Stadt das Dorf nicht gedacht werden kann und ohne Dorf nicht die Stadt, gilt auch für agrarisch bestimmte Gesellschaften. Im Mittelalter lebten gewiß viele Stadtbewohner noch als „Ackerbürger“. In den Grundrissen der Gründungen wird jedoch die Marktfunktion der Stadt durch die zentrale Lage der Straßenmärkte unterstrichen. Eine Stadt ist Markt für ihr Umland in mehr oder minder tiefer Staffelung.
Die mittelalterliche Stadt in ihrer Vielfalt, in ihrer rechtlichen und sozialen Vielfarbigkeit [↗ Städtische Genossenschaften] macht vor allem das spätere Mittelalter zu einer städtisch geprägten Zeit [↗ Städtischer Raum]. Gewiß, die Mehrheit der Bevölkerung blieb weiterhin auf dem Lande, aber wesentliche Phänomene sind ohne städtische Erfahrung nicht vorstellbar. Die ökonomische Entwicklung läßt sich ohne das städtische Gewerbe, ohne den städtischen Kaufmann [↗ Kaufleute, Bankiers und Unternehmer] nicht begreifen und noch scheinbar so weit entfernte Phänomene wie die neue Frömmigkeit der Bettelorden [↗ Religiosentum] oder die neuen Wissenschaften der Universitäten [↗ Universitäten] seit dem 13. Jahrhundert sind ohne Stadt nicht denkbar. Damit einher ging eine Umschmelzung herkömmlicher Bindungen und Standesverhältnisse. Naturgemäß war das weit entfernt von einem totalen Wandel; schon gar nicht bedeutete es Freiheit für alle. Freiheit gehörte jedoch, so abgestuft sie auch verstanden wurde, zu den Bedingungen der europäischen Stadtentstehung und Sozialentwicklung. Märkte hatten eine besondere Funktion: Als prinzipiell freier Tauschplatz konstituierten sie für die ihn nutzenden und organisierenden Gruppen eine besondere Chance [↗ Handel].
Die mittelalterlichen Städte [↗ Städtische Genossenschaften] blieben, an modernen Vorstellungen gemessen, von bescheidener Größe. Die mittelalterliche „Großstadt“ beginnt bei einer Einwohnerzahl von 10.000. Städte wie Köln oder Prag (im 13./14. Jahrhundert ca. 30.000 Einwohnern) oder London und Paris (Schätzungen schwanken zwischen 30.000 und 40.000 Einwohnern) sind Ausnahmen gegenüber den kleinen und kleinsten Ackerbürger- und „Minderstädten“. Durch topographische Berechnungen ist die Ausdehnung der Siedlungen zu greifen. Binnen weniger Jahrzehnte sind bisweilen erhebliche Steigerungen zu erkennen. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts umfaßte Paris etwa 40 Hektar; die Stadtmauer vom Beginn des 13. Jahrhunderts umschloß 252 Hektar. In Florenz wurde die erste mittelalterliche Mauer (von 1173–1175) am Beginn des 14. Jahrhunderts durch einen neuen Mauerring abgelöst, der das Areal der Stadt auf mehr als das Sechsfache vergrößerte; freilich ist diese Fläche bis heute nicht überall bebaut worden. Im Spätmittelalter jedoch wuchsen viele gegründete Siedlungen nicht mehr über ihre bescheidenen Anfänge hinaus. Als „Minderstädte“ hatten sie entweder vom Herrschaftsträger von Anbeginn an absichtlich nicht die volle Ausstattung erhalten; sie konnten wohl überörtliche Funktionen übernehmen, sind aber nicht mehr (und bisweilen bis heute nicht) zu Städten herangewachsen. Andererseits blieb auch den zahlreichen Kleinst- und Zwergstädten, die kaum 500 Einwohner und selten mehr als 8 Hektar Siedlungsareal erreichten, für eine lange Zukunft das Schicksal von Kümmerformen des Städtewesens vorbehalten, aus dem sie erst Industrialisierung und moderne Verkehrswirtschaft befreiten.
Die wachsende Bedeutung der städtischen Zentren hatte für das Wirtschaftsleben regional und überregional schwer übersehbare Folgen [↗ Verkehr]. Im 12. und 13. Jahrhundert beginnen sich gewaltige Verkehrsströme zu formieren. Der Fernhandel [↗ Handel], der für Luxusgüter schon früh nachweisbar ist, umfaßt jetzt auch andere Waren. Neben die Seide tritt das Wollgewebe, neben das Gewürz Wein und Hering. In Italien lösen seit dem 12. und 13. Jahrhundert die Handelsstädte des Nordens (Genua, Pisa, Venedig) die älteren Hauptplätze des Mittelmeerhandels (wie Amalfi oder Ancona) ab, um alsbald gegenseitig in heftige Konkurrenz zu treten. Einen gewaltigen Auftrieb brachten die Kreuzzüge dem Warenverkehr, der über das Mittelmeer noch lange in Ost-West-Richtung Luxusgüter beförderte, während er west-östlich Metallarbeiten, Wolltuche, Wein (und natürlich in beiden Richtungen Pilger und Kreuzfahrer) auf bisweilen lange Wege brachte. Die italienischen Seestädte gründeten am östlichen Mittelmeer ganze eigene Stadtviertel, die bis über die Rückeroberung Palästinas durch die Muslime hinaus lebensfähig blieben. Hier wurde nicht nur Handel mit Syrien und Ägypten getrieben; hier flossen Handelswaren, die bis ins tiefere Asien, den Fernen Osten, Japan und China reichten [↗ Entdeckungen]. Am Ende des 13. Jahrhunderts wird der Venezianer Marco Polo seine Reisen nach China unternehmen (1271–1298). Caffa auf der Krim, von wo aus sich in der Mitte des 14. Jahrhunderts der „Schwarze Tod“ in Bewegung setzte, barg eine genuesische Handelsniederlassung. Auch an der Mündung des Don hatten Genua und Venedig Stützpunkte, über die bis nach Rußland und nach Innerasien gehandelt wurde.
Das Europa nördlich der Alpen blieb von diesen Entwicklungen nicht unberührt. Um die Ostsee bildete sich ein eigenes Verkehrssystem, dessen städtische Träger sich zu einer eigenen politischen Rolle berufen zeigten: die Hanse [↗ Regionale Bündnisse; ↗ Handel]. Handel verband über die Ostsee und Nordsee West und Ost, Frankreich, Flandern, England mit Polen und Rußland. Bei den Geschäften ging es vorwiegend um Güter des allgemeinen Gebrauchs, um Getreide, Stockfisch, Salz, Wein, auch um Pelze und wiederum um (Woll-)Tuche. Das ältere mediterrane System trat mit dem nordosteuropäischen bald in Beziehung. Von Venedig suchte man schon früh den Landweg über Süddeutschland nach Norden, von Genua aus ging es über Frankreich nach Flandern und Brabant. Das Textilrevier, das sich von der Normandie bis zur Picardie, von Chartres über die Champagne nach Niederlothringen und Brabant erstreckte, gab dem Handel Schwungkraft. Große Mengen des durch strenge Kontrollen auf einem gesichtert hohen Standard gehaltenen Tuches wurden seit dem 12. Jahrhundert nach Italien gebracht, auch als Halbfertigprodukt, das dort weiterverarbeitet, gefärbt, veredelt wurde. Die Rohstoffe, englische, spanische, maghrebinische Wolle, holte man zur Verarbeitung dorthin: Florenz verdankte seiner Wollindustrie seinen spätmittelalterlichen Aufstieg.
Die Warenströme kreuzten sich auffällig in der Champagne. Die Städte dort hatten davon den Nutzen und wußten ihn wahrzunehmen. Die „Messen“ der Champagne wurden nicht allein zu einem frühen Umschlagplatz des Fernhandels; man begann dort auch vorbildhaft die Instrumente des Waren- und Geldverkehrs zu entwickeln, die für den europäischen Handel noch jahrhundertelang maßgeblich bleiben sollten. Die sich entfaltende Geldwirtschaft [↗ Geld] erhielt frühzeitig Kreditinstitute; sie schuf sich, an den kirchlichen geldfeindlichen Traditionen des Zinsverbotes vorbei, flexible und rentable Werkzeuge und entwickelte sie fort. Mit Terminkäufen und Geld- wie Warenanweisungen auf einen bestimmten Platz wurde in Ansätzen hier relativ früh der Weg zum „Wechsel“ beschritten, der sich bald als Lenkungsinstrument als griffig erwies, was sich dann auch Kirche und Staat zunutze machten. Ein bargeldloser Zahlungsverkehr über weite Entfernungen und über zahlreiche Landesgrenzen hinweg, der auch der avignonesischen und dann wieder römischen Kurie des Papstes und ihrem Finanzbedarf früh zugute kam, ein immer flexibler ausgestattetes Kreditsystem, all das wurde Schritt für Schritt entwickelt und ausgebaut.
Soziale Prozesse. Die zunehmende Durchdringung des Raumes läßt die Regionen Europas zusammenrücken. Das Straßennetz verdichtet sich; die Menschen setzen sich in Bewegung, nicht nur als einzelne, sondern in großer Menge: Schiffe, Handelswagen, Siedlertrecks, Pilgerzüge, Wallfahrer, Handwerksgesellen, Kreuzfahrer, große und kleinere Heereskontingente durchmessen den Raum [↗ Verkehr]. Von den theologischen Zeitgenossen wird der Mensch in seinem Erdenleben, in Aufnahme und Fortsetzung eines altchristlichen Bildes von der Erdenpilgerschaft zunehmend als homo viator bezeichnet [↗ Christliches Gottes- und Menschenbild]. Auch für die sozialen Verbände brachten die neuen Erfahrungen eine neue Beweglichkeit. Dem Druck der Verhältnisse konnte man jetzt leichter ausweichen, konnte anderwärts sein Glück suchen und finden. Die deutsche Ostsiedlung [↗ Osteuropäischer Raum], die spanische „Reconquista“ mit der „Repoblación“ setzte Menschen in Bewegung [↗ Iberischer Raum]. All dies kommt im späteren Mittelalter zu voller Entfaltung. Die horizontale Mobilität bringt soziale Lockerung. Sie begünstigt eine „vertikale“ soziale Mobilität. Soziale Mobilität heißt jedoch immer beides; sie bringt Aufstiegschancen und Abstiegsgefahren. Der Möglichkeit für die einen zu steigen entspricht die Bedrohung der anderen mit mehr oder minder tiefem Fall. So hilft horizontale Mobilität den sozialen Status für den einzelnen wie für ganze Gruppen zu verändern, für Familien, Personenverbände und lockerere Gruppierungen. Man sucht, zur Absicherung und zur Bändigung der Kräfte der Veränderung neue Ordnungen und Formationen und findet sie, bisweilen erfolgreich für künftige Jahrhunderte [↗ Soziale Formationen]. Jetzt werden Muster künftiger Strukturen zumindest in den Grundzügen festgelegt. Europa ist in einer formativen Phase.
Diese Differenzierungs- und Umschmelzungsprozesse, die die frühmittelalterliche Sozialordnung umwandeln, sind begleitet von einer deutlichen Tendenz, die (teilweise neuen) Statusgruppen in sich selbst zu vereinheitlichen, sie nach unten hin abzuschirmen, zur Sicherung vor jähem Absturz. Solche Tendenzen zeigen sich in Deutschland etwa im Reichsfürstenstand, im hohen und im niederen Adel, in der Ministerialität, im sogenannten Patriziat der Städte. Sie bezeugen weniger die Stabilität der hergebrachten Ordnung, als daß sie Bemühungen spiegeln, im Fluß der Entwicklung Fixpunkte und Halt zu gewinnen. Besonders markant tritt die Tendenz zur Selbstabschließung und Konsolidierung bei den Neubildungen in Erscheinung; sie findet sich am auffälligsten bei Aus- und Abgrenzung des Adels gegenüber den anderen Landbewohnern. Je mehr sich die milites als Berufskriegerschicht seit dem 11. und 12. Jahrhundert als einheitliche Gruppe etablieren [↗ Adel], desto deutlicher tritt ihnen auch die Bauernschaft als sich homogenisierende Gruppe gegenüber [↗ Bauerntum]. Aus einer ständisch sehr ungleich zusammengesetzten Schicht wird in beiden Fällen ein „Stand“ der Gesellschaft mit durchgängigen Merkmalen, auch rechtlichen. Der ältere Gegensatz zwischen servus und liber wird zwar nicht aufgegeben. Deutlicher im Vordergrund des Interesses steht aber der Unterschied von rusticus und miles. Rustici sind nicht mehr waffenfähig, werden des Schutzes bedürftig. In den Gottesfrieden [↗ Gottesfriede, Landfriede] des 10. und 11. Jahrhunderts, in den Landfrieden seither werden sie einem Sonderschutz unterstellt. Für den rusticus sind Ochsen und Pflug, labor (schwere Handarbeit) und paupertas Assoziationsfelder, für den miles Pferd und Schwert, die negotia belli und divitiae.
Selbstabgrenzung und Spezialisierung des sogenannten „niederen Adels“ hatten auch Folgen für den Lebensstil und den Lebenskreis dieser Schicht [↗ Adel]. Auch hier kommt es zu einer topographisch sichtbaren Separierung des Adelssitzes von den bäuerlichen Siedlungen, der als Höhenburg (bzw. Wasserburg) zur charakteristischen Wohnstätte wird. Seit dem 11. Jahrhundert ist der Übergang vom Herrenhof auf die Adelsburg im Gang und erreicht im 13. und 14. Jahrhundert immer breitere Dimensionen. Je wichtiger Befestigungsanlagen für die Herrschaftssicherung wurden, desto höheren Wert gewann auch der Besitz einer Burg. Die Befestigung wurde zum Statussymbol und zur Bedingung des Statuserhalts zugleich. Durch den Umzug in die adlige Höhenburg wird sichtbar – mit immensen Anstrengungen und Kosten – Distanz gewonnen und dargestellt. War eine Burg aber einmal gebaut, entstand das Problem herrschaftlicher Integration in die fürstliche Hoheit. Zuordnung und Einordnung „fremder“ Befestigungen in die eigene Herrschaftssphäre blieb für die sich konsolidierenden Herrschaftsbildungen eine dauerhafte Aufgabe. Keineswegs konnte sie überall durch lehnsrechtliche Eingliederung gelingen [↗ Lehnswesen; ↗ Feudalrechte]. Mit dem jeweiligen Landesherrn konkurrierten nicht nur andere Fürsten, Bischöfe und benachbarte Vasallen; auch die Städte traten auf den Plan, wenn sie sich einen größeren Herrschaftsbereich sichern wollten. Burgen, die man nicht unmittelbar in die eigene Hand bekam, konnte man in vielfacher Abschattierung von sich abhängig machen. Eine dauerhafte Zuordnung bei Wahrung rechtlicher Selbständigkeit boten die vielfältigen sogenannten „Öffnungsverträge“ des Spätmittelalters, mit denen der burgsässige Adel für den Fall militärischer Konflikte in herrschaftliche Verfügungskompetenz eingebunden werden konnte. Im Falle einer Bedrohung „öffnete“ der Burgbesitzer seine Fortifikation dem Fürsten oder der Stadt. Auch die adlige Einzelburg entging damit dem Prozeß der Herrschaftskonzentration nicht auf Dauer.
Während die Abschließung des niederen Adels durch Vertiefung der Gräben zu den rustici in der Regel schon im 12. Jahrhundert zum Erfolg führte, verschwanden die Zäune zwischen Ministerialität und Adel wenig später: Die militia, das berufsständische Element, das eine Brücke gebildet hatte, konnte später zurückgedrängt werden, „Ritter“ wird man dann durch Geburt. Schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wird Ritterbürtigkeit als Voraussetzung für den „Ritterschlag“ deklariert, früh etwa in den Konstitutionen von Melfi (1231).
Die Abschließung des Adels bedeutete gewiß auch Sicherung der materiellen Grundlagen des eigenen Lebensstils. Tendenziell hieß das auf längere Sicht zudem eine quantitative Reduktion der Adelsschicht, da eine Ergänzung der durch Aussterben oder Verarmung ausscheidenden Familien jetzt schwieriger wurde [↗ Verwandtschaftliche Ordnungen]. Das hohe Lebensrisiko des Berufskriegerstandes gefährdete die biologische Kontinuität der agnatischen Linie, auf die der Erbgang jetzt konzentriert wurde. Eine schwierige Balance bei der Familienplanung mußte dafür sorgen, daß einerseits genügend männlicher Nachwuchs vorhanden war, um eine Fortsetzung der Generationenreihe zu ermöglichen. Andererseits waren natürlich auch zu viele Geschwister, die zu versorgen waren, problematisch. Seit dem 12. Jahrhundert lassen sich daher verschiedene Steuerungsstrategien in diesem Dilemma erkennen: man konnte durch eine Akzentuierung des Erbrechts, die dem Ältesten (oder dem Jüngsten) den grundherrschaftlichen Gesamtbesitz der Familie zuwandte und die Geschwister anders, das heißt finanziell, abfand, eine gewisse Bremswirkung erzielen [↗ Verwandtschaftliche Ordnungen]. Andererseits konnte die brüderliche Gesamthand durch entsprechend vorgeschriebenes Heiratsverhalten in ihrem Bestand geschützt werden. Schließlich konnte man auch die Kirche als Versorgungsinstitut heranziehen, die ihren Klerus seit dem 11. Jahrhundert verstärkt zum Zölibat verpflichtete (was zumindest legitimen Nachwuchs ausschloß, aber günstige Wirkungen kirchlicher Unterstützung öffnete) [↗ Klerus]. Bei einem drohenden Aussterben einer Familie des Hochadels wurde eine kirchliche Karriere nicht selten durch die Rückkehr in den Laienstand abgebrochen. Daß der Kandidat die Priester- oder Bischofsweihe noch nicht erhalten haben durfte, schränkte den Kreis möglicher Begünstigter nicht allzustark ein, da ohnedies der Empfang der höheren Weihen von adligen Klerikern im Spätmittelalter nicht gerade vordringlich betrieben wurde.
In allen Zeiten des Mittelalters lassen sich Aufsteigerfamilien nachweisen, denen es, zumindest in über Generationen gestreckter Folge, gelang, in die Oberschichten vorzudringen und auf die Dauer Akzeptanz zu finden. Das Reservoir, aus dem diese Familien kamen, waren zunehmend nicht unbedingt die dörflichen Siedlungen, sondern vor allem die kleinen Landstädte, wie sich überhaupt städtische Oberschichten mit dem Adel des Umlandes gerne und zunehmend amalgamierten. Die Bewegung und Beweglichkeit der Gesellschaft des Mittelalters wird im allgemeinen gewaltig unterschätzt.
Politische Ordnungen. Auch den Menschen des Mittelalters war die politische Ordnung, in der sie leben mußten oder wollten, allenfalls durch die – allerdings mächtige – Tradition, nicht von Natur aus vorgegeben. Noch hatte sich nicht herausgebildet, was wir heute „Staat“ nennen, eine politische Ordnung von Dauer für die Menschen eines Gebiets mit (relativer) Selbständigkeit als eine die Gesellschaft insgesamt umfassende politische Gestalt. Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft war noch nicht getroffen. Das Mittelalter befand sich allenfalls auf dem Wege zum (modernen) Staat. Gleichwohl ist ein großes Stück dieses Weges zurückgelegt worden. Auf den mittelalterlichen Voraussetzungen ruht der europäische Staat der Frühneuzeit.
Politische Konsolidierung von Herrschaftsverhältnissen beginnt bereits mit der Ausbildung der Völker und Länder, mit „Stammesbildung“, „Volksbildung“, „Staatsbildung“ oder „Reichsbildung“, dem also, was die Forschung für die Frühzeit oft mit dem Kunstwort „Ethnogenese“ zu erfassen versucht [↗ Gentile Ordnungen]. Denn die „Stämme“, von denen die Historiker früher gerne sprachen, waren ebensowenig feststehende Größen, die sich nur mehr noch entwickeln mußten. „Stämme“ – oder besser Völker (gentes) – bildeten sich in komplizierten Prozessen, teils als aktiv Handelnde, teils passiv als „Opfer“ fremder Initiativen. Anders als es die frühere Geschichtswissenschaft sehen wollte, die etwa in den „romanischen“ und „germanischen Völkern“ Europas quasi vor-, ja übergeschichtliche Gegebenheiten erblickte, erkennen wir diese angeblichen vorgeschichtlichen Voraussetzungen historischer Prozesse in aller Regel nicht mehr an. Statt dessen untersucht die Forschung das Wechselspiel von politischer Reichsbildung und kontingenter ethnischer Konsolidierung, wobei ersterem eine früher zu wenig erörterte Initiativrolle zugeschrieben wird. Ordnungsvorstellungen unterschiedlicher Herkunft, aus antik-klassischer Überlieferung, christlich-patristischer Tradition, verschiedener gentiler Herkunft (wobei nicht allein die Römer und Germanen zählen, sondern auch die Kelten oder Slawen) sowie in spontaner mittelalterlicher Neubildung wirkten in verschiedener Mischung zusammen, um die jeweiligen mittelalterlichen Herrschaftsbereiche (regna) allmählich zu konstituieren und zu unterschiedlicher Zeit zur Wirkung kommen zu lassen.
In seiner Mannigfaltigkeit füllt dieses Geschehen das gesamte Mittelalter [↗ Geschehenskomplexe und Regionen]. Ziele und Normen der dabei ablaufenden Prozesse von Herrschaftsbildung, Herrschaftserhaltung und Herrschaftsintensivierung lassen sich unter anderem an Vorstellungen über die „richtige“ Verfassung des Gemeinwesens verdeutlichen. Wenn Zeitgenossen ihre politischen Umstände zu bedenken und zu bewerten hatten, orientierten sie sich an ihren Vorstellungen über „richtige“ Politik. Insofern lassen ihre handlungsleitenden Vorstellungen gewissermaßen die Innenansicht der zeitgenössischen politischen Welt erkennen. Die mittelalterlichen politischen Theorien gehen in breitgefächerter Variation immer wieder der Frage der Legitimität und Legitimation von Herrschaft nach, schon allein um die allgegenwärtige Gewalt [↗ Krieg und Frieden] einzudämmen. Früh schon sieht es politische Theorie als ihre Aufgabe an, den Herrscher an seine Christenpflichten und spezifischen Verpflichtungen als Herrscher zu erinnern [↗ Politische Ordnungsvorstellungen]. Schon die karolingischen „Fürstenspiegel“ versuchen [↗ Karolinger], der Herrschaftsausübung auf diese Weise ethische Zügel anzulegen und in der Selbstbindung des Herrschers Macht und Gewalt zu zähmen. Dabei ist – mehr oder minder deutlich – die Prüfung inbegriffen, ob der Herrscher tut, was er soll. Diese „funktionale“ Frage kann sich noch im panegyrischen Herrscherlob verbergen, da auch hier der Herrscher rühmend an seine Pflichten gemahnt wird. In den Fürstenspiegeln seit dem Umbruch des Investiturstreits erfolgen solche Hinweise verstärkt. Sie werden auch über den Herrscherhof auf die Stände der Gesellschaft verbreitert, welche einer gestrengen Ständedidaxe unterworfen werden: Jeder sollte wissen, wie und was er zu tun hatte. Eine systematische Beschreibung des „rechten“ Regierens wird mit den Verpflichtungen des Herrschers abgeglichen. Die aus der Antike übernommene Organismusmetaphorik hilft als Denkmodell dabei ebenso wie andere Traditionen, etwa die Hierarchienvorstellung neuplatonischer Provenienz. Komplexe Institutionen konnten so gedanklich erfaßt und unter ein vorherrschend monarchisches Ideal eingeordnet werden.
Die Aufgabe, Herrschaft (und damit politische Organisation, Gehorsamspflicht und Entscheidungskompetenz) zu legitimieren, blieb der politischen Theorie über das Ende des Mittelalters hinaus erhalten, wenngleich sich die Traditionen, Textsorten und vordringlich behandelten Themen wandelten. Verschiedene Rezeptionsschübe antiken Staatsdenkens stießen das Nachdenken immer erneut zu Neubesinnung und Neubildung an. Die entstehende Rechtswissenschaft, die nicht zuletzt auf einer Rezeption des römischen Rechts fußte [↗ Rechtskreise], bewirkte breitgefächerte Überlegungen, bis seit dem 12./ 13. Jahrhundert die Aristotelesrezeption [↗ Scholastik] für eine nochmalige Erweiterung des Horizonts sorgte. Hatten es die Juristen des kanonischen und des römischen Rechts mit Scharfsinn unternommen, die (Rechts-)Beziehungen der Glieder der Kirche untereinander zu durchdenken, so entwarfen die Philosophen und Theologen auf der Basis der aristotelischen praktischen Philosophie eine allgemeine Theorie der menschlichen Gesellschaft, die sich verschiedentlich dann auch von den Vorgaben der Antike entfernen mochte und auf einen selbständigen Weg zu den kontraktualistischen Theorien der Moderne begab. Die dabei entwickelten Verhaltensnormen konnten die Zustände der damaligen Welt tendenziell transzendieren. Wenngleich die Monarchie weiterhin meist als „beste“ Verfassungsform galt, wurden doch weithin von verschiedenen Autoren Konsens und Wahl als Quelle politischer Legitimität wirkungsvoll in Geltung gesetzt. Erlebter Verfassungswandel, besonders etwa in den Stadtrepubliken, aber auch in den großen Reichen Europas, ließ in Anlehnung an Aristoteles ganze Typologien von Ursachen und Formen solchen Wandels und Widerstandsüberlegungen gegen tyrannischen Mißbrauch entstehen. Verfassungswandel konnte sogar mit Nachdruck gefordert werden. In der großen Strukturkrise der Kirche während des Großen Abendländischen Schismas [↗ Abendländisches Schisma] und des Konziliarismus [↗ Genossenschaftliche Ordnungen] wurden, zunächst für die Kirche, solche Ansätze am frühesten in einen einheitlichen Diskurs überführt. Doch hat der Streit um Superiorität von Papst oder Konzil die künftige Entwicklung der politischen Verfassung in nichtkirchlichen Bereichen nicht vorwegnehmen können.
Staat und Kirche. In der Gesellschaft des Mittelalters war das Verhältnis von Kirche und politischer Ordnung näher zu klären. Freilich ist die Ausgangslage zu beachten. Ebensowenig wie es einen „Staat“ im Mittelalter gab, war auch die Kirche als eine „Religionsgemeinschaft“ unter anderen Religionsgemeinschaften zu verstehen wie in der Moderne [↗ Kirchliche Organisationsformen]. Das Mittelalter erreichte zwar noch nicht eine endgültige Entkoppelung von Staat und Kirche, schritt in der Emanzipation der politischen Organisation aus kirchlichen Bindungen aber deutlich voran. In der Karolingerzeit noch hatte ein „massives Staatskirchentum“ einem Herrscher wie Karl dem Großen deutliche Eingriffsmöglichkeiten in kirchliche Belange gelassen [↗ Karolinger]. Die Großen des Reiches versammelten sich zu Rat und Entscheidung zusammen mit den Bischöfen der Kirche, die damals wie später aus der gleichen sozialen Schicht stammten wie die Elite des Reichs.
Im Spätmittelalter hatte ein König [↗ Königtum; ↗ Königsherrschaft] immer noch eine herausgehobene Stellung innerhalb der Kirche, jedoch war er nicht selbstverständlicher Teil der kirchlichen Amtshierarchie. Umgekehrt hatten Bischöfe und Prälaten wohl eine sichtbare Rolle in der poltischen Repräsentation des Landes zu spielen (wie etwa die deutschen Fürstbischöfe). Auch sie aber mußten ihre politischen Entscheidungen institutionell in anderen Bezügen finden und durchsetzen als im engeren Kreis des Klerus. Hatte zunächst den König die ihm zugeschriebene sakrale Aura dem Adel des Reichs tendenziell entrückt, so hat die Amtskirche sich seit der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts mehr und mehr als Klerus selber von dem christlichen Volk abgehoben und damit von den Laien abgegrenzt.
Zugleich nahm die Amtshierarchie sich selbst immer stärker als Kern und Spitze der (Amts-) Kirche wahr. Papst und Kurie wuchsen zu wirklichen Zentren der kirchlichen Organisation, zwar mit einem den Umständen entsprechend sehr spezifischen Instrumentarium von Bürokratie und Kommunikationstechnik, aber mit ungeahnter und wegweisender Effizienz, vor allem mit vorbildhafter finanzieller Durchschlagskraft. Der König jedoch wurde zunehmend entzaubert. Er galt seit der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts als „Laie“ und blieb damit Geistlichem fremd; unmittelbare Eingriffe in geistliche Belange blieben ihm verwehrt [↗ Investiturstreit]. Das schloß nicht aus, daß seine Herrschaft aus göttlichem Auftrag abgeleitet wurde, aber diese Herkunft mußte zum Thema erbitterter Auseinandersetzungen werden: War ein unmittelbarer Gottesbezug des Herrschers an der kirchlichen Organisation vorbei denkbar? Konnte, ja mußte nicht ein derartiger Auftrag von der Papstkirche vermittelt werden? Wie aber verhielt sich dann das politische Gemeinwesen zu Interferenzen der Amtskirche?
Die Antworten auf diese Fragen waren höchst unterschiedlich. Formulierten die einen den kirchlichen Anspruch in absolutistischer Strenge, die der weltlichen Gewalt kein eigenständiges Lebensrecht mehr ließ, so konnten andere Positionen fast gleichzeitig die gesamte Kirche im staatlichen Gemeinwesen verschwinden lassen. Daneben fehlte es auch nicht an Vermittlungsversuchen. Solche Differenzen beflügelten aber, unabhängig von den konkreten Aussagen der einzelnen Theorie, letzten Endes die Freiheit der politischen Entscheidung. Die Emanzipation weltlicher Herrschaftsübung und die Säkularisation der politischer Verfassung machten im Spätmittelalter unverkennbare Fortschritte. Was in der Kirche begonnen hatte, verallgemeinerte sich. Die „Entzauberung der Welt“ machte beim König keineswegs halt und ergriff die gesamte Gesellschaft. Das Mittelalter hat diese Entwicklung nicht selber voll abgeschritten; in ihren Debatten haben die mittelalterlichen Positionen jedoch die Moderne geprägt und grundgelegt. Das Mittelalter ist selbst ein unaufgebbarer Teil der freiheitlichen Gesellschaftsgeschichte Europas.
JÜRGEN MIETHKE