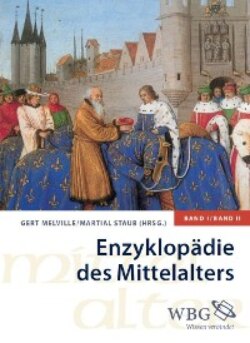Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 17
Kaisertum
ОглавлениеDas mittelalterliche Kaisertum war eine durch das kollektive Gedächtnis und durch selektive Erinnerung geprägte Institution. So verschieden das Wissen über das antike Kaisertum war, so verschieden fielen auch die Vorstellungen vom Kaisertum im Mittelalter aus. Ein auch nur annähernd einheitliches Konzept hat gefehlt. Besonders die Epochen der verstärkten Rezeption antiker Bildung (karolingische und ottonische „Renaissance“, „Renaissance des 12. Jahrhunderts“) gaben neue Anstöße zum Nachdenken über das Kaisertum. Man konnte das Amt des Kaisers in Anlehnung an seinen Ursprung unter Augustus als vorwiegend weltliches Herrscheramt charakterisieren; man konnte an das christliche Kaisertum der Spätantike anknüpfen oder mit Verweis auf die (nachträglich stilisierte) Buße Theodosius’ I. vor Ambrosius von Mailand seine Abhängigkeit von der Kirche herausstreichen. Ebenfalls möglich war der konkrete Bezug auf die stadtrömische Herkunft des Kaisertums oder die abstrakte Definition des Kaisers als ranghöchsten Herrschers über mehrere Völker. In diesem zuletzt genannten Sinne bezeichneten sich angelsächsische und spanische Herrscher des Früh- und Hochmittelalters als Kaiser in bezug auf die geographische Region. Eine Konkurrenz zum byzantinischen oder römisch-deutschen Kaisertum war damit nicht angestrebt.
Erneuerung. Bereits im Zuge der Erneuerung des westlichen Kaisertums durch Karl den Großen sind unterschiedliche Vorstellungen aufeinandergeprallt. Das Zeremoniell der Kaiserkrönung am Weihnachtstag 800 sah zuerst die Krönung durch den Papst am Grab des hl. Petrus (der sogenannten Confessio S. Petri) und danach die Akklamation des römischen Volkes vor. Karl, der das Procedere wohl kaum unfreiwillig über sich ergehen ließ, betrachtete im Unterschied zum Papst weder das eine noch das andere als konstitutiv für den neu erworbenen Rang. Seinem Sohn Ludwig dem Frommen setzte er im Jahr 813 eigenhändig die Krone auf das Haupt und machte ihn so zum Mitkaiser. Auch die Historiographen am Hof der Karolinger werteten die aktive Annahme des Kaisernamens durch Karl höher als die passive Krönungszeremonie. Am Hof war man sich einig, daß die historische Situation die selbständige Annahme des Kaisertitels durch Karl rechtfertigen würde. Denn im byzantinischen Reich herrschte mit Irene zum ersten Mal in der Geschichte eine Kaiserin [↗ Abendland und Byzanz] und im Westen lagen alle ehemaligen Hauptstädte des weströmischen Reichs in der Hand Karls des Großen. Die Macht des Frankenkönigs wurde als kaisergleich wahrgenommen. Trotz dieser historischen Situation bedurfte es zur Konkretisierung der Planungen für die Kaiserkrönung eines unmittelbaren Anlasses. Dieser war mit dem Attentat auf Papst Leo III. im Jahr 799 gegeben. Der gescheiterte Versuch, den Papst durch Verstümmelung amtsunfähig zu machen und aus seiner Stellung zu entfernen, rief die Frage nach der herrschaftlichen Zuordnung der Stadt und des Dukats Rom hervor. Im Verlauf des 8. Jahrhunderts hatte sich der Papst der byzantinischen Oberherrschaft entzogen und – mit der echten Pippinischen und der gefälschten Konstantinischen Schenkung im Rücken – eigene Ansprüche auf Souveränität erhoben. Nach der Kaiserkrönung in der Petersbasilika reklamierte Karl die Herrschaft über Rom für sich und übernahm die Aburteilung der Attentäter (801). Der Status von Rom blieb in den folgenden Jahrzehnten umstritten und erfuhr teilweise voneinander abweichende Regelungen. Um so wichtiger war es für das Papsttum, die Verleihung der Kaiserwürde in die eigene Hand zu nehmen. Ludwig der Fromme wurde nach der Ernennung zum Mitkaiser durch die Initiative des Papstes ebenso erneut gekrönt (815) wie sein Sohn Lothar I. (826). Ludwig II., ein Urenkel Karls des Großen, empfing den Kaisertitel im Jahr 850 erstmals ausschließlich aus der Hand des Papstes. Seitdem wurde die Kaiserkrönung durch den Papst in der Peterskirche von Rom zur Norm im gesamten Mittelalter.
Im Gegensatz zur Kaiseridee Karls des Großen brachte das Kaisertum in den Jahren von 855 bis 924 keine hegemoniale Stellung zum Ausdruck, sondern war untrennbar mit der Königsherrschaft über Italien verbunden. Nach dem Aussterben der Karolinger in Italien bestimmte der Papst über das Kaisertum. Mit Karl dem Kahlen (875–877), Karl dem Dicken (881–887) und Arnulf von Kärnten (896–899) konnten jeweils nur kurzfristig Herrscher nördlich der Alpen für das Kaisertum gewonnen werden. Nach dem Tod Arnulfs blieb es in der Hand lokaler italienischer Potentaten. Mit Berengar I. († 924) nahm das Kaisertum ein vorläufiges Ende.
Nach dem Ende des Frankenreichs entstanden im 10. Jahrhundert unabhängige Königreiche im Westen (das spätere Frankreich), im Osten (das spätere Deutschland), in Burgund und in Italien. Auf die Erneuerung des Kaisertums schien nach 924 wenig hinzudeuten. Erst das zufällige Aufeinandertreffen verschiedener historischer Begebenheiten erweckte in Otto I. den Gedanken an die Annahme der Kaiserwürde. Erster Auslöser war der umstrittene Herrschaftswechsel zu Berengar II. in Italien (950). Dieser sorgte durch die engen verwandtschaftlichen Beziehungen der Königsfamilien sowie durch das politische Interesse der süddeutschen Herzöge auch im Reich nördlich der Alpen für Verwicklungen. Otto I. riß die Initiative an sich und zog im Jahr 951 nach Italien, um die Witwe des alten Königs Adelheid aus den Fängen des neuen Königs Berengar II. zu entreißen. Er nahm Adelheid zur Frau und setzte Verhandlungen mit dem Papst über eine Kaiserkrönung in Gang. Nach einem abschlägigen Bescheid zog sich Otto aus Italien zurück und übergab das italienische Königtum durch Belehnung an Berengar und dessen Sohn. Erst zehn Jahre später änderte sich die Lage, als Papst Johannes XII. aus Sorge vor dem Machtzuwachs Berengars bei Otto I. um Hilfe ansuchte und dafür die Kaiserkrönung in Aussicht stellte. Otto ergriff diese Gelegenheit um so bereitwilliger, als er durch seine Rangerhöhung die Chance gekommen sah, in Kooperation mit dem Papst sein Projekt der Errichtung eines Magdeburger Erzbistums gegen den Widerstand der betroffenen Bischöfe durchzusetzen. Beim Romzug wagte Berengar keinen offenen Kampf und Otto erreichte ungehindert Rom. Dort wurde er am 2. Februar 962 von Johannes XII. zum Kaiser gekrönt. Am folgenden Tag bestätigte Otto im sogenannten Pactum Ottonianum die Besitzrechte des Apostolischen Stuhls und bekannte sich zu seiner Rolle als Beschützer des Papsttums. Im Gegenzug sollte der Papst in Zukunft einen Treueid auf den Kaiser ablegen.
Mit der Krönung Ottos I. war die Grundlage für das mittelalterliche Kaisertum gelegt. Der Rombezug des Kaisertums festigte sich erst allmählich. Nach der Einnahme des byzantinischen Tarents (982) nannte sich Otto II. Romanorum imperator augustus. Dieser Titel wurde unter Heinrich II. üblich. Im späten 11. Jahrhundert setzte sich für den König der Titel Romanorum rex durch und zeitgenössische Historiker begannen die Reihe der Kaiser von Augustus bis in die Gegenwart durchzuzählen. Um 1100 faßte der Geschichtsschreiber Frutolf von Michelsberg diese Vorstellung einer bruchlosen Kontinuität in den Begriff der translatio imperii. Institutionell bildete das Kaisertum eine Klammer zwischen dem ostfränkisch-deutschen und dem italienischen Königtum, wurde aber nicht im Erbgang weitergegeben, sondern durch die Kaiserkrönung in St. Peter. Diese war konstitutiv für den Erwerb des Titels imperator augustus. Folglich kam es immer wieder zu Unterbrechungen in der Kaiserabfolge. In den 531 Jahren zwischen 962 und 1493 amtierte nur in ca. der Hälfte der Zeit ein Kaiser.
Wirkung nach außen. Dem mittelalterlichen Kaisertum wurden keine Eingriffsrechte in das Territorium anderer Länder zugestanden. Das Konzept des Kaisertums als universaler Weltherrschaft ist vielmehr eine sekundäre Erscheinung und wurde durch die Rezeption des römischen Rechts im 12. Jahrhundert ins Zentrum gerückt. Unter Otto I. implizierte das Konzept des Kaisertums keine Beeinträchtigung der anerkannten Gleichrangigkeit der Königreiche. Die Kaiserkrönung änderte daran grundsätzlich nichts, auch wenn sich Otto auf dem Kölner Treffen von 970 mit dem westfränkischen König Lothar als „Familienpatriarch“ (O. Engels) in Szene setzte. Die Mutter Lothars war eine Schwester Ottos I. und so ist seine Einmischung in westfränkische Belange eher aus der Pflicht des Seniors der Dynastie als aus einer hegemonialen Stellung des Kaisers zu verstehen. In der Folgezeit trafen sich die französischen und deutschen Könige in der Regel an der Grenze und erkannten die wechselseitige Souveränität an. Erst viel später und unter dem Einfluß der Wissenschaft vom römischen Recht wagte es Heinrich VII. Anfang des 14. Jahrhunderts, in einem Brief an den französischen König eine Überordnung des Kaisers geltend zu machen.
In einer anderen Hinsicht hatte die Kaiserkrönung von 962 durchaus eine gesamteuropäische Dimension. Otto I. bestätigte im Pactum Ottonianum die Gebietsansprüche des Papstes in Mittelitalien, die sich zum Teil auf Territorien bezogen, die vom byzantinischen Kaiser beansprucht oder beherrscht wurden. Im Kern ging es um das Exarchat von Ravenna sowie um die langobardischen Fürstentümer Capua und Benevent. Dieser Gegensatz zwischen den beiden höchsten weltlichen Würdenträgern wurde erst zehn Jahre später aus dem Weg geräumt, als der Kaisersohn im Jahr 972 mit Theophanu, der Nichte des byzantinischen Herrschers, vermählt wurde. Die Verbindung mit dem Papsttum hatte nicht nur territoriale Konflikte zur Folge; Otto I. nahm für sich auch ein Aufsichtsrecht über den Apostolischen Stuhl in Anspruch und wollte die Päpste auf einen Treueid verpflichten. So fühlte er sich berechtigt, in den Jahren 963 und 965 zweimal Päpste des Amtes zu entheben, da sie sich seiner Politik widersetzt hatten. Der Kaiser ließ selbst Päpste ernennen, die allerdings in Rom einen schweren Stand hatten und ohne die militärische Rückendeckung von seiten des Kaisers den gegnerischen Kräften hoffnungslos unterlegen gewesen wären. Einem Hilferuf des von ihm eingesetzten Papstes Johannes XIII. folgend, zog Otto I. im Jahr 965 erneut nach Italien. Bis zum Jahr 972 blieb er dort, um die Stellung seines Papstes und die Verhältnisse in Mittel- und Norditalien zu regeln.
Der Eingriff des Kaisers in die Papstwahl war im Vergleich zur Karolingerzeit eine Neuerung. Otto III. setzte diese Politik fort, als er im Jahr 996 zur Kaiserkrönung nach Rom zog. Nachdem Papst Johannes XV. gestorben war, bot eine römische Gesandtschaft dem in Pavia angekommenen König die Nominierung eines Nachfolgers an. Otto III. wählte mit Bischof Bruno von Augsburg einen entfernten Verwandten, der ihn als Gregor V. am 21. Mai 996 zum Kaiser krönte. Auch Otto III. mußte die Erfahrung machen, daß sich der von ihm ernannte Papst bei seiner Abwesenheit nicht gegen die stadtrömischen Adelsfamilien durchsetzen konnte. Er ließ daher eine kaiserliche Residenz in Rom errichten und signalisierte damit seine dauernde Präsenz. Der nächste Papst, Silvester II., wurde ebenfalls von Otto III. ernannt. Die Zusammenarbeit zwischen Papst und Kaiser erreichte in den kurzen Jahren ihrer gemeinsamen Herrschaft (999–1002) einen Höhepunkt. Auf den Metallsiegeln seiner Urkunden formulierte Otto das Programm der Renovatio imperii Romanorum, ein Leitspruch, der der Forschung bis zuletzt Anlaß zu unterschiedlichen Deutungen gab.
Eine direkte Einmischung in die Papstwahl wie unter Otto III. blieb weiterhin die Ausnahme. In der Regel trat man in Rom nur dann an den deutschen König heran, wenn eine zwiespältige Wahl erfolgt war. So wandten sich im Jahr 1012 die beiden Kontrahenten Benedikt VIII. und Gregor (VI.) an Heinrich II., der sich für den Tuskulaner-Papst Benedikt entschied und von diesem die Kaiserkrone erhielt (14. Februar 1014). Im Schisma zwischen Anaklet II. und Innozenz II. entschied sich Lothar III. nach anfänglichem Zögern für letzteren und erlangte am 4. Juni 1133 die Kaiserkrone. Vergeblich war das Bemühen Friedrichs I. zur Beendigung des Schismas zwischen Alexander III. und Viktor IV. Für das Jahr 1160 berief er eine Synode nach Pavia, zu der allerdings nur die Anhänger Viktors IV. erschienen, da das Ergebnis der synodalen Beratungen im voraus feststand. Der Versuch der Einigung durch Friedrich I. scheiterte und im Jahr 1176 mußte der Kaiser nach langen Jahren der erbittert geführten Auseinandersetzungen die Legitimität Alexanders III. anerkennen. In der Zeit des Großen Abendländischen Schismas [↗ Abendländisches Schisma] übernahm König Sigismund die Führung des Konstanzer Konzils (1414–1418) als defensor et advocatus ecclesiae. Bis zur Wahl Martins V. (1417) prägte er die Verhandlungen des Konzils sowohl in kirchenpolitischer als auch in diplomatischer Hinsicht. Die Papstwahl erfolgte jedoch ohne sein Mitwirken durch die Kardinäle und durch die Vertreter der in Konstanz anwesenden Nationen.
Der Kaiser konnte also seinen Einfluß nur bei einer zwiespältigen Papstwahl oder einem bestehenden Schisma geltend machen. Zu einer fast ebenso engen Zusammenarbeit wie unter Otto III. kam es durch das Schisma von 1046. In diesem Jahr war König Heinrich III. auf seinem Romzug mit der Situation konfrontiert, daß infolge von Konflikten innerhalb des stadtrömischen Adels drei Päpste um das Amt konkurrierten. Diese Situation mußte Heinrich untragbar erscheinen, da er für die Kaiserkrönung einen unumstrittenen und über jeden Zweifel erhabenen Inhaber des Apostolischen Stuhls benötigte. Er ließ daher alle drei Päpste auf Synoden in Sutri und Rom absetzen und machte Bischof Suidger von Bamberg zum Papst. Dieser krönte ihn am 26. Dezember 1046 zum Kaiser. Auch in den nächsten Jahren übte der deutsche Königshof einen bestimmenden Einfluß auf die Papstwahl aus. Mit dem Papstwahldekret von 1059 versuchte das Reformpapsttum das Mitspracherecht des deutschen Königs zurückzudrängen. Das Recht zur Wahl des Papstes fiel allmählich in die ausschließliche Kompetenz der Kardinäle [↗ Papsttum und Kurie]. Selbst den Gegenpapst Clemens (III.) ließ Heinrich IV. im Jahr 1084 durch 13 Kardinäle in einem förmlichen Procedere wählen, obwohl er ihn schon im Jahr 1080 durch eine Synode designiert und zum Konkurrenten Gregors VII. erhoben hatte.
In seiner Stellung als Schirmherr über den Apostolischen Stuhl hatte der Kaiser also durchaus eine mehr oder weniger klar umrissene Kompetenz, die sich während des Hoch- und Spätmittelalters in unterschiedlicher Form konkretisierte. Ephemer blieb dagegen das Recht der Königserhebung, das der Kaiser nur in bezug auf das zum Reich zählende Böhmen mehrmals praktizierte (1085, 1158, 1198). Die Erhebung des polnischen Königs in Gnesen (1000) ist unter Historikern umstritten; die Erhebung von Königen in Zypern und Kleinarmenien durch Heinrich VI. (1195) blieb ein Einzelfall.
In der politischen Theorie der Zeit wurde dem Kaisertum eine viel weitergehende Wirkung nach außen zugeschrieben. Vor allem nach der Rezeption des römischen Rechts bezeichnete man den Kaiser gerne als dominus mundi, als Weltherrscher. In der staufischen Panegyrik nutzte man nicht selten das propagandistische Potential dieser Formel. In der wissenschaftlichen Diskussion hatte der Begriff des dominus mundi eine unterschiedliche Reichweite. Die Juristen an den Universitäten benutzten die Idee der kaiserlichen Weltherrschaft als Konstruktionsprinzip der Wissenschaft vom römischen Recht, um dessen Geltung ideell aufrechtzuerhalten. Die juristische Diskussion um die Stellung des Kaisers berührte jedoch weniger die Realität des römisch-deutschen Reichs als die theoretische Frage nach der Lokalisierung staatlicher Gewalt. Insbesondere das Problem des Verhältnisses von Herrscher (princeps) und Recht wurde kontrovers diskutiert. Man konnte sich daher durchaus mit der (unzureichend erscheinenden) Auskunft begnügen, die anhand des römischen Rechts konstruierte Weltordnung habe nur de iure Geltung, während sich die Königreiche de facto als souveräne Staaten definierten. Seitdem Papst Innozenz III. dem französischen König (1202) bescheinigt hatte, daß er kein Oberhaupt anerkenne, war seine faktische Souveränität im kirchlichen Recht hinreichend verankert. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts bezeichneten die Juristen den französischen König als „Kaiser in seinem Reich“ (imperator in regno suo).
Erst nach der längsten kaiserlosen Zeit des Mittelalters (von 1250 bis 1312) wurden diese abstrakten Debatten in politische Ansprüche umgemünzt. Als Heinrich VII. nach über 60 Jahren das Kaisertum zu neuem Leben erweckte, bemühten sich seine gelehrten Anhänger um eine theoretische Klärung der Kaiseridee. Diese Klärung mußte auf der Grundlage der im 13. Jahrhundert neu entstandenen politischen Wissenschaft geleistet werden. Der berühmte italienische Dichter Dante Alighieri († 1321), der Heinrich VII. als Retter Italiens begrüßte, rechtfertigte als erster in seinem Werk Convivio das Kaisertum im Rahmen der aristotelischen Sozialphilosophie. Später, vermutlich nach dem Tod des Kaisers, verfaßte er ein eigenständiges Werk zu diesem Thema, die Monarchia. Das Kaisertum erschien ihm darin notwendig zur vollen Erlangung der menschlichen Glückseligkeit, weil nur unter dieser Voraussetzung alle menschlichen Konflikte durch einen obersten Richter bereinigt werden könnten. Noch zu Lebzeiten Heinrichs VII. verfertigte der steirische Abt Engelbert von Admont († 1331) eine Rechtfertigungsschrift der Italienpolitik des Luxemburgers. Anders als Dante berücksichtigte er stärker die christlichen Wurzeln des mittelalterlichen Kaisertums. Die universalen Kompetenzen des Kaisers leitete er gleichermaßen aus der Schirmherrschaft über die Christenheit und den Papst wie aus abstrakten philosophischen Überlegungen ab. Heinrich VII. bekannte sich zu diesen Ideen, als er gegen König Robert von Neapel einen Prozeß einleitete und in einem Brief an König Philipp IV. von Frankreich eine übergeordnete Stellung für sich reklamierte. Auch in der Folgezeit hielt die politische Theorie in Deutschland an der universalen Kompetenz des Kaisers fest. Wichtige Beiträge zur Debatte lieferten im 14. Jahrhundert Lupold von Bebenburg († 1363) und Konrad von Megenberg († 1374) sowie im 15. Jahrhundert Peter von Andlau († 1480). Dieses Beharren auf dem Universalismus ist in der Forschung zumeist als rückwärtsgewandter und realitätsferner Traditionalismus gewertet worden. Erst in letzter Zeit hat sich die Einsicht durchgesetzt, daß das universale Kaisertum ein zentrales „einheitsstiftendes Moment der älteren deutschen Geschichte“ (P. Moraw) darstellte. Es schuf ein Identitätsbewußtsein und war kaum realitätsferner als die Strategien und Ideenkonstrukte, die der französische König zur Durchsetzung seiner monarchischen Gewalt zum Einsatz brachte.
Wirkung nach innen. Ist in der politischen Theorie des Spätmittelalters fast durchweg von einer Wirkung des Kaisertums nach außen die Rede, so richtete sich die tatsächliche Stoßrichtung der nach Rom ziehenden deutschen Könige oft nach innen. Bereits Otto I. erhoffte sich durch die Rangerhöhung und die dadurch mögliche Zusammenarbeit mit dem Papst die zügige Verwirklichung seines Plans, in Magdeburg ein Erzbistum mit drei neuen Suffraganbistümern in Meißen, Merseburg und Zeitz zu gründen. Darüber hinaus setzte er mit der Annahme der Kaiserwürde ein Zeichen für eine stärkere herrschaftliche Durchdringung Italiens. Im Vorfeld des Romzugs ließ er seinen Sohn (Otto II.) in Worms zum Mitkönig wählen. Dieser Akt diente zum einen der dynastischen Stabilisierung; zum anderen wurde dem Adel eine neue Bezugsperson gegeben, die bei der Abwesenheit des Königs in Italien für herrschaftliche Kontinuität sorgen sollte. Im Jahr 967 ließ Otto I. seinen gleichnamigen Sohn in Rom zum Kaiser krönen, um die anvisierte Heirat mit der byzantinischen Prinzessin Theophanu vorzubereiten. Die schon in der Karolingerzeit praktizierte Institution des Mitkaisertums blieb jedoch ein Einzelfall. Der Papst als Konsekrator wollte sich diesen Trumpf nicht aus der Hand nehmen lassen und hat seit 967 keine Mitkaiser mehr ernannt. Mitkönige wurden dagegen bis zum Ende des Mittelalters erhoben. Otto III. erhielt Krönung und Salbung im Todesjahr seines Vaters (983); Heinrich III. wurde schon vier Jahre nach der Königswahl seines Vaters zum Nachfolger gemacht (1028). In der Regel sah sich der Herrscher erst nach der Kaiserkrönung zu diesem Akt ermächtigt; eine Ausnahme ist die Erhebung Heinrichs (VI.) durch seinen Vater Konrad III. (1147). Im Spätmittelalter gelang es nur mehr besonders gefestigten Herrschern wie Karl IV. (1376) und Friedrich III. (1486), ihre Söhne zu Königen erheben zu lassen und so die unabhängige Entscheidung des Kurfürstenkollegs zu unterlaufen. Daß das Mitkönigtum jedoch kein kaiserliches Reservatrecht war, zeigt ein Blick auf Frankreich. Die ersten französischen Könige aus der Dynastie der Kapetinger bemühten sich nach dem Dynastiewechsel von 987 ebenfalls um eine Regelung der Nachfolge zu ihren Lebzeiten. Robert II. wurde bereits im Jahr 987 zum König gekrönt, Heinrich I. im Jahr 1027. Nachdem sich jedoch das Prinzip der Primogenitur durchgesetzt hatte, erübrigte sich diese Form der dynastischen Stabilisierung. Im römisch-deutschen Reich machte dagegen gerade die Formierung des Wahlprinzips die Sicherung der Nachfolge notwendig. Erst die Kaiserwürde schien die dazu erforderliche Autorität zu verleihen, um die Fürsten als Wähler im voraus auf einen Kandidaten zu verpflichten.
Das Kaisertum brachte noch in einer anderen Hinsicht einen Gewinn an Autorität. Als Kaiser stand man in der Tradition der spätantiken Kaisergesetzgebung und mußte ein neues Herrscherprofil erfüllen. Karl der Große hat den Großteil seiner Gesetze erst nach der Kaiserkrönung erlassen. Die ottonischen Kaiser kamen durch Italien mit dieser Tradition in Verbindung. Während im Reich nördlich der Alpen das mündliche Gewohnheitsrecht die Praxis bestimmte und nur innerhalb der Kirche schriftliche Normen eine Bedeutung hatten, gab es in Italien eine lebendige Tradition schriftlicher Gesetzgebung. In der alten langobardischen Hauptstadt Pavia befand sich eine bedeutende Rechtsschule, an der Richter auf der Grundlage des Schriftrechts unterrichtet wurden. Anfang des 11. Jahrhunderts wurde dort das Recht der Langobarden mit den Gesetzen der Karolinger zum sogenannten Liber legis Langobardorum (oder Liber Papiensis) verbunden. In dieser Sammlung sind auch die Gesetze der römisch-deutschen Kaiser des 10. und 11. Jahrhunderts überliefert. Otto I. erließ im Jahr 967 in Verona ein umfangreiches Gesetz zur gerichtlichen Praxis des Zweikampfes. Otto III. trat auch erst nach seiner Kaiserkrönung (996) als Gesetzgeber in Erscheinung, indem er zum Status von Sklaven und zum Kirchengut neue Regelungen erließ. Heinrich II. übertrug diese kaiserliche Kompetenz erstmals auf das Reich nördlich der Alpen. Im Jahr 1019 urteilte er auf einer Synode in Goslar über die umstrittene Frage, welchen Status Kinder aus einer Ehe zwischen einem unfreien Priester und einer freien Frau haben sollten. Wenige Jahre später bestätigte er dieses Gesetz gemeinsam mit dem Papst in einem Edictum Augusti. Rein weltlicher Natur war das in Straßburg erlassene Gesetz zum Eherecht, Verwandtenmord und zum Landfrieden (1019). Nördlich der Alpen blieb dieses Anknüpfen an die Gesetzgebungstätigkeit der karolingischen Herrscher jedoch die Ausnahme. In Italien änderte sich der Bezugsrahmen im Lauf der Rezeption des römischen Rechts. Nach der Wiederentdeckung der Digesten aus dem Gesetzeswerk Justinians bildete nicht mehr das langobardisch-karolingische, sondern das römische Recht die Grundlage der juristischen Ausbildung in den Schulen Norditaliens. Die Doktoren der bedeutendsten Rechtsschule in Bologna setzten sich im Jahr 1155 mit Friedrich Barbarossa in Verbindung, der seiner Kaiserkrönung in Rom (18. Juni 1155) entgegenzog. Sie erbaten sich vom zukünftigen Kaiser ein Privileg, das unter anderem die Scholaren von der städtischen Gerichtsbarkeit befreien sollte. Friedrich I. kam dieser Bitte nach und erließ ein Gesetz, das er unter die antiken Kaisergesetze des Codex Iustinianus einzuordnen befahl. Dieses Scholarenprivileg wurde wie ein weiteres Gesetz Barbarossas und wie elf Gesetze seines Enkels Friedrich II. als Authentica in die mittelalterlichen Handschriften des Codex Iustinianus eingefügt. Seit Barbarossa beeinflußte das Bewußtsein der Nachfolge der römischen Gesetzgebung maßgeblich das Selbstverständnis der römisch-deutschen Kaiser. Der Anspruch, wie der römische Princeps über den Gesetzen zu stehen (princeps legibus solutus), war ein geläufiges Argument politischer Auseinandersetzungen, stieß jedoch überwiegend auf Ablehnung und auf die Forderung nach einer konsensualen Entscheidungsfindung. Ohne den gleichen Erfolg zu haben wie Friedrich Barbarossa, erließen Heinrich VII. und Ludwig IV. („der Bayer“) Kaisergesetze mit dem Anspruch universaler Rechtsgeltung. Karl IV. nahm unmittelbar nach seiner Kaiserkrönung (5. April 1355) das Projekt in Angriff, ein grundlegendes Gesetzbuch zur Königswahl und zur Kurfürstenwürde zu erlassen. Am Hoftag in Nürnberg (10. Januar 1356) verkündete er offiziell das Gesetzbuch, das im 15. Jahrhundert als erstes Reichsgesetz („Goldene Bulle“) allgemeine Anerkennung finden sollte.
Emanzipation. Seit dem Jahr 875 hat das Papsttum über die Vergabe des Kaisertums entschieden. Eine Ableitung der kaiserlichen Gewalt aus der Machtfülle des Papsttums folgerte erstmals Gregor VII. in seinem Dictatus papae [↗ Papsttum]. Im 12. Jahrhundert entzündete sich die Debatte um die Stellung des Kaisertums am Strator- und Marschalldienst, das heißt an der Forderung des Papstes, daß der Kaiser bei der Zusammenkunft mit dem Papst das Pferd am Zügel führen und dem Papst beim Absteigen den Steigbügel halten soll. Den Stratordienst hat nach der Konstantinischen Schenkung (ca. 800) bereits Kaiser Konstantin beim Zusammentreffen mit Papst Silvester geleistet. In der Realität wurde dieser Ehrendienst dem Papst vermutlich 754 durch Pippin I. oder spätestens beim Treffen zwischen Ludwig II. und Nikolaus II. im Jahr 858 erwiesen. Der Marschalldienst ist dagegen erstmals 1131 nachweisbar, als Lothar III. den Papst in Lüttich ehrenvoll empfing. Der König ging dem Papst entgegen, führte sein Pferd am Zügel, hielt die herandrängenden Menschen mit einer Rute fern und half ihm schließlich durch das Festhalten des Steigbügels vom Pferd. Als über zwanzig Jahre später Papst Hadrian IV. dieselben Dienste von Friedrich I. forderte, kam es zum Eklat. Friedrich wurde durch diese rituellen Handlungen der Eindruck einer lehensrechtlichen Unterordnung suggeriert, den er auf alle Fälle vermeiden wollte. Nach Vorlage eines Dokuments und nach bestätigenden Zeugenaussagen erklärte sich Friedrich schließlich doch dazu bereit. Die Wahrung des honor imperii wird auch wenig später sichtbar, als er nach seiner Ankunft in Rom darauf bestand, Fresken in einer Kapelle der Lateranskirche entfernen zu lassen, die eine lehensrechtliche Unterordnung Lothars III. bildlich festhielten. Am Hoftag von Besançon (1157) wies er aus denselben Gründen gegenüber dem päpstlichen Legaten empört die Bezeichnung des Reichs als beneficium/Lehen ab. Der deutsche Königshof hielt wie schon zur Zeit des Investiturstreits an der Formel der gottunmittelbaren Stellung des Herrschers fest. In der Kanzlei Friedrichs I. kam diese Anschauung durch die Begriffsbildung sacrum imperium (seit 1157) zum Ausdruck.
Im 13. und 14. Jahrhundert verlagerte sich die Debatte auf die rechtliche Bedeutung der Königswahl. Auslöser dafür war der Thronstreit zwischen Philipp von Schwaben und Otto IV. (1198–1212). Papst Innozenz III. gelang es geschickt, die Differenzen innerhalb der Reichsfürsten für seine eigenen Zwecke auszunützen, da beide Parteien auf eine Unterstützung durch den Papst angewiesen waren. In seiner berühmten Dekretale Venerabilem (1202) beanspruchte er ein Mitspracherecht des Apostolischen Stuhls bei der Königswahl. Dieses folgerte er aus der sogenannten Translatio imperii, das heißt aus der Übertragung des Römischen Reichs von den Griechen auf die Deutschen durch Papst Leo III. im Jahr 800. Für Innozenz spiegelte sich in dieser translatio imperii die übergeordnete Stellung des Papsttums, die ihn dazu berechtige, bei einer zwiespältigen Wahl über die Approbation des Königs zu entscheiden. Papst Bonifaz VIII. steigerte diese Anschauung, indem er den erwählten König als rex Alemanniae bezeichnete, der nur über Deutschland, nicht aber über Burgund und Italien Herrschaftsrechte ausüben dürfe. Johannes XXII. sah das Reich nach der Doppelwahl von 1314 überhaupt als vakant an und nahm die Stellvertretung (das Vikariat) für sich in Anspruch. Diese Anschauungen trafen bei Herrschern, die auf die Unterstützung des Papstes angewiesen waren, auf Akzeptanz (Albrecht I. 1303). Überwiegend wies man die päpstliche Approbationstheorie jedoch zurück. Der Fürstenspruch von Braunschweig (1252) setzte Königtum und Kaisertum gleich und ließ beides durch die einstimmige Wahl der Fürsten beginnen. Nach der Meinung der Reichsfürsten fügte die Kaiserkrönung durch den Papst den bestehenden Herrschaftsrechten nur einen Titel hinzu. Ähnliche Stellungnahmen sind aus der Regierungszeit Heinrichs VII. überliefert. Die Kurfürsten haben diese Diskussion in einer rechtlich bindenden Entscheidung zusammengefaßt. Im Weistum von Rhense (1338) stellten sie fest, daß der mehrheitlich durch die Kurfürsten gewählte König alle Herrschaftsrechte sowie den Königstitel des rex Romanorum in Besitz nehmen könne. Über das Kaisertum äußerten sie sich nicht. Die theoretische Begründung dieser Formel lieferte zeitgleich der Jurist Lupold von Bebenburg in seinem „Traktat über die Rechte von Kaiser und Reich“. Lupolds Leistung besteht darin, auf das römisch-deutsche Reich diejenigen Souveränitätsformeln anzuwenden, die im Lauf des 13. Jahrhunderts für die westlichen Königreiche geschaffen worden waren. Den Standpunkt des Kurvereins von Rhense machte sich Karl IV. in seiner „Goldenen Bulle“ zu eigen, in der er die Ansprüche des Papsttums auf Approbation mit souveränem Schweigen überging und die Entscheidung über das Königtum den Kurfürsten übertrug. Die letzte Kaiserkrönung durch einen Papst fand 1530 statt (Karl V.). Bereits Maximilian I. nahm im Jahr 1508 den Titel eines „Erwählten Römischen Kaisers“ an, als er an seinem Romzug gehindert wurde. Diese Praxis setzte sich in der Frühen Neuzeit durch und bedeutete die Abkehr vom päpstlich vermittelten Kaisertum.
KARL UBL