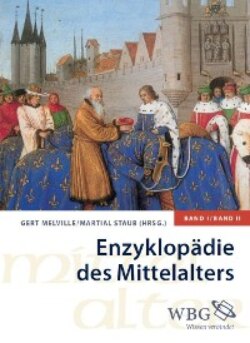Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fürstentum
ОглавлениеDas Fürstentum als eine königsgleiche, quasi autonome Herrschaft entstand im Frühmittelalter auf verschiedenen Wegen. An der Peripherie der großen Reichsbildungen der Völkerwanderungszeit bildeten sich unabhängige, aber tributpflichtige Fürstentümer. Für das Frankenreich der Merowingerzeit sind die Bretagne, Sachsen und die slawischen Fürstentümer im Osten zu nennen. Während der Schwächephase des fränkischen Großreichs tendierten die Randgebiete des Frankenreichs ebenfalls zur Verselbständigung. Ende des 7. Jahrhunderts beschränkte sich der Einfluß der Könige und der sie repräsentierenden Hausmeier auf Austrasien, Neustrien und Burgund, während sich in den Randgebieten vizekönigliche Herrschaften etablierten (Bayern, Alemannien, Elsaß, Aquitanien, Provence, Churrätien, Friesland). Im 8. Jahrhundert gelang es den Karolingern, die Fürstentümer weitgehend aus ihrer Machtstellung zu verdrängen. Karl der Große setzte seine eigenen Söhne als Unterkönige in Aquitanien und Italien ein und schuf Markgrafschaften in den Randgebieten, um die Grenzsicherung durch größere Herrschaftseinheiten zu gewährleisten. Dieses Modell scheiterte im Verlauf der Schwächung karolingischer Herrschaft. Seit der Mitte des 9. Jahrhunderts entstanden erneut Fürstentümer, zuerst im Westen (Flandern, Septimanien, Katalonien), dann im Osten (Bayern, Schwaben, Sachsen). Ihre Legitimation bezogen diese Herzöge, Markgrafen und Grafen aus ihrer vom König erworbenen Amtsstellung in Kombination mit autonom erworbenen Herrschaftsrechten. Diese jüngeren Fürstentümer hatten zumeist keine institutionelle Stabilität und wurden oft durch politische Wechselfälle in ihren Grenzen verändert. Ein weiterer Weg führte im Zuge des Feudalisierungsprozesses des Hochmittelalters zur Entstehung von autonomen Fürstentümern. Frankreich wurde von diesem Prozeß am stärksten erfaßt, so daß selbst Burgherren (Kastellane) eine unabhängige Banngewalt ausübten.
Seit dem 12. Jahrhundert strebte der Hochadel danach, seine Stellung als vermittelnde Instanz zwischen Königtum und Untertanen festzuschreiben [↗ Adel]. In Deutschland begegnen erstmals unter Lothar III. die principes als eigener Stand. Während der Stauferzeit schloß sich dieser Stand weitgehend nach unten ab. Für die Zeit um 1190 rechnet man mit 92 geistlichen und 22 weltlichen Reichsfürsten. Sie hatten ihre Lehen direkt vom König erhalten und nahmen für sich den Gerichtsstand vor dem König in Anspruch. Im Spätmittelalter erweiterte sich dieser Kreis der Reichsfürsten zunehmend durch königliche Verleihungen, obwohl sich ihr Vorrang allein im Zeremoniell niederschlug. Der französische König ließ dagegen nur 12 Fürsten als seine unmittelbaren Lehensmänner gelten. Dieser Kreis der „Pairs de France“ bestand zur Hälfte aus geistlichen, zur Hälfte aus weltlichen Würdenträgern. Da der Gerichtshof für die „Pairs de France“ schon bald von königlichen Amtsträgern beherrscht wurde, übte diese Institution wenig Einfluß auf die politische Verfassungsgeschichte Frankreichs aus. In England konstituierten sich die „Peers of the Realm“ erst an der Wende zum 14. Jahrhundert. Sie konnten jedoch dauerhaft Einfluß auf das politische Geschehen erlangen und schufen eine eigene Institution, das „House of Lords“.
Das Fürstentum des Mittelalters stand immer im Schatten der Monarchie. Selbst die Herzöge von Burgund, die im 15. Jahrhundert ein mächtiges Fürstentum zwischen Alpen und Nordsee errichteten, strebten nach der Legitimierung durch eine Krone. Philipp der Gute und Karl der Kühne verhandelten mehrfach mit Kaiser Friedrich III. über die Verleihung der Königsherrschaft. Um ihren heterogenen Herrschaften eine politische Einheit zu verpassen, versuchten sie, an das frühmittelalterliche Königreich der Burgunder und an das Reich Lothars II. anzuknüpfen. Diese Bemühungen führten nicht zum Erfolg und das burgundische Experiment scheiterte nach dem Tod Karls des Kühnen († 1477).
Anders waren die Verhältnisse in Italien. Dort etablierten sich im Spätmittelalter Fürstentümer, die nicht nach Legitimierung durch die Verleihung der Königswürde Ausschau hielten. Mit der Ausnahme von Florenz und Venedig ging der Aufbau von Fürstentümern Hand in Hand mit einer politischen Verfassungsänderung. Die kommunale Selbstregierung wurde abgelöst durch die signoria, die Herrschaft einer Dynastie. Das kommunale Stadtregiment war nicht in der Lage, die Konflikte zwischen den verschiedenen Parteiungen innerhalb einer Stadt sowie zwischen den divergierenden Interessen von Adel, Kaufleuten und Handwerkern im Zaum zu halten. Darüber hinaus wurde die Kriegführung wichtiger, als seit dem 13. Jahrhundert die Städte ihre Herrschaft auf das Umland (contado) erweiterten und mit den Nachbarstädten in Konflikt gerieten. In der Zeit der Konsolidierung von Fürstentümern galt es, Söldner anzuwerben und durch entschlossenes militärisches Handeln Stärke zu demonstrieren. Auf diese Weise ergab sich eine Symbiose von städtischen und dynastischen Interessen, die zur Entstehung von signorie führte. Die erste Dynastie festigte sich in Ferrara (Este, 1240), es folgten Verona (Della Scala, 1263), Mantua (Bonaccolsi, 1272), Mailand (Visconti, 1277) und Padua (Carrara, 1318). In Florenz erlangten die Medici erst im späten 15. Jahrhundert die signoria. Die Autonomie der Dynasten war im Mittelalter jedoch formal noch nicht vollzogen. Meist suchten sie noch um eine förmliche Legitimierung ihrer Stellung durch Kaiser oder Papst nach.
Sowohl in Deutschland als auch in Italien vollzog sich die Staatswerdung auf der Ebene von Fürstentümern. In diesen beiden Regionen wandte sich folglich die politische Theorie nachdrücklich diesem Herrschaftstyp zu. Waren die Fürstenspiegel traditionell nicht an die Fürsten, sondern an die Könige adressiert, so widmete der steirische Gelehrte Engelbert von Admont sein ethisch-politisches Werk direkt den habsburgischen Herzögen von Österreich. Die Verfassungslehre des Aristoteles wendete er auf Städte und Fürstentümer an; die moralischen Verhaltensregeln der Fürsten trennte er von denen des Königs. Ebenfalls im 14. Jahrhundert schrieb der Patrizier und Jurist Philipp von Leyden († 1382) seine Schrift De cura rei publicae et sorte principantis, gewidmet Graf Wilhelm V. von Holland. Bekannt ist seine Aussage, daß selbst ein Herzog, Graf oder Baron princeps in seinem Territorium genannt werden und er die Gesetze des römischen Rechts auf sich beziehen könne. Dementsprechend begriff Philipp den Grafen von Holland – trotz seiner lehensrechtlichen Abhängigkeit vom römisch-deutschen König – als quasi-souveränen Herrscher mit göttlicher Legitimation. Seine Bindung an das Recht und an die Gewohnheiten sollte nach Philipp nur so weit reichen wie für jeden anderen autonomen Herrscher. Die Fürstentümer wurden also sowohl in der Sozialphilosophie als auch in der Jurisprudenz schrittweise den Königreichen angeglichen.
In Italien vollzog sich die Reflexion über die Etablierung der signoria ebenfalls im Rahmen von Fürstenspiegeln. Paradigmatisch ist hier der Brief Francesco Petrarcas an den Herrscher von Padua, Francesco da Carrara, zu nennen (1373). Petrarca porträtierte den signore wie einen König, der ein väterliches Regiment über seinen Untertanenverband ausübt. Der Staat erscheint als vergrößerter Familienverband. Vom Fürsten erwartete Petrarca eine geschickte Darstellung der Königswürde, insbesondere in der Ausübung wahrhaft königlicher Freigebigkeit. Petrarcas Idealisierung der Fürstenherrschaft wurde im 15. Jahrhundert, nachdem die republikanischen Ideen auch in Florenz aufgegeben worden waren, auf die Spitze getrieben. Selbst der republikanisch gesinnte Niccolò Machiavelli konnte sich dieser Zeitströmung nicht entziehen und verfaßte mit Il principe (1517) einen Fürstenspiegel. Im Zentrum dieses Werkes stand jedoch nicht mehr die überhöhte moralische Qualifikation des Fürsten, sondern in Zuspitzung der Gedanken Petrarcas die scheinhafte Vorspiegelung sittlichen Handelns zum Zweck der Staatsräson.
KARL UBL