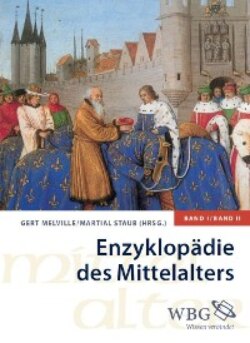Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 20
ОглавлениеIm Reich kreiste die Diskussion von transpersonalen Hoheitsrechten um den Begriff der regalia [↗ Regalien]. Im Investiturstreit war es nötig geworden, die unmittelbar geistlichen Amtsbefugnisse der Bischöfe und Äbte von den kirchlichen Rechten und Gütern zu trennen, die aus Schenkungen weltlicher Gewalten hervorgegangen waren. Ivo von Chartres führte dafür die Unterscheidung zwischen temporalia und spiritualia ein. In Deutschland bezeichnete man seit der Zeit um 1100 die weltlichen Güter der Bischöfe als Regalien. Erweitert wurde diese Definition durch die Rezeption des römischen Rechts im 12. Jahrhundert. Im Gesetz von Roncaglia (1158) subsumierte Friedrich I. alle öffentlichen Hoheitsrechte unter dem Begriff der Regalien (Zölle, Münze, Strafgefälle, Straßen und Flüsse etc.). Der Herrscher nahm für sich in Anspruch, diese Regalien in der Form des Lehensrechts zu vergeben, und beharrte damit auf der prinzipiellen Unveräußerlichkeit dieser Rechte. Die „Goldene Bulle“ von 1356 zog die Konsequenz aus der sich konträr dazu entwickelnden Praxis und übertrug diese Rechte den Kurfürsten.
Zur Festschreibung der transpersonalen Qualität des Königtums hat nach Kantorowicz das hochentwickelte Kirchenrecht des 13. Jahrhunderts zentrale Begriffe beigesteuert. Dem Kirchenrecht ging es in erster Linie um eine Theorie der Kirche als Korporation. Die Kirche als Gemeinschaft aller Gläubigen wurde als mystischer Leib Christi (corpus Christi mysticum) dem wahren Leib Christi (der Eucharistie) zur Seite gestellt. Sie wurde (wie andere genossenschaftliche Vereinigungen) als persona repraesentata konzipiert, die als Rechtsfiktion unabhängig von den einzelnen Mitgliedern eine juristische Existenz besitzt. Einer solchen Korporation konnten Rechte zugeschrieben werden und sie konnte Delikte begehen und vor Gericht verklagt werden. Nach diesem Vorbild beanspruchte auch der spätmittelalterliche Staat Kontinuität und Unsterblichkeit. Die Metapher des Körpers wurde im weltlichen Bereich auf den Körper des Königs selbst übertragen. Man unterschied zwischen dem irdisch-vergänglichen Leib und dem unsterblichen Leib, der den Staat repräsentierte. Bildlicher Ausdruck wurde dieser Idee in den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Königsgräbern gegeben. Sie unterschieden auf der unteren Ebene das Abbild des vergänglichen Leichnams von der auf der oberen Ebene dargestellten ewigen Würde des Königtums, die durch eine Skulptur des lebenden Königs dargestellt wurde.
Absetzung. Die Interpretation der mittelalterlichen Herrscherabsetzungen stand seit F. Kern unter dem Leitgedanken eines germanischen Widerstandsrechts. An dieser Leitidee kann die Rückführung auf einen germanischen Ursprung nicht mehr überzeugen. Der Begriff des „Rechts“ suggeriert zudem eine Einklagbarkeit vor Gericht sowie die Existenz einer stabilen Reichsverfassung. Beides war im frühen und hohen Mittelalter nicht gegeben. Herrscherabsetzungen fanden entweder in der Form einer formlosen Verlassung des Adels statt oder der König wurde mit Waffengewalt vom Thron vertrieben, getötet oder zum Mönch gemacht. Beispielhaft seien die Ereignisse von 613 erwähnt, als der austrasische Adel sich von Brunichilde und ihrem Urenkel Sigibert II. abwandte und den neustrischen König Chlothar II. anerkannte. Der letzte merowingische König, Childerich III., wurde geschoren und ins Kloster gesteckt. Auch bei der Absetzung Ludwigs des Frommen im Jahr 833 verließ zuerst das Heer bei Colmar das kaiserliche Lager und unterwarf sich der Herrschaft der Söhne. Noch im selben Jahr griff man auf das Ritual der kanonischen Kirchenbuße zurück, um dem Kaiser seine Herrschaftsrechte abzusprechen. Vor dem Hintergrund der patrimonialen Königsherrschaft war ein weltliches Absetzungsverfahren undenkbar.
Eine Wende in der Praxis der Herrscherabsetzung brachte erst der Investiturstreit [↗ Investiturstreit]. Gregor VII. behauptete in seinem Dictatus papae (1075), er könne den Kaiser absetzen. Ein Jahr später nahm er diese Kompetenz jedoch nicht direkt in Anspruch, sondern exkommunizierte seinen Gegner Heinrich IV., untersagte ihm die Ausübung der Herrschaft und sprach seine Untertanen vom Treueid los. Eine förmliche Absetzung hielten die Fürsten ebenfalls nicht für nötig, als sie am 15. März 1077 Rudolf von Rheinfelden zum neuen König wählten. Sie beriefen sich, genauso wie die sächsischen Aufständischen der Jahre zuvor, auf das adelige Selbstverständnis, daß Gehorsam nur dem wahren König entgegengebracht werden müsse. Einem falschen König sollte man dagegen den Gehorsam entziehen. Dies war gleichermaßen ein Recht wie eine Pflicht. Erst im nachhinein versuchte Gregor VII. seine Handlungen des Jahres 1076 als förmliche Absetzung zu deuten. Im Jahr 1080, als er Heinrich erneut exkommunizierte und sich offen für die Unterstützung Rudolfs von Rheinfelden starkmachte, sprach er erstmals von einer 1076 erfolgten depositio des Königs. In Deutschland ist diese Rechtsanschauung selbst bei Gregorianern nicht vollends durchgedrungen. Manegold von Lautenbach sprach dem „Volk“ das Recht zu, einen König abzusetzen, falls dieser sich nicht als wahrer König erweisen sollte. Mit dem Begriff „Absetzung“ verband Manegold jedoch nicht ein rechtliches Verfahren vor einer übergeordneten Instanz, sondern den formlosen Widerstand des Adels, der bei der Königserhebung nur ein bedingtes Gehorsamsversprechen abgegeben habe.
Das päpstliche Depositionsrecht kam während des Pontifikats Innozenz’ IV. zur vollen Entfaltung. Im Jahr 1245 setzte der Papst Kaiser Friedrich II. in einem rechtlichen Verfahren auf dem Konzil von Lyon ab. Innozenz verstand sich als oberster Richter und das Kaisertum als untergeordnetes Amt. In seiner Absetzungsbulle ergriff er die Gelegenheit, detailreich die verschiedenen Vergehen Friedrichs II. aufzulisten: Meineid, Friedensbruch, Sakrileg und Häresie. Im Kirchenrecht der Zeit war dieses Vorgehen hinreichend abgesichert; in der Welt der Laien stieß die Absetzung auf unterschiedliche Reaktionen, mitunter auf große Vorbehalte. Dennoch diente die Argumentation Innozenz’ IV. bei den Königsabsetzungen des Spätmittelalters häufig als Vorbild. Albrecht I. und der Erzbischof von Mainz griffen auf sie zurück, als sie im Jahr 1298 die Absetzung Adolfs von Nassau aussprachen. Dieser Rückgriff auf das Kirchenrecht zeigt vor allem an, daß das Handeln der Fürsten keine selbständige rechtliche Grundlage hatte. Die Kurfürsten hatten sich zwar im 13. Jahrhundert als exklusive Wähler des Königs durchgesetzt; sie agierten jedoch noch nicht als Kolleg und leiteten auch nicht aus der Kompetenz zur Wahl eine Kompetenz zur Absetzung ab. Dies hätte eine prinzipielle Überordnung der Kurfürsten bedeutet, die nicht konsensfähig war. Erst im Jahr 1400, bei der Absetzung König Wenzels, versuchte man, aus der Goldenen Bulle ein Recht auf Absetzung durch das Kurfürstenkolleg herauszulesen. Im allgemeinen waren die Herrscherabsetzungen des Spätmittelalters jedoch durch eine Kombination verschiedener Legitimationsstrategien sowie durch die Überdeckung des Legitimationsdefizits durch Rituale charakterisiert. „Man suchte einen massiven Überschuß an Sinn zu produzieren und das Geschehen aus so vielen Blickwinkeln wie möglich als vernünftig und geboten erscheinen zu lassen“ (F. Rexroth).
Ethik. Im frühen Mittelalter war der König nicht an die Wahrung klar definierter Rechte gebunden, sondern er war dem Konsens der Aristokratie verpflichtet und damit der Wertewelt der Zeitgenossen. Schlitterte das politische Gefüge in eine Krise, glaubte man den Verfall durch einen Appell an die Besserung der Moral der Akteure beheben zu können. Handeln im Einklang mit den christlichen Moralverstellungen versprach nicht nur den Gewinn der göttlichen Gnade, es sollte auch eine Basis schaffen, in deren Rahmen politische Konflikte ausgetragen werden konnten. Die Bischöfe des Frankenreichs nahmen für sich die Definition eines solchen Grundkonsenses in Anspruch. Ihre Gedanken legten sie in den karolingischen Fürstenspiegeln nieder. Diese Werke sind von einer besonderen Kommunikationssituation geprägt: Sie richteten sich direkt an den König und legten ihm die Befolgung asketischer Ideale nahe; sie sprachen jedoch indirekt den hohen Klerus als potentielle Leser an und dienten der Selbstvergewisserung der gesellschaftlichen Stellung der Kirche.
In den Fürstenspiegeln der Karolingerzeit wurde den fränkischen Herrschern die Erfüllung des gesamten Arsenals christlicher Tugenden anempfohlen wie Demut, Weltverachtung, Barmherzigkeit, Duldsamkeit und Herzenseinfalt. Diese christliche Tugendlehre verbanden die Autoren mit dem Konzept des funktionalen Königtums. Für sie hat der König ein Amt innerhalb der Christenheit inne und ist zur Aufsicht über weltliche und geistliche Angelegenheit berechtigt. Diese Verantwortung für die Kirche hat umgekehrt eine Mahnpflicht der Bischöfe zur Folge, wenn der Herrscher seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das Konzept des funktionalen Königtums ist also eng mit der geistlichen Überordnung des Klerus über den König verwoben. Die Fürstenspiegel der Karolingerzeit sind daher nicht nur moralische Hilfestellungen an die Herrscher, sondern im gleichen Ausmaß auch politische Manifeste.
Die Frage, wie mit einem König umzugehen ist, der nicht dem Postulat der absoluten Vorbildlichkeit genügt, konnten die Autoren der Fürstenspiegel nur in der Form einer Paradoxie begegnen. Da der König nicht an klar definierte Rechte gebunden war, konnten ihm in seiner Machtausübung auch keine festen Grenzen gesetzt werden. Königsmord war zugleich Sakrileg und Pflicht. Johannes von Salisbury († 1180) beschäftigte sich in der Mitte des 12. Jahrhunderts am ausführlichsten mit dieser Paradoxie. Er befürwortete zwar prinzipiell den Tyrannenmord, schränkte diese Aussage jedoch durch etliche Vorbehaltsklauseln wieder ein. Eine kohärente Anleitung für die Praxis ließ sich daraus nur dann entnehmen, wenn man die beispielhaften Anekdoten heranzog, die von Johannes von Salisbury in die Argumentation eingeflochten wurden.
Einen einschneidenden Bruch in der Geschichte der Fürstenspiegel brachte die Rezeption der politischen und ethischen Schriften des Aristoteles. Nach der Übersetzung der Politik (ca. 1265) sind Fragen der Verfassungstheorie in die Fürstenspiegelliteratur eingedrungen. Der König trat jetzt nicht mehr als selbstverständliche Spitze des Gemeinwesens in Erscheinung, sondern als ein durch Institutionen und Gesetze begrenztes Amt innerhalb einer Verfassung. Die Tugenden verloren damit ihren Wert für die Deutung des zeitgenössischen Königtums. Wenn der König als Inhaber eines Amtes begriffen wird, können von ihm auch nur mehr jene Eigenschaften verlangt werden, die durch seine Amtsausübung erfordert werden. Diese Konsequenz zog Engelbert von Admont († 1331), Verfasser zweier verbreiteter Fürstenspiegel. Engelbert verlangte vom Idealfürsten nur jene Tugenden, die er in seiner Amtsführung benötigt. Christliches Gedankengut und christliche Exempla schloß er daher vollständig aus seinen Fürstenspiegeln aus. Von Amts wegen ist nämlich ein Fürst nicht zu christlichem Handeln verpflichtet; sein Seelenheil spielt in diesem Kontext keine Rolle.
Den vorläufigen Todesstoß versetzte der italienische Philosoph Marsilius von Padua († 1342/43) der Gattung der Fürstenspiegel. Das Ideal eines Tugendkönigs mußte ihm in dem Maße suspekt erscheinen, als dieses Ideal bisher immer auch die Folgerung einer Unterordnung unter die Kirche impliziert hatte. Seit der Karolingerzeit bedeutete die postulierte absolute Vorbildlichkeit des Königs eben auch, sich den Vorgaben der christlichen Morallehre zu unterwerfen und die kirchliche Machtentfaltung zu akzeptieren. Als fanatischer Gegner des Papsttums war Marsilius darum bemüht, die Tugendhaftigkeit aus seiner Theorie der politischen Herrschaft zu eliminieren. Er grenzt die Erfordernisse an den Fürsten auf die Tugend der Klugheit und die Tugend der Gerechtigkeit ein und stellt unmißverständlich fest, daß der Fürst durch diese Tugenden nicht über die Bürger des Gemeinwesens herausragen müsse. Damit erklärte er das Postulat der absoluten Vorbildlichkeit des Fürsten für hinfällig. Der Fürst sei ein Mensch wie viele andere und werde erst durch die Verleihung von Autorität in einer demokratischen Wahl zu einem Träger öffentlicher Gewalt. Für Marsilius hat es eine hohe Wahrscheinlichkeit für sich, daß die Wahl einen tugendhaften Bürger treffe, weil das souveräne Volk ein vitales Interesse an einer untadeligen Herrschaft habe. Sollte der Fürst dennoch vom Pfad der Tugend abweichen, stünden dem Volk die Ermahnung und gegebenenfalls auch die Absetzung des Fürsten zu. Tugenden und Laster erscheinen in dieser Argumentation plötzlich nicht mehr als ethische Qualitäten, sondern als soziologisch zu betrachtende Charaktereigenschaften, die durch die politischen Institutionen in die richtige Bahn gelenkt werden. Wenn ein Staat demokratisch verfaßt ist, werden tugendhafte Herrscher gewählt; herrscht der König als erblicher Monarch, tendiert er zu lasterhaftem Verhalten. Unverantwortlichkeit ist nach Marsilius geradezu ein Garant für die Lasterhaftigkeit des Fürsten.
Theorie. Das Königtum war im Mittelalter kein Amt innerhalb einer Verfassung, sondern es hatte patrimonialen Charakter und war den entstehenden politischen Institutionen vorgelagert, gewissermaßen natürlich vorgegeben. Der König war dominus naturalis, Haupt, Herz oder Seele des die politische Gemeinschaft umfassenden Organismus. Diese Vorstellung vom Königtum wurde seit der Mitte des 13. Jahrhunderts mit den Begriffen und Denkfiguren der aristotelischen Politik konfrontiert. Die Philosophen und Gelehrten dieser Zeit mußten das mittelalterliche Königtum vor dem Hintergrund der aristotelischen Theorie neu verständlich machen. Diese Aufgabe war nicht einfach. Bei Aristoteles stand die Monarchie nämlich im Hintergrund der philosophischen Debatte um die griechische Stadtverfassung. Das Königtum war für Aristoteles keine Option für eine funktionierende Verfassung, wenn die Gesellschaft sich durch ein Mindestmaß an sozialer Differenziertheit auszeichnet und nicht mehr als vergrößerte Haushaltung gedacht werden kann. Eine Alleinherrschaft ist dann nur in einer historischen Übergangsphase möglich, wenn der Monarch seine Herrschaft im Vorgriff auf die Entstehung einer echten Bürgergemeinschaft ausübt. Die Institution der Monarchie steht für Aristoteles in einer kaum auflösbaren Spannung zu dem Grundgedanken einer politischen Gemeinschaft.
Die Gelehrten des Spätmittelalters standen demnach vor dem Problem, wie man das Königtum vor dem Hintergrund der aristotelischen Begrifflichkeit als eine „politische“ Herrschaft verstehen kann. Thomas von Aquin († 1274) fand eine originelle Antwort auf dieses Problem. Er befürwortete eine Mischverfassung von Monarchie, Aristokratie und Demokratie, an der alle Teile der Bevölkerung in ständischer Abstufung beteiligt sein sollten. Durch diese Teilhabe war gewährleistet, daß sich jeder als politisch handelnder Bürger verstehen konnte. Die Gemeinschaft der Bürger bezeichnete Thomas folglich als Gemeinschaft der Freien (communio liberorum). Eine Ableitung der königlichen Gewalt sieht Thomas nicht vor. Der König ist für ihn vielmehr mit eigenen Machtbefugnissen ausgestattet und handelt – zumindest innerhalb gewisser Grenzen – aus eigenem patrimonialen Recht. Für Konflikte zwischen den einzelnen Teilen der Mischverfassung hat Thomas nur eine prozedurale Lösung anzubieten: Ob bestimmte Maßnahmen des Herrschers dem Gemeinwohl dienen oder als illegitime Eingriffe in die Rechte der Untertanen anzusehen sind, muß zwischen den an der Verfassung teilhabenden Ständen ausgehandelt werden.
Viele Gelehrte folgten Thomas in dieser Konzeption der Mischverfassung (Jean Quidort, Engelbert von Admont, Nicolas Oresme, John Fortescue u.a.). Trotz der Beliebtheit war diese Konzeption gemessen an den Maßstäben der aristotelischen Politik unbefriedigend. Thomas konnte nicht zeigen, wie ein normales Königtum ohne ständestaatliche Beschränkungen als eine politische Herrschaft interpretiert werden kann. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der sich entfaltenden päpstlichen Monarchie nahm dieses Problem im frühen 14. Jahrhundert an Dringlichkeit zu. Marsilius von Padua und Wilhelm von Ockham entwickelten neue Möglichkeiten, das Königtum als genuin politische Herrschaft zu deuten. Beide begriffen die Monarchie nicht als patrimoniale Herrschaft eigenen Rechts (wie Thomas und seine Nachfolger), sondern ergänzten den aristotelischen Staat um eine vorausliegende Ebene. Für Marsilius konstituiert sich das Volk als souveräner Gesetzgeber vor der Einsetzung staatlicher Institutionen. Eine Monarchie bleibt daher weiterhin eine mögliche (aber nicht bevorzugte) Option, falls sich die Gesamtheit der Bürger für diese Regierungsform entscheiden sollte. Die Autorität einer Monarchie hängt jedoch letztlich von der Willensentscheidung des Gesetzgebers ab und ist daher in jedem Fall als politische Herrschaft zu interpretieren. Ockham ging einen anderen Weg und identifizierte politische Herrschaft mit Herrschaft über freie Bürger. Die Freiheit ist für ihn jedoch nicht durch Institutionen gewährleistet, sondern durch ein von Gott verliehenes natürliches Recht. Diese libertas naturalis konzipierte Ockham als ein natürliches Recht außerhalb jeder positiven Rechtsordnung. Selbst im Rahmen einer absoluten Monarchie bleibt dieses „Menschenrecht“ gewahrt. Der einzige Maßstab für seine korrekte Ausübung ist das individuelle Gewissen, das vor Gott dafür Rechenschaft ablegen muß. Die Versuche, die Legitimationsprobleme des Königtums innerhalb der aristotelischen Begrifflichkeit zu bewältigen, führten somit zur gedanklichen Vorbereitung der modernen Idee der Volkssouveränität (Marsilius) sowie der modernen Vorstellung natürlicher Menschenrechte (Ockham).
KARL UBL