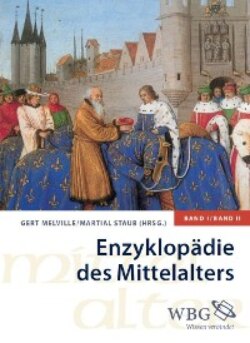Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 19
Königtum
ОглавлениеDas Königtum war im Mittelalter omnipräsent. Sieht man von einigen lokal begrenzten Ausnahmen ab, war das Königtum die selbstverständliche, quasi naturgegebene Form der politischen Organisation in der Zeit von 500–1500 [↗ Königsherrschaft]. Der König symbolisierte als wichtigste Integrationskraft die Handlungseinheit der politischen Gemeinschaft. Diese Bedeutung der monarchischen Institution verlangt nach theoretischer Klärung. Der anspruchsvollste und einflußreichste Versuch in dieser Hinsicht stammt von F. Kern. In seinem Buch Gottesgnadentum und Widerstandsrecht aus dem Jahr 1914 unternahm er es, das „abendländische Königtum“ in seinen vielfältigen Erscheinungsformen auf bestimmte Rechtsprinzipien zurückzuführen. Die entwicklungsgeschichtliche Dynamik des Königtums erklärte er aus der Gegensätzlichkeit dieser zugrundeliegenden Rechtsprinzipien. Im germanischen Recht beobachtete Kern einen Gegensatz von königlichem Geblütsrecht und adeligem Widerstandsrecht, im kirchlichen Recht einen Dualismus von Gottesgnadentum und Amtsgedanken. Eine vereinfachte Version dieses Modells hat der in England wirkende Historiker W. Ullmann († 1983) in zahlreichen Schriften verfochten. Bei ihm reduzierte sich der Dualismus auf den Gegensatz zwischen „aszendenter“ (aufsteigender) und „deszendenter“ (absteigender) Herrschaftslegitimation. Während Kirche, Christentum und römisches Erbe tendenziell deszendent-theokratisches Gedankengut förderten, identifizierte Ullmann das aszendent-genossenschaftliche Regiment mit der im Mittelalter wirkenden germanischen Tradition. Dieses vereinfachte Modell steht im Bann der Theorie O. von Gierkes [↗ Genossenschaftliche Ordnungen].
In der gegenwärtigen Forschung betrachtet man die Versuche einer Zurückführung der monarchischen Institution auf abstrakte Rechtsprinzipien mit großer Skepsis. Dazu hat erstens beigetragen, daß man nicht mehr an der Existenz eines einheitlichen öffentlichen Rechts der Germanen festhält. In der älteren Forschung wurde der Beitrag der germanischen Tradition bei weitem überschätzt und die Wirkmächtigkeit der politischen Lage der Spätantike unterschätzt. Das von Kern so bezeichnete sakrale Geblütsrecht germanischer Könige hielt der kritischen Überprüfung nicht stand. Im Vergleich mit der altorientalischen und antiken Tradition ist man vielmehr zu der Einschätzung gelangt, daß das Herrscheramt bei den germanischen Völkern weit weniger durch eine sakrale Aura aufgeladen wurde als im Mittelmeerraum. Ein spezifisch germanisches Sakralkönigtum ist kaum mehr aufrechtzuerhalten. Der Gegenbegriff dazu, das germanische Heerkönigtum, verspricht ebenfalls wenig heuristischen Gewinn. Der Aufstieg germanischer Heerführer zum Königtum ist vielmehr in den Kontext der Ablösung militärischer Macht vom Kaiser hin zu den Heermeistern (magistri militum) im endenden 4. Jahrhundert zu stellen. Es ist daher sinnvoller, allgemein vom Übergang öffentlicher Gewalt vom Kaiser und seinen Amtsträgern auf einzelne Kriegsherren zu sprechen, egal welcher ethnischer Herkunft sie waren. Die Situation im Westen des Rrömischen Reichs tendierte bereits im 4. Jahrhundert zur Etablierung des Königtums.
Zweitens sieht man von einer Ableitung der monarchischen Institution von abstrakten Rechtsprinzipien gegenwärtig auch deshalb ab, weil man dem gesamten Mittelalter kaum glaubhaft ein Normverständnis unterstellen kann, das dem heutigen gleichkommt. Wenn im Rahmen von Konflikten abstrakte Rechtsprinzipien zur Legitimation herangezogen wurden, standen diese meist nicht im Rahmen einer ausgefeilten systematischen Theorie des Königtums, sondern sollten aktuelle Interessen und aktuelle Ansprüche begründen helfen. Die Systematisierung dieser Ad-hoc-Argumente zu einer in sich kohärenten Lehre vom monarchischen Amt ist erst das Produkt historischer Forschung. Selbst die politische Theorie des Mittelalters hat die Monarchie nicht als Regierungsform betrachtet, die aus bestimmten Rechtsprinzipien abzuleiten war, sondern als eine Institution, die allen politischen Strukturen und Handlungen vorgelagert war. Es erscheint daher wenig sinnvoll, die jeweils zeitgebundenen Legitimitationsstrategien in einer geistesgeschichtlichen Rekonstruktion zu einer Debatte sub specie aeternitatis zusammenzufassen. Solche Legitimitationsstrategien erfüllten vielmehr immer einen bestimmten Zweck und sind im Rahmen des durch Symbole, Argumente und Rituale umkämpften politischen Feldes zu untersuchen. Sie versprechen Aufschlüsse über die Formen und Mittel der Herrschaftspraxis, der sich insbesondere die jüngste Forschung in ihren verschiedenen Facetten zugewandt hat.
Sakralität. Die Wertung des sakralen Königtums im Mittelalter hat eine entscheidende Neuinterpretation erfahren, seitdem die Zeugnisse für ein spezifisch germanisches Königsheil relativiert worden sind. Auch wenn es tatsächlich ein germanisches Sakralkönigtum vor der Berührung mit der römischen Kultur gegeben haben sollte, so hat dieses kaum auf die Gestaltung des mittelalterlichen Königtums eingewirkt. Die Selbstdarstellung der Könige beruhte seit der Zeit um 500 auf christlicher Grundlage. Die Intensität der sakralen Legitimation schwankte im Verlauf des Mittelalters. Man spricht daher von „Sakralisierung“ und „Entsakralisierung“ des Königtums. Diese Entwicklung läßt sich jedoch nicht in einen engen Konnex zur herrscherlichen Machtentfaltung bringen. Als Gradmesser für die Durchsetzungskraft eines Königs taugt die Ausprägung sakraler Legitimation nicht. Die Intensität der Sakralisierung hängt vielmehr von anderen Faktoren ab: von der Herrschaft über die Kirche und der politischen Lage der Bischöfe und des Papsttums sowie – in erster Linie – von den jeweils zeitgemäßen Formen der Frömmigkeit.
Bereits die Herrschaftsrepräsentation Chlodwigs, Sohns eines heidnischen Kleinkönigs und Gründers des Frankenreichs, zeigt deutlich die Kennzeichen der Beeinflussung durch christliche Vorstellungen. Sein Brief an die Bischöfe (507), seine Einberufung eines Konzils in Orléans (511) und die Vorbereitung seiner Grablege in der Apostelkirche von Paris sind letztlich auf das Vorbild des ersten christlichen Kaisers, Konstantins des Großen, zurückzuführen. Das Verhältnis zu den Bischöfen Galliens war jedoch zugleich enger und weiter gefaßt als in der Antike: Zum einen griffen Chlodwig und seine Nachfolger deutlicher in die Bischofswahlen ein als die spätantiken Kaiser; zum anderen ließen sie Fragen des christlichen Dogmas in der Hand der Bischöfe. Die Konzilsbestimmungen beruhten in der Regel auf der Gesetzgebungskompetenz der Bischöfe. Nur ein merowingischer König, Chilperich I. (561–584), versuchte in Nachahmung Kaiser Justinians auf die Formulierung des trinitarischen Dogmas einzuwirken, erntete dafür vom gallischen Episkopat jedoch nur Spott und Ablehnung. Das Beispiel Chilperichs machte im Westen keine Schule. Selbst Karl der Große, der auf dem Konzil von Frankfurt (794) über theologische Fragen unter seinem Vorsitz entscheiden ließ, stützte sich auf die Stellungnahme der fränkischen Bischöfe. Einen Theologen auf dem Königsthron hat es im westlichen Mittelalter nicht gegeben. Die Zuständigkeit der Bischöfe für dogmatische Fragen wurde nach Chilperich nicht mehr angetastet. Der Dualismus von geistlicher Lehrgewalt und weltlicher Herrschaft blieb eine Konstante der mittelalterlichen Politik.
Der Wechsel von den Merowingern zu den Karolingern ist durch eine Intensivierung sakraler Legitimation gekennzeichnet. Diese Intensivierung ist vor allem als Folge des engen Bündnisses mit dem Papsttum zu verstehen. Im Jahr 754 reiste Stephan II. ins Frankenreich, um Pippin I. zum Kampf gegen die Langobarden in Italien zu bewegen. Nachdem Pippin die Restituierung päpstlicher Besitzungen und einen Kriegszug nach Italien zugesichert hatte, salbte Stephan II. den König, seine Ehefrau und seine Kinder. Auf diese Weise verhalf er der Familie Pippins zur Festigung der dynastischen Kontinuität. Als Vorbild diente vermutlich weniger die westgotische Salbungspraxis des 7. Jahrhunderts als vielmehr die Heilige Schrift. Im Alten Testament waren seit David Salbung und Königserhebung eng miteinander verbunden. Im Jahr 754 bezog man sich jedoch nicht nur auf das Vorbild der Bibel; die Königssalbung stiftete darüber hinaus wie die Firmsalbung eine geistliche Verwandtschaft zwischen den Päpsten und den fränkischen Königen. Auf diese künstliche Verwandtschaft bezogen sich die Päpste immer, wenn sie militärische Hilfe von Pippin I. und Karl dem Großen einforderten. Die Klerikersalbung kam für den Akt von 754 noch nicht als Vorbild in Frage, da sich die personale Salbung von Priestern und Bischöfen erst im 9. und 10. Jahrhundert durchsetzte. Der gesalbte König wurde also nicht zum „Priesterkönig“; die Königssalbung war unabhängig von der Prophetenund Priestersalbung im Alten Testament verankert.
Das Verständnis der Salbung änderte sich im 9. und 10. Jahrhundert. Zunächst löste sich im Westfrankenreich die Salbungspraxis vom Amt des Papsttums. Im Jahr 848 führte mit Wenilo von Sens erstmals ein Bischof die Salbung eines Königs durch (wenn man von der in der Forschung umstrittenen Salbung Pippins durch Bonifatius im Jahr 751 absieht). Ziel dieser Handlung war es, die Herrschaft Karls des Kahlen in Aquitanien zu festigen. Im Jahr 869 wurde Karl der Kahle nochmals durch einen Bischof gesalbt, und zwar bei der Annexion des Mittelreichs nach dem Tod Lothars II. Als zukunftsweisend erwies sich die Kombination der Salbung mit einer Wahlhandlung und mit einem Throngelübde. Der König sollte sich dadurch zum Konsens mit den Großen des Reichs, zur Geltung des Kirchenrechts und zur Anerkennung der ethischen Normen der Königsherrschaft verpflichten. Diese Abfolge von Wahl, Throngelübde und Weihe wurde zur Norm für die meisten Königserhebungen im Mittelalter.
Im Ostfrankenreich fand die erste gut bezeugte Salbung durch einen Bischof erst im Jahr 936 statt. Otto I. ließ sich in Aachen nach der Huldigung des fränkisch-sächsischen Adels durch den Erzbischof von Mainz salben und krönen. Diese Inbesitznahme der Herrschaft fand im Rahmen einer Messe statt. Nachdem sich eine personale Salbung auch bei Priestern und Bischöfen durchgesetzt hatte, wurde auch die Königssalbung in diesem Rahmen neu gedeutet. Der quasi-sazerdotale Charakter des Königtums artikulierte sich in der Liturgie während der Krönungsmesse. Der König wurde als Stellvertreter Christi auf Erden, als Mittler zwischen Geistlichkeit und Laien und als Teilhaber an der bischöflichen Gewalt angesprochen. Diese sakrale Stellung des Herrschers schlug sich in den berühmten und oft gedeuteten Herrscherbildern der ottonisch-salischen Zeit nieder. Ihr Charakteristikum ist, daß sie innerhalb von liturgischen Prachthandschriften überliefert sind und eine besondere Nähe des Königs zur göttlichen Sphäre suggerieren. Die göttliche Erwählung des Monarchen ist als Anspruch und gleichermaßen als Verpflichtung ins Bild gesetzt. Darüber hinaus sind diese Herrscherbilder Ausdruck der zeitgemäßen Frömmigkeit: Innerhalb des liturgischen Kontexts sollten sie das Gebetsgedenken (memoria) der durch die Schenkung der Handschrift verpflichteten Institution gewährleisten. Die Sicherung des Heils durch das kollektive Gebetsgedenken galt als ein zentrales politisch-religiöses Anliegen in der ottonisch-salischen Zeit.
Die Etablierung einer priesterlichen Qualität des Königtums im Reich der Ottonen muß auch vor dem Hintergrund der sich intensivierenden Herrschaft über die Reichskirche gesehen werden. Der König setzte nicht nur die Bischöfe ein, er ließ sie in seiner Hofkapelle ausbilden und investierte sie durch die Übergabe von Stab und Ring. Diese Praxis geriet im Verlauf der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts zunehmend in die Kritik. Die Kirche konstituierte sich in dieser Zeit als Amtshierarchie mit dem Papst an der Spitze und stellte den Einfluß der Könige auf die Bestellung von Bischöfen in Frage. Seit 1078 bestritt Papst Gregor VII. dem König offen das Recht auf Einsetzung (Investitur) der Bischöfe. In den Streitschriften dieser Jahre wurde folglich auch die Stellung des Königs innerhalb der Christenheit kontrovers diskutiert. Das Werk des Gregorianers Manegold von Lautenbach († ca. 1103) zeigt auf, zu welchen Positionen damals die Theoriebildung fähig war. Manegold verglich den König mit einem Schweinehirten, dem ein Amt anvertraut sei, das ihm auch wieder entzogen werden könne. Eine Stellvertreterschaft Gottes oder gar eine priesterähnliche Verantwortung enthielt er dem König ausdrücklich vor. Diese Position sprengte den Konsens der Zeit und sollte keine Schule machen. In der Mitte des 12. Jahrhunderts reklamierte Friedrich I. Barbarossa die Gottesunmittelbarkeit seiner Herrschaft für sich und nahm die Bezeichnung sacrum imperium auf, um die Gleichrangigkeit des Reichs mit der sancta ecclesia und dem heiligen byzantinischen Reich herauszustellen.
Daß trotz des Investiturstreits die Sakralität des Königtums eine weitere Steigerung erfahren konnte, zeigt die zeitgleiche Entwicklung in England und Frankreich. Kurz nach 1100 berichten zwei Chronisten unabhängig voneinander über die wunderwirkende Kraft, die den englischen und französischen Herrschern durch ihre königliche Herkunft zukommen würde. Bei Ludwig VI. von Frankreich (1108–1137) ist bereits von einem „gewohnten Wunder“ die Rede: Der König habe wie seine Vorgänger durch Handauflegung und Schlagen des Kreuzzeichens die Heilung von den Skrofeln bewirkt [↗ Wunder]. Im 13. Jahrhundert zählte die Heilung von den Skrofeln zur allseits anerkannten Inszenierung königlicher Sakralität. In England belegt die königliche Rechnungslegung, daß in einem Jahr bis zu 1736 Kranke vom Monarchen gesegnet wurden. In Frankreich wurde diese Heiligung der Dynastie noch durch das asketische Leben Ludwigs IX. gesteigert. Die Heiligsprechung Ludwigs im Jahr 1297 benutzte sein Enkel Philipp IV. zur Demonstration, daß die eigene Dynastie durch vollkommene Reinheit des Blutes geheiligt sei und heilige Könige hervorbringen könne. Der König nahm als rex christianissimus diese Sakralität zum Anlaß, eine besondere Verantwortung für die Kirche zu beanspruchen, die ihm sowohl zum Vorgehen gegen den Papst (Bonifaz VIII.) als auch zur Verfolgung von Häretikern (Tempelritter) berechtigen sollte. Auf gelegentlich kursierende Vorwürfe der illegitimen Abkunft oder des Ehebruchs in der königlichen Familie reagierte Philipp IV. mit äußerster Brutalität. Die „religion royale“ der französischen Könige war ein wichtiges Instrument, um den feudalstaatlichen Charakter Frankreichs aus den Angeln zu heben.
Transpersonalität. Das frühmittelalterliche Königtum entstand aus den Eroberungen germanischer Kriegsherren (sogenannter Heerkönige). Ihre Reiche hatten daher einen patrimonialen Charakter. Am deutlichsten trifft dies auf das Frankenreich zu. Nach dem Tod des Reichsgründers Chlodwig wurde das Reich wie privates Eigentum gleichmäßig auf alle vier Söhne aufgeteilt. Diese Teilungspraxis bestimmte die gesamte fränkische Geschichte unter den Merowingern und Karolingern. Gehemmt wurde sie zeitweise durch den Anspruch des Adels, bei der Entscheidung über das Bestehen von Teilreichen mitzuwirken. So unterstützte der Adel Austrasiens im Jahr 533 den Anspruch Theudeberts I. auf die Nachfolge im Teilreich seines Vaters und vereitelte den Versuch seiner Onkel, das Erbe unter sich aufzuteilen. In der Schwächephase der Merowinger zu Ende des 7. und zu Anfang des 8. Jahrhunderts ließen die übermächtigen Hausmeier nicht alle Anwärter auf das Königsamt an der Herrschaft teilhaben. Die Karolinger orientierten sich nach der Machtübernahme von 751 wieder an der Teilungspraxis des 6. Jahrhunderts. Neben der Mitbestimmung des Hochadels kannte der patrimoniale Charakter des Königtums noch eine weitere Grenze. Als Rechtsnachfolger des Kaisers übernahm der fränkische König das ausgedehnte römische Fiskalland und wurde so zum größten Grundbesitzer im Reich. Dieses Fiskalland konnte der König verschenken oder zur Leihe ausgeben; es zählte jedoch nicht zum Privatbesitz des Königs. Karl der Große verfügte in seinem privaten Testament zwar über den gesamten Königsschatz und die beweglichen Güter; das Fiskalland sollte jedoch über die in der divisio regnorum anvisierte Herrschaftsteilung (806) an die Teilkönige übergehen.
Das Reich der Franken hatte also kaum eine vom Königtum unabhängige Existenz. Es war der Kontingenz dynastischer Wechselfälle unterworfen. Selbst die Etablierung eines Reiches konnte durch eine Herrschaftsteilung vonstatten gehen, wie das Beispiel des regnum Hlotharii (Lothars II.) zeigt. Durch den Zusammenhalt der dort ansässigen Aristokratie existierte dieses Reich auch nach dem Ende der Dynastie, ohne spezifische Institutionen oder eine Kontinuität stiftende Symbolik auszubilden.
Für die Herausbildung eines transpersonalen Reichsbegriffs war die Abkehr von der fränkischen Teilungspraxis entscheidend. Diese Entwicklung wurde durch das Ende der karolingischen Dynastie hervorgerufen. Die nachfolgenden Könige verfügten durch die Zersplitterung des Reichs nicht mehr über das Machtreservoir, um mehrere Königssöhne auszustatten, da sich Ende des 9. Jahrhunderts neue Mittelgewalten gebildet hatten. Diese Mittelgewalten (Herzöge, Markgrafen und Grafen) unterstützten das neue nicht-karolingische Königtum und konnten nicht durch eine Teilung brüskiert werden. Eine Teilung hätte darüber hinaus die Königssöhne auf eine Stufe mit den Mittelgewalten gestellt und den Unterschied beseitigt, ohne den das System von Ranghierarchien und der diffizile Austausch zwischen Königtum und Adel nicht gewährleistet gewesen wären. Die Individualsukzession war der Ausweg aus dieser Situation. Erstmals sicher nachweisbar ist die Bevorzugung des erstgeborenen Sohnes bei König Rudolf I. von Burgund. Nur der ältere der beiden legitimen Söhne (Rudolf II.) folgte ihm 912 nach. Daß die Entscheidung für eine Individualsukzession auf heftigen Widerstand stoßen konnte, zeigt das Beispiel des ostfränkischen Reichs. Im Jahr 929 legte König Heinrich I. eine Hausordnung fest, nach der weder der älteste Sohn Thankmar noch der jüngere Sohn Heinrich an der Königsherrschaft beteiligt sein sollten. Nur der älteste Sohn seiner zweiten Frau Mathilde, Otto (der Große), sollte den Königstitel führen. Nachdem Otto 936 die Herrschaft angetreten hatte, beteiligten sich sowohl Thankmar als auch Heinrich an Aufständen gegen den König. Otto I. milderte die Härte der Individualsukzession insofern ab, als er später Heinrich sowie seinen in den geistlichen Stand eingetretenen Bruder Brun durch die Verleihung hoher Würden an der Herrschaft teilhaben ließ. Noch einmal wurde die Individualsukzession auf die Probe gestellt, als nach dem Ende der ottonischen Dynastie im Jahr 1002 mehrere Thronbewerber um die Königsherrschaft konkurrierten. Im Westfrankenreich setzte sich ebenfalls das Vorbild der Ottonen durch. Im Jahr 954 folgte Lothar seinem Vater Ludwig IV. nach, während sein jüngerer Bruder Karl mit dem Titel des Herzogs von Lothringen vorliebnehmen mußte.
Mit der Entstehung der Individualsukzession wurde der patrimoniale Charakter der Königsherrschaft allmählich verdrängt. Seitdem kam auf verschiedenen Wegen der Gedanke zum Durchbruch, daß dem Reich eine dauerhafte Qualität eignet, die unabhängig von der Existenz eines Königs gewahrt bleibt. Nach dem Chronisten Wipo hätten im Jahr 1024 die Einwohner Pavias die königliche Pfalz am Ort zerstört, nachdem sie vom Tod Heinrichs II. erfuhren hatten. Der Anspruch auf herrschaftliche Unterordnung konnte in einem solchen kritischen Moment bestritten werden. Wipo entgegnete dieser Auffassung durch den Vergleich des Reiches mit einem Schiff, das auch ohne Steuermann nicht aufhört zu existieren. Für diese imaginäre Existenz des Reichs, das im 11. Jahrhundert noch kaum dauerhafte Institutionen ausgebildet hatte, bedurfte es Symbole und Metaphern. Es ist daher kein Zufall, daß mit großer Wahrscheinlichkeit zur selben Zeit die heute in der Wiener Schatzkammer aufbewahrte Reichskrone angefertigt wurde. Die Reichskrone hatte nicht nur ein ausgefeiltes herrschaftstheologisches Programm; sie symbolisierte auch die Kontinuität der Herrschaft und die dauerhaften Rechte des Königs. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts etablierte sich die „unsichtbare Krone“ (E. Kantorowicz) in der politischen Sprache Frankreichs und Englands. Während in Frankreich mit dieser Metapher die Unantastbarkeit und Dauerhaftigkeit königlicher Rechte verbunden wurde, entfernte sich in England die Krone vom Königtum und diente als Bezeichnung der unveräußerlichen Rechte des Reichs. Die Krone umgrenzte die öffentliche Sphäre und den allgemeinen Nutzen, die fundamentalen Ansprüche und Rechte des Landes und seiner Stände. Im 13. Jahrhundert wurde dem englischen König beim Herrschaftsantritt ein Eid über die Unveräußerlichkeit der Kronrechte abverlangt. Im 14. Jahrhundert bezeichnete der Jurist Baldus de Ubaldis dies als eine Praxis „aller Könige der Welt“.