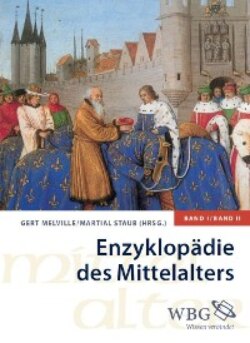Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 16
Papsttum
ОглавлениеIn der Bergpredigt gab Jesus seinen Jüngern den Befehl, sich des Richtens zu enthalten (Mt 7,1). Über ein Jahrtausend später betrachtete sich der Papst, der für sich die Nachfolge des Apostelfürsten in Anspruch nahm, als „ordentlicher und für alle zuständiger Richter“. Die Kluft von der biblischen Forderung nolite iudicare zum päpstlichen Titel iudex ordinarius omnium benennt eine historische Entwicklung, während deren sich die römische Kurie als oberster Gerichtshof der Christenheit etablierte [↗ Papsttum, Kurie, Kardinalat]. Die universale Zuständigkeit des Papstes beruhte vor allem auf seiner Stellung in der Rechtsordnung. In diesem Bereich konnte er seinen Primatsanspruch in vielerlei Form und Gestaltung zur Geltung bringen, während er in Fragen des Glaubens viel enger an die Vorgaben der Heiligen Schrift, der ökumenischen Konzilien und der großen Kirchenväter gebunden blieb. Zu verstehen ist diese Entwicklung nur vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Rechtsgeschichte [↗ Kirchenrecht]. Bereits am Ende des 4. Jahrhunderts stilisierte der Papst seine Rechtsauskünfte nach dem Vorbild kaiserlicher Reskripte und brachte damit das eigene überhöhte Selbstbild zum Ausdruck. In der Zeit des Frühmittelalters, als das schriftliche Recht zugunsten des mündlichen Gewohnheitsrechts an Bedeutung einbüßte, bewahrte sich die Kirche durch die Einverleibung des römischen Rechts eine hohe Rechtskultur. Eine systematische Behandlung von Rechtssätzen und von Rechtssammlungen fand fast ausschließlich innerhalb der Kirche statt. Durch die ständige Fortbildung des Rechts in Konzilien und Papstbriefen nahm die Komplexität im Hochmittelalter derart zu, daß eine Instanz notwendig wurde, um das geltende Recht in seinen Umrissen festzulegen und neue Rechtssetzungen zu ermöglichen. Der Papst nahm diese Stelle seit der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts ein und schuf ein ausdifferenziertes Rechtssystem innerhalb der Kirche, das den entstehenden Rechtsordnungen der Nationalstaaten als Vorbild diente. Der universalistische Anspruch des Papsttums erwies sich in dieser Hinsicht als ein Faktor der Modernisierung.
Primat. Ein Vorrang der römischen Kirche ist erstaunlich früh zu erkennen. Bereits Ende des 1. Jahrhunderts schickte die römische Kirche ein Lehrschreiben an die Kirche in Korinth, das später dem „ersten Papst“ Clemens I. zugeschrieben wurde. Dieser Vorrang beruhte zum einen auf dem Martyrium der beiden Apostel Petrus und Paulus in Rom; zum anderen beeinflußte die Stellung Roms als Reichshauptstadt nicht unwesentlich die Etablierung des Primats. Diese besondere Stellung erhob die römische Kirche jedoch anfangs nicht grundsätzlich über die anderen Bischofskirchen, die sich ebenfalls auf apostolische Gründung zurückführen konnten. Ein qualitativer Unterschied zwischen Rom und allen übrigen Kirchen wurde erst Ende des 4. Jahrhunderts durch Papst Damasus I. († 384) geltend gemacht. Auf einer römischen Synode reagierte Damasus auf die zunehmende Stärkung Konstantinopels durch kaiserliche Privilegierung und ließ verkünden, daß allein die römische Kirche durch den Herrn Jesus Christus selbst gegründet worden sei. Während die anderen Hauptkirchen der Christenheit wie Antiochia und Alexandria ihre Stellung synodalen Entscheidungen verdankten, sei der römische Primat in der Bibel verankert. Der Papst berief sich dabei auf Mt 16,18: „Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.“ Diesen Ausspruch bezog er auf den Papst als juristischen Erben Petri. Der Nachfolger des Damasus, Siricius I. († 399), ließ die erste päpstliche Dekretale ausfertigen, eine Rechtsweisung an den Bischof von Tarragona, die sich der Form nach an den kaiserlichen Reskripten orientierte. Fortan veröffentlichten die Päpste ihre Rechtsweisungen in dieser Form. Obwohl diese Kompetenz auf den Westen beschränkt blieb und im Osten eine annähernd gleichwertige Stellung der übrigen Patriarchen anerkannt werden mußte, etablierte sich an der päpstlichen Kurie eine universale Programmatik. Ihren Höhepunkt erreichte sie im Pontifikat Leos I. (†461). In seinen Predigten leitete er aus Mt 16,18 eine gesamtkirchliche Überordnung des Papstes ab. In seinen Worten war der Papst Haupt, Vorbild und Fürst der gesamten Kirche. Im Osten mußte Leo gegen erheblichen Widerstand dafür eintreten, daß der Apostolische Stuhl in dogmatischen Fragen nicht übergangen wurde. Auf dem Konzil von Chalcedon (451) errang er einen bedeutenden Erfolg und konnte die Festlegung des christologischen Dogmas entscheidend beeinflussen. Die Konzilsteilnehmer akzeptierten die Stellungnahme des Papstes mit den Worten: „Petrus hat durch Leo gesprochen.“
Zweigewaltenlehre. Trotz dieses Erfolgs in Chalcedon wurde der Papst weiterhin mit Eingriffen des Kaisers in Glaubensfragen konfrontiert. Der Kaiser sah sich als von Gott auserwählter Lenker der Christenheit, dessen Auftrag es war, die in dogmatischen Fragen verfeindeten Teile seines Reiches mit einer einheitlichen Glaubensformel zu befrieden. Als es Kaiser Zenon gelang, einen Kompromiß zwischen Monophysiten und orthodoxer Reichskirche herzustellen, weigerte sich der Papst gemeinsam mit der westlichen Kirche, dieser neuen Glaubensformel beizutreten. Es kam zum sogenannten „Akakianischen Schisma“ (484–519) zwischen der Ostund der Westkirche. Papst Gelasius I. († 496) wies in einem berühmten Brief an Anastasios I. Einmischungen des Kaisers in den Bereich der Religion kategorisch zurück. In diesem Brief unterschied er die heilige Autorität der Bischöfe (auctoritas sacrata pontificum) von der königlichen Herrschaft (regalis potestas). Dogmatische Fragen unterstellte er ausschließlich der Kompetenz der Bischöfe. Dem Kaiser billigte er die höchste Würde innerhalb der Christenheit zu und befürwortete den Gehorsam des Klerus gegenüber weltlichen Gesetzen; eine größere Verantwortung schrieb er jedoch den Bischöfen zu, die vor dem Gericht Gottes für das Handeln der Herrscher Rechenschaft ablegen sollten. Diese Trennung der Gewalten interpretierte Gelasius als heilsgeschichtliche Notwendigkeit, da Herrscher und Bischöfe dadurch zur Demut und zur wechselseitigen Kooperation ermahnt würden.
In der Zeit um 500 war die Zweigewaltenlehre des Gelasius mehr Wunschdenken als Realität. Das „Akakianische Schisma“ löste sich noch im Sinne des Papsttums auf, in den folgenden dogmatischen Kontroversen mit dem Kaiser mußte der Papst aber nicht selten klein beigeben. Seit der Rückeroberungspolitik Justinians war Rom ein Bestandteil des byzantinischen Reiches. Folglich wurde der Papst weitgehend unter die Kirchenherrschaft des Kaisers gezwungen. Er mußte seine Wahl durch den Kaiser bestätigen lassen; er war mitunter gezwungen, in Konstantinopel Rechenschaft über sein Handeln abzulegen, und ist in Extremfällen (Vigilius I., Martin I.) sogar in Gefangenschaft genommen worden. In dieser Zeit ist die gelasianische Zweigewaltenlehre dem Vergessen anheimgefallen. Erst nach der schrittweisen Loslösung von Byzanz wurde diese Doktrin wieder vereinzelt zitiert. In der Karolingerzeit bediente sich jedoch häufiger der fränkische Episkopat der Formulierung des Gelasius. Die Bischöfe des Frankenreichs wehrten sich einerseits gegen die Eingriffe der Herrscher in die kirchliche Amtshierarchie, andererseits begründeten sie damit ihre Mahnpflicht gegenüber den Kaisern und Königen. Als Experten in Recht und Moral forderten sie die Beteiligung an der konsensualen Herrschaftspraxis. Die Fokussierung auf den Papst als Leiter der Kirche wurde der gelasianischen Formel erst durch Gregor VII. im 11. Jahrhundert übergestülpt [↗ Investiturstreit]. Um auf der Höhe des Investiturstreits die Absetzung Heinrichs IV. zu legitimieren, verfälschte er den Sinn der Zweigewaltenlehre. Aus der Rechenschaftspflicht der Bischöfe im Jenseits machte er eine richterliche Kompetenz des Papstes im Diesseits. Im kaiserlichen Lager wurde dieser verzerrenden Lesart scharf widersprochen. Die Anhänger Heinrichs IV. sahen im Brief des Gelasius ein eindeutiges Argument für die heilsgeschichtlich verankerte dualistische Weltordnung. Fortan beriefen sich beide Parteien in dem Konflikt zwischen Papsttum und Kaisertum auf die Zweigewaltenlehre.
Konstantinische Schenkung. Im 8. Jahrhundert trennten sich die Wege von Byzanz und Rom. Als der Kaiser in Konstantinopel alle Kräfte auf die Abwehr der arabischen Expansion richtete, wandte sich der Papst den langobardischen und fränkischen Königen zu. Dogmatisch schlug sich diese Distanzierung in dem Konflikt über die Bilderverehrung nieder, der den Papst seit 726 zu offenem Widerspruch gegen die kaiserliche Politik herausforderte. Seit dem Bündnisvertrag von Ponthion (754) etablierten sich die Frankenkönige aus dem Haus der Karolinger als Schutzmacht über das Papsttum [↗ Karolinger]. Die Herrschaft über Rom und seinen Dukat beanspruchte der Papst jedoch aus eigenem Recht. Zur Legitimation dieses Rechtsanspruches entstand im Umkreis des Papstes die Konstantinische Schenkung (ca. 750–850). Formal handelt es sich bei diesem Dokument um eine gefälschte Urkunde Konstantins des Großen. Im ersten Teil beschreibt der Kaiser seine Heilung vom Aussatz durch Papst Silvester, im zweiten Teil verleiht er dem Papst als Dank verschiedene Ehrenrechte wie die kaiserlichen Hoheitszeichen. Darüber hinaus schenkt er ihm die Stadt Rom sowie alle westlichen Provinzen mit der Begründung, es sei „nicht gerecht, wenn dort der Kaiser weltliche Macht ausübt, wo vom himmlischen Kaiser die Herrschaft über die Priester und das Haupt der christlichen Religion errichtet worden ist“.
Trotz dieser weit ausgreifenden Herrschaftsansprüche wurde die Konstantinische Schenkung vom Papsttum nur höchst selten zum Einsatz gebracht. Verbreitung fand sie erst durch die im nordfranzösischen Kloster Corbie entstandenen pseudoisidorischen Fälschungen. Seitdem konnte der Papst die Kenntnis des Faktums im Westen voraussetzen und brauchte nicht selbst dieses merkwürdige Dokument in Anschlag bringen. Gegenüber der Ostkirche hat Leo IX. im Jahr 1053 allerdings darauf nicht verzichten wollen. In seinem Brief an den Patriarchen Michael Kerullarios verwies er ausdrücklich auf die Schenkung Konstantins, um die Vereinigung von kaiserlicher und höchster bischöflicher Gewalt für sich in Anspruch zu nehmen. Leo verabschiedete sich damit von der gelasianischen Gewaltentrennung und betrachtete den Papst als Nachfolger des Weltenherrschers Christus. Diese Doktrin kam auch im Dictatus papae (1075) Gregors VII. zum Ausdruck, als der Papst die Benützung kaiserlicher Insignien und die Kompetenz zur Absetzung des Kaisers geltend machte. Dennoch hat Gregor sich ebensowenig auf die Fälschung berufen wie die meisten seiner Nachfolger. Ansprüche auf Herrschaft oder lehensrechtliche Hoheit in Sizilien, Unteritalien, Spanien oder England wurden von seiten des Papstes nicht mit der Schenkung Konstantins legitimiert. Diese Zurückhaltung ist nicht auf die durchaus umstrittene Gültigkeit der Schenkung zurückzuführen, sondern auf ihre ambivalente Aussagekraft. Für die Päpste des Hoch- und Spätmittelalters sollte ihre priesterliche und königliche Stellung einzig und allein auf der Bibel beruhen, und zwar im wesentlichen auf Mt 16,18. Die Konstantinische Schenkung suggerierte dagegen, daß der Papst seine Macht einer Urkunde des Kaisers verdankte. Anhänger des Papsttums tendierten folglich dazu, die Schenkung als Zurückerstattung der dem Papst eigentlich zustehenden Stellung als Weltherrscher zu interpretieren. Von seiten des Kaisers und seiner Anhänger wurde die Gültigkeit der Schenkung nur selten (Otto III.) in Zweifel gezogen. In den theoretischen Auseinandersetzungen berief man sich meistens darauf, daß eine so weitgehende Zuwendung den Amtspflichten des Kaisers widersprochen hätte und deshalb seine Nachfolger nicht binden könne. Manche häretische Gruppen wie die Waldenser verbanden mit der Schenkung eine negative Wertung, da sie als Auslöser für die Verweltlichung der Kirche betrachtet wurde. Populär war die Aussage, mit Konstantin sei das Gift in die katholische Kirche eingedrungen. Den formalen Beweis der Unechtheit lieferten aufgrund philologischer Argumente Nikolaus von Kues († 1464) und Lorenzo Valla (†1457).
Zweischwerterlehre. Die Ambivalenz von Argumenten im Meinungsstreit über das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht erweist sich auch in der Verwendung von Lk 22,38. Dort heißt es in einem Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern: „Da sagten sie: ‚Herr, hier sind zwei Schwerter.‘ Er erwiderte: ‚Genug davon!‘“ Die Jünger mißverstanden die Aufforderung Jesu, Schwerter zu kaufen und sich für die Zeit nach seinem Tod zu rüsten, im wörtlichen Sinn und wurden von Jesus deshalb scharf zurechtgewiesen. Im Mittelalter deutete man diese Stelle allegorisch und bezog die zwei Schwerter auf die geistliche und die weltliche Gewalt. Erstmals bediente sich König Heinrich IV. im Jahr 1076 dieses Arguments, als er in einem Schreiben an die deutschen Bischöfe die Trennung der weltlichen von der geistlichen Gewalt verteidigte und die Einmischung Gregors VII. zurückwies. Der gelasianische Dualismus schien dadurch gerechtfertigt.
Den Anhängern des Papstes gelang es jedoch, diese allegorische Deutung zu überbieten. Bernhard von Clairvaux († 1153) setzte Lk 22,38 in Bezug zu Joh 18,11: „Da sagte Jesus zu Petrus: ‚Steck das Schwert in die Scheide!‘“ Dieses Schwert setzte Bernhard mit der weltlichen Gewalt gleich, das zwar im Besitz der Kirche sei, auf das sie jedoch freiwillig verzichtet habe: „Beide Schwerter, das geistliche und das weltliche, gehören der Kirche, aber dieses soll für die Kirche, jenes hingegen von der Kirche hervorgeholt werden; jenes steht dem Priester zu, dieses der Hand des Ritters, aber durchaus auf Wink des Priesters und auf Befehl des Kaisers.“ Diese Deutung setzte sich bei Theologen und kirchlichen Juristen durch und wurde auch von den Päpsten übernommen. Bonifaz VIII. verwendete sie in seiner berühmten Bulle Unam sanctam, allerdings nicht ohne die Worte „auf Befehl des Kaisers“ zu streichen. Die Metapher der zwei Schwerter war im Mittelalter so einprägsam, daß auch volkssprachliche Quellen der Diskussion um die Deutung von Lk 22,38 großes Gewicht beimaßen (Sachsenspiegel, Schwabenspiegel). Im Spätmittelalter verlor das Argument im gelehrten Milieu an Gewicht. In dem Maße, in dem die allegorische Bibelinterpretation in der Spätscholastik in die Kritik geriet, mußte auch die allegorische Deutung der zwei Schwerter an Überzeugungskraft verlieren. Kritiker des Papsttums wie Johannes Quidort († 1306) und Marsilius von Padua († 1342/43) wiesen die Gültigkeit von Argumenten zurück, die aus einer willkürlichen Bibelallegorese gewonnen worden waren.
Vollgewalt. Der Papst führte seine Stellung in der Welt und in der Kirche auf Mt 16,18–19 zurück. Nach dem Bekenntnis Petri und der Gründung der Kirche auf dem Fels „Petrus“ übergibt Jesus in Mt 16,19 Petrus die Schlüsselgewalt: „Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.“ Die Identifizierung des göttlichen mit dem päpstlichen Handeln war als Begründung für die Stellung des Apostolischen Stuhls nicht zu überbieten. Der Begriff der „Vollgewalt“ (plenitudo potestatis) bot sich zur Umschreibung dieser Identität an, weil sich die umfassende Formulierung, alles auf Erden zu binden und zu lösen, im Begriff der Vollgewalt spiegelt.
Zum Inbegriff der päpstlichen Vormachtstellung wurde dieser Begriff jedoch erst nach einer langen Vorgeschichte. Papst Leo I. prägte ihn, um die Machtbefugnis eines päpstlichen Vikars von der Vollgewalt des Papstes selbst abzugrenzen. Das Verhältnis zwischen Papst und Bischöfen berührte er nicht. Erst die pseudoisidorischen Fälschungen aus der Mitte des 9. Jahrhunderts machten aus der Vollgewalt ein Attribut des Papstes im Verhältnis zu den Bischöfen. Die Fälscher aus Corbie folgerten aus dieser Stellung die Zuständigkeit des Papstes in allen wichtigeren Rechtsfällen der Kirche. Die Institution des gesamtkirchlichen Konzils wurde auf diese Weise als Entscheidungsgremium verdrängt. Eine konsequente Ekklesiologie wurde jedoch nicht aus diesem Begriff abgeleitet. Während der Zeit des Investiturstreits war der römischen Kurie das Konzept der Vollgewalt nicht vertraut. Erst die beginnende Rechtswissenschaft führte zu einer Sammlung der verstreuten Belege für den Begriff der plenitudo potestatis, so daß Ende des 12. Jahrhunderts der Begriff Eingang in das Formular der Papstbriefe finden konnte. Vor allem in den Dekretalen Innozenz’ III. wurde die Vollgewalt zur gängigen Münze für allerlei Rechtsansprüche. Sie diente zur Rechtfertigung einer außerordentlichen Gerichtsbarkeit und Dispensgewalt in weltlichen und kirchlichen Angelegenheiten, der generellen Befugnis zur Rechtssetzung in der Kirche, des Provisionsrechts für Benefizien, der exklusiven Kompetenz für Heiligsprechungen und weiterer Prärogativen im Ordensrecht und Finanzwesen. Für die Zeit zwischen Innozenz III. und Bonifaz VIII. stellte der Papsthistoriker Johannes Haller fest: „Die plenitudo potestatis des römischen Bischofs […] ist der Glaube des Jahrhunderts.“ Der Begriff wurde nicht als ein streng wissenschaftlicher Terminus technicus, sondern als eine Metapher der überragenden Stellung des Papstes behandelt. Die Metapher suggerierte zwar eine Ableitung aller weltlichen und kirchlichen Gewalt vom Papst; sie wurde aber in den seltensten Fällen in dieser Radikalität verstanden. Erst im Verlauf des sich immer stärker aufschaukelnden Streits um die Privilegien der Bettelorden (1257–1322) kam es zur Ausformulierung konsequent durchdachter Ekklesiologien. Die Debatten, die sich seit 1300 um den Sinngehalt der päpstlichen Vollgewalt entzündeten, gehören zur Vorgeschichte der Debatte um politische Souveränität und ihre Grenzen.
Unfehlbarkeit. Seitdem sich der Papst im 5. Jahrhundert als juristischer Erbe Petri definiert hatte, war es nur folgerichtig, die Herrenworte in Lk 22,32 auf den Inhaber des Apostolischen Stuhls zu projizieren. Bevor Jesus seinem Jünger Petrus den baldigen Verrat ankündigte, versicherte er: „Ich aber habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht erlischt.“ Die römische Kirche galt daher seit der Spätantike als apostolischer Stuhl par excellence und als Hort der Rechtgläubigkeit. Papst Agatho († 681) verschärfte diese Überzeugung, indem er behauptete, daß die römische Kirche durch die Gnade Gottes niemals von der Richtschnur der apostolischen Tradition abgewichen und niemals häretischen Neuerungen erlegen sei. Dieser Satz wurde auf dem 6. ökumenischen Konzil in Konstantinopel (680/81) approbiert, nicht ohne im gleichen Atemzug Papst Honorius († 638) zu exkommunizieren, da er den Monotheletismus als Glaubenslehre akzeptiert hatte, der in Konstantinopel als Häresie verurteilt wurde [↗ Dogmen und Ketzerei]. Die Formulierung Agathos hätte keine Wirkungsgeschichte entfaltet, wenn sie nicht von den pseudoisidorischen Fälschern an mehreren Stellen ihres Werkes aufgenommen worden wäre. So ging der Satz von der Irrtumslosigkeit des Papstes in das Kirchenrecht ein. Gregor VII. († 1085) machte sich im Dictatus papae diese Ansicht zu eigen: „Die römische Kirche hat niemals geirrt und wird nach dem Zeugnis der Schrift niemals irren.“ In der Wissenschaft vom Kirchenrecht konnte man sich dieser Ansicht allerdings nicht anschließen, da man von mehreren Päpsten zu wissen glaubte, daß sie wie Honorius I. der Häresie verfallen waren. Als unfehlbar betrachtete man nur Gott selbst, die Heilige Schrift, die durch den Heiligen Geist inspirierten vier ökumenischen Konzilien oder die römische Kirche als Gesamtkirche. Erst im Streit um das franziskanische Armutsideal gewann die Idee einer päpstlichen Unfehlbarkeit an Kontur. Den Anspruch der Franziskaner, durch ihre Praxis der individuellen und kollektiven Besitzlosigkeit das Leben der Apostel zu neuem Leben zu erwecken, sanktionierte Papst Nikolaus III. im Jahre 1279. Vier Jahrzehnte später stellte Papst Johannes XXII. die Gleichsetzung von apostolischer und franziskanischer Lebensform erneut zur Debatte, um die Verordnung seines Vorgängers zu revidieren. Die franziskanische Kommunität protestierte scharf und behauptete, daß der Papst die dogmatischen und disziplinären Entscheidungen seiner Vorgänger nicht aufheben dürfe, da sie unumstößlich und unfehlbar seien. Der Papst wies diese Doktrin empört zurück. Seinem Verständnis der souveränen Gesetzgebungsgewalt des Papstes widersprach es, wenn er in seiner Machtfülle durch die Entscheidungen seiner Vorgänger eingeschränkt sein sollte. Die Bindung an die Tradition war für den Juristenpapst kein zu bewahrender Wert. Johannes XXII. radikalisierte die Souveränität des Papstes über das Recht; die Franziskaner radikalisierten die bislang herrschende Vorstellung von der prinzipiellen, aber nicht notwendigen Irr-tumslosigkeit der römischen Kirche. Neu angefacht wurde die Diskussion im Zeitalter des Konziliarismus [↗ Genossenschaftliche Ordnungen]. Sowohl die Konziliaristen als auch die Verfechter des monarchischen Papsttums nahmen die Unfehlbarkeit für die von ihnen verteidigte Institution in Anspruch.
Gnadenschatz. Der Ablaß entwickelte sich im 11. Jahrhundert aus der frühmittelalterlichen Tarifbuße. Diese erlaubte die Ableistung der Sündenstrafen durch Geldzahlungen oder durch Stellvertretung. Die Kirche selbst bot sich als stellvertretende Institution an, die gegen das Spenden von Almosen die Heiligkeit und die Fürbitte der Kirche für die Sündenstrafen einstehen ließ. Abgegolten wurden dadurch nicht nur im Diesseits zu leistende Bußübungen, sondern auch die im Fegefeuer zu erleidenden Strafen – immer unter der Voraussetzung der im Bußsakrament vollzogenen Reue des Sünders [↗ Buße]. Die Monopolisierung des Ablasses durch das Papsttum vollzog sich in einem langsamen Prozeß vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. Im Jahr 1063 versprach Alexander II. den normannischen Eroberern Siziliens die Lossprechung von ihren Sünden. Auf dem Konzil von Clermont (1095) rief Urban II. zum Kreuzzug ins Heilige Land auf und stellte den Kreuzfahrern die Tilgung „aller Buße“ in Aussicht. Grundlage dieser Versprechungen war die Idee, alle Verdienste des hl. Petrus seien auf die Amtsnachfolger des Apostolischen Stuhls übergegangen. Gregor VII. verstieg sich sogar zu der Behauptung, daß der Papst nach seiner rechtmäßigen Weihe aufgrund der Verdienste Petri unzweifelhaft heilig werde. Selbst sittliche Vergehen und Verbrechen, so die Juristen dieser Zeit, könnten diese Amtsheiligkeit des Papstes nicht beeinträchtigen. Innozenz III. definierte den Papst als „ein zwischen Gott und den Menschen gestelltes Wesen, diesseits Gottes, aber jenseits des Menschen, weniger als Gott, aber mehr als der Mensch“. Innozenz war es auch, der die bischöfliche Kompetenz zur Erteilung des Ablasses einschränkte und für das Papsttum die vorrangige Regelung dieser Materie in Anspruch nahm. Regelungen waren deshalb nötig geworden, weil der Ablaß als verläßliches Heilsangebot zu einem immer größere Kreise ziehenden religiösen Massenbedürfnis wurde. Angesichts dieser Ausweitung des Ablasses erschien die Äquivalenz von kirchlicher Fürbitte und menschlichen Sündenstrafen immer problematischer. War die Kirche tatsächlich in der Lage, für die gesamte Fülle der Sünden angemessene Wiedergutmachung zu leisten? Mitte des 13. Jahrhunderts kam daher in der Theologie eine neue Legitimation auf: Der Ablaß sollte auf dem unerschöpflichen Gnadenschatz Christi beruhen. Die Verwaltung dieses Schatzes sprach man dem Papst als vicarius Christi zu. Von dieser Kompetenz machte Bonifaz VIII. Gebrauch, als er für das Jubiläumsjahr 1300 einen Plenarablaß für alle Rompilger festsetzte, die bestimmte Hauptkirchen besuchten. Ein halbes Jahrhundert später wiederholte Clemens VI. den Jubiläumsablaß und erhob in einer Bulle die Idee des päpstlichen Gnadenschatzes zur geltenden Lehre. In der Zeit des Schismas wurde die Gewährung eines Plenarablasses zum Instrument, der eigenen Obödienz eine größtmögliche Geltung in der Christenheit zu verschaffen. Bonifaz IX. gewährte im Jahr 1400/01 ungefähr 250 sogenannte Portiuncula-Ablässe (in Anlehnung an den 1223 der Kirche des Franz von Assisi in Portiuncula gewährten Plenarablaß). Auch für Verstorbene konnten Ablaßbriefe erwirkt werden. Diese vielgestaltige Ablaßpraxis stand immer wieder in der Kritik einzelner Theologen, die ein unmittelbares Gottesverhältnis forderten und die objektive Heilsvermittlung durch die Kirche ablehnten. Auch bei Volksbewegungen wie den Flagellanten oder den häretischen Waldensern brach sich dieses Bedürfnis Bahn.
Wirkungsweise. Der Ablaß war eines der wichtigsten Instrumente der Anbindung der gläubigen Massen an das Papsttum. Die universalen Ambitionen des Apostolischen Stuhls kamen durch die garantierte Heilszusicherung des Ablasses vielen Menschen überhaupt erst zum Bewußtsein. Im frühen Mittelalter gab es dagegen selbst innerhalb der Kirche nur sporadische Kontaktaufnahmen zwischen dem Papsttum und den Ortskirchen. Erst durch die Etablierung der Praxis, vom Papst die erzbischöfliche Insignie, das Pallium, zu erbeten, kam es seit dem 8. und 9. Jahrhundert zu regelmäßigen Kontakten. Daneben pflegten einzelne Klöster besondere Beziehungen zum Apostolischen Stuhl, da sie sich der Jurisdiktion des Papstes unterworfen hatten. Erstmals erlangte das Kloster Bobbio ein solches Privileg von Papst Honorius I. († 638). Seit der Zeit um 1000 entwickelte sich diese Privilegierung durch den Papst zu einer regelrechten Exemtion vom zuständigen Ortsbischof. Das berühmte Kloster Cluny [↗ Religiosentum] nahm in dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle ein. Im Lauf des 12. Jahrhunderts gelangten ganze Ordensverbände unter die besondere Fürsorgepflicht des Papstes (z.B. die Zisterzienser und die geistlichen Ritterorden). Bei den Bettelorden war der enge Kontakt mit dem Papsttum besonders wichtig, da die Entfaltung ihrer Tätigkeit von der päpstlichen Ermächtigung zur Seelsorge abhängig war. Der Franziskanerorden lehnte den Erwerb von Eigentum prinzipiell ab und entwarf die Fiktion eines päpstlichen Obereigentums aller franziskanischen Güter. Am Konzil von Vienne (1312/13) sah sich der Papst mit einer geballten Opposition gegen die Exemtion von Ordensverbänden konfrontiert. Die Bischöfe warfen der Kurie vor, mit der Kontrolle der vielen exemierten Klosterverbände überfordert zu sein. Der im Jahr 1307 initiierte Prozeß gegen den Templerorden schien diese Befürchtung zu bestätigen.
Eine massive Zunahme päpstlicher Wirksamkeit ging mit der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts einher. Instrumente wie das Legatenwesen und die Einberufung von überregionalen Synoden in Rom wurden erst durch das Reformpapsttum seit 1046 eingesetzt. Das 4. Laterankonzil von 1215 setzte mit der Teilnahme von 412 Bischöfen, über 800 niederen Prälaten und zahlreichen weltlichen Gesandtschaften neue Maßstäbe. Ein Kanon dieses Konzils legte die alleinige Kompetenz des Papstes bei Heiligsprechungen fest und machte Rom zur Anlaufstelle für alle, die an der Errichtung eines Heiligenkultes interessiert waren [↗ Heiligsprechung]. Heiligsprechungsverfahren waren äußert selten; die Erteilung von Pfründen gehörte zum alltäglichen Geschäft in Rom. Anfangs reservierte sich der Papst nur für bestimmte Fälle das Recht zur Erteilung einer Pfründe oder einer Expektanz für eine zu erwartende Pfründe. Im 14. Jahrhundert verfügte der Papst die Generalreservation aller Pfründen und verlangte als Gegenleistung für die Erteilung den Gegenwert eines Jahreseinkommens aus der Pfründe (sogenannte „Annaten“). Zur Einnahme dieser und anderer Zahlungen (Kreuzzugszehnt, Peterspfennig, Servitien) schickte der Papst sogenannte collectores durch sämtliche Regionen Europas. In Avignon fanden sich alle Kleriker ein, die sich an der Kurie um eine Pfründe bewerben wollten. In den ersten Monaten nach der Wahl Clemens’ VI. (1342) sollen sich ca. 40.000 Kleriker in Avignon aufgehalten haben. Nicht nur Kleriker, sondern auch Laien mußten sich aus ganz Europa an die Kurie wenden, wenn sie Dispensierungen in denjenigen Rechtsmaterien erlangen wollten, über deren Erteilung allein der Papst entscheiden durfte. Anlaufpunkt dafür war seit dem 13. Jahrhundert die Pönitentiarie [↗ Papsttum, Kurie]. Bis zum Ende des Spätmittelalters wuchs die Behörde ständig und umfaßte um 1500 mehr als 200 Mitarbeiter. Sie erteilte Absolutionen für Gewalttäter gegen Kleriker und Kirchen sowie Dispense vom Hindernis der Verwandtschaft und von unehelicher Geburt. Allein in den rund achtzig Jahren von 1449 bis 1533 sind knapp 38.000 Dispense vom Geburtsmakel in den Registern der päpstlichen Pönitentiarie dokumentiert.
Symbole. Im Dictatus papae von 1075 behauptete Gregor VII., daß allein der römische Pontifex zu Recht „universal“ genannt werde. Dieser Satz richtete sich gegen den Patriarchen von Konstantinopel; denn ein Patriarch konnte aus der Sicht Gregors keinen Anspruch auf Universalität aufrechterhalten, da er den anderen Patriarchen gleichgestellt sei. Nur der Papst verfügte über einen Titel (papa), den er seit dem 6. Jahrhundert für sich allein geltend machte. Diese Universalität des Papstes kam im Mittelalter vor allem durch drei Symbole zum Ausdruck: das Pallium, die Schlüssel und die Tiara. Das Pallium, eine mit Kreuzen geschmückte Stola aus Schafswolle, soll das universale Hirtenamt des Papstes symbolisieren (nach Joh 21,15: „Weide meine Schafe“). Die Schlüssel beziehen sich auf Mt 16,19 und waren ursprünglich ein Attribut des „Himmelpförtners“ Petrus. Der Papst wurde zuweilen zwar auch als „Schlüsselträger“ (claviger) bezeichnet; in den Bildzeugnissen eignete sich der Apostolische Stuhl jedoch erst im 13. Jahrhundert diese Insignie an. Unter Innozenz III. wurden erstmals die Schlüssel Petri auf den Fahnen der römischen Kirche abgebildet. Bonifaz VIII., der schärfste Verfechter des päpstlichen Absolutismus, ließ die Schlüssel in sein amtliches Wappen aufnehmen und begründete damit eine bis heute eingehaltene Tradition. Die Tiara als Herrschaftszeichen geht zurück auf die Konstantinische Schenkung. In diesem Dokument weist Papst Silvester die kaiserliche Krone zurück und akzeptiert als Kopfbedeckung nur die weiße phrygische Mütze. Im Lauf der Zeit wurde die Mütze dennoch zur Krone umfunktioniert: Am unteren Rand wurde sie mit einem Diadem geschmückt, das den weltlichen Herrschaftsanspruch des Papstes darstellte. Unter Bonifaz VIII. wurde die Mütze um zwei weitere Kronen erweitert. Dieses triregnum symbolisierte den Papst als obersten Priester, als König und Kaiser. Bonifaz trat damit den Gesandten König Albrechts I. entgegen und konfrontierte sie (angeblich) mit dem Satz: „Ich bin der Caesar, ich bin der Imperator.“
KARL UBL