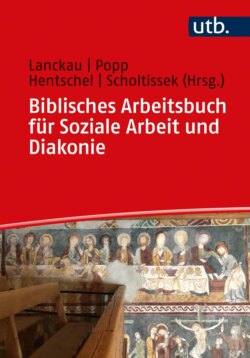Читать книгу Biblisches Arbeitsbuch für Soziale Arbeit und Diakonie - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bedeutung und Rezeptionsgeschichte von "diakonía"
ОглавлениеDas deutsche Lehnwort „DiakonieDiakonie“ kommt vom griechischen Nomen diakonía und seinen Ableitungen, die im Neuen Testament hundert Mal belegt sind. Sie werden in deutschen Bibeln v.a. mit „DienstDienst“, „Versorgung“ oder „AmtAmt, Ämter“ übersetzt. Die Wortgruppe steht im Altgriechischen neben weiteren Dienstbegriffen wie z.B. dem SklavendienstSklavendienst (douleía), der Verehrung oder FürsorgeFürsorge (therapeía) oder dem öffentlichen Dienst (leitourgía), die jeweils ihr eigenes, spezifisches Bedeutungsspektrum haben. Die verbreitete Übersetzung all dieser Begriffe mit „Dienst“ lässt die zwischen ihnen vorhandenen Bedeutungsunterschiede in deutschen Bibelübersetzungen nicht deutlich werden. Da Sklav*innenSklav*innen in der Antike rechtlos waren und zum Eigentum zählten, stellt der Sklavendienst zum Beispiel eine grundsätzlich verachtete Form des Dienstes dar. Kein freier Mensch wollte wie ein Sklave anderen Menschen dienen müssen oder gar – zum Beispiel aufgrund von Überschuldung – selbst zum Sklaven oder Sklavin werden. Wenn vermögende Bürger (selten Bürgerinnen) jedoch mit einer „Liturgie“ das öffentliche Leben unterstützten und zum Beispiel den Unterhalt eines Gymnasiums oder eine kulturelle Veranstaltung ermöglichten, so vergrößerte diese oft als finanzielle Zuwendung gestaltete Dienstleistung ihr Ansehen. Eine Übersetzung mit „Dienst“ oder „Dienen“ für die Wortgruppe diakonía ist zwar semantisch richtig und bei den meisten klassisch-griechischen oder biblischen Belegstellen problemlos möglich, gibt jedoch das spezifische Bedeutungsspektrum des griechischen Begriffs oft nur unzureichend wieder.
In der SeptuagintaSeptuaginta ↗︎ LXXLXX finden sich nur sieben Belege dieser Wortgruppe in späten Texten (Est 1,10Est1,10; 2,2Est2,2; 6,3.5Est6,3.5; 1Makk 11,581Makk11,58; 4Makk 9,174Makk9,17; Spr 10,4Spr10,4; → 1.2 Was ist die Bibel?). Deshalb lässt sich der alttestamentliche Wortgebrauch für das Verständnis der neutestamentlichen Wortverwendung nicht auswerten. Der jüdisch-hellenistischeHellenismus, hellenistisch Historiker Josephus (ca. 37–100 n. Chr. ↗︎ HellenismusHellenismus, hellenistisch) verwendet die Wortgruppe jedoch relativ oft, wiederholt auch in Paraphrasen der hebräischen biblischen Texte. Wortstatistische Untersuchungen zeigen, dass diakonía und seine Ableitungen in den Schriften der klassisch-griechischen und auch der jüdisch-hellenistischen Literatur von Verfasser zu Verfasser unterschiedlich häufig verwendet werden, was vermutlich mit den sprachlichen Vorlieben der jeweiligen Übersetzer*innen oder Autor*innen zusammenhängt.
Die Arbeiten von Wilhelm Brandt (1931) und vor allem von Hermann W. Beyer (1935) haben ein Begriffsverständnis von diakonía geprägt, das für das Diakonieverständnis im 20. Jh. einflussreich wurde. Neuere Arbeiten zur Semantik von John N. Collins (1990) und Anni Hentschel (2007) stellen diese Deutung jedoch in Frage und haben eine Diskussion um die Interpretation der neutestamentlichen Wortverwendung ausgelöst, die weit über die Übersetzung neutestamentlicher Belege hinausgeht und das Diakonieverständnis insgesamt betrifft.
Hermann Wolfgang Beyer (1935) sah im Tischdienst – verstanden als eine niedrige Frauen- oder Sklavenarbeit – die Grundbedeutung von diakonía. Davon leitete er ein allgemeines Verständnis von diakonía im Sinne eines Dienstes ab, der oft zugunsten anderer zu deren Versorgung geleistet werde und üblicherweise aus einer untergeordneten oder niedrigen Position heraus geschehe. Im Neuen Testament werde diese Wortverwendung weiter entwickelt zu einem Verständnis des selbstlosen Dienstes an den Nächsten. Diesen zur Selbsthingabe bereiten Liebesdienst an den Nächsten sah er vorbildlich von Jesus verwirklicht, der nach Mk 10,45Mk10,45 gekommen ist, „nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen (diakonéō) und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben“. Auf dieser Grundlage interpretierte Beyer die Wortverwendung von diakonía im Neuen Testament als eine spezifisch christliche, die den DienstDienst im Sinne eines selbstlosen Liebesdienstes gegenüber den Nächsten verstehe. Er grenzte das im Neuen Testament seiner Meinung nach spezifisch christlich geprägte Wortverständnis damit sowohl vom jüdischen als auch vom klassisch-griechischen Sprachgebrauch ab – dort sei diakonía eine minderwertige, verachtete Tätigkeit. Damit hat Beyer die problematische Annahme gesetzt, dass es nur im christlichen Kontext eine selbstlose Hingabe, eine „wahre“ DiakonieDiakonie gebe, während es zur Zeit Jesu und der Entstehung der neutestamentlichen Texte einen vergleichbaren Liebesdienst im griechisch-römischen Kontext nicht und im Judentum nicht mehr gegeben habe. Nach diesem Wortverständnis ist der sich selbst hingebende Liebesdienst das Zentrum und der Maßstab christlicher Lebenspraxis, was sowohl für das Individuum als auch für die christliche Gemeinde gilt. Im Anschluss an Brandt und Beyer entwickelte sich in der protestantischen neutestamentlichen ExegeseExegese ausgehend von 1Kor 12,51Kor12,5 die Überzeugung, dass jedes AmtAmt, Ämter oder EhrenamtEhrenamt in den frühchristlichen Gemeinden nur als (Liebes-)Dienst an der christlichen GemeinschaftGemeinschaft unter Verzicht auf Autorität oder Ehre verstanden werden könne.
Neuere Forschungen zur Wortverwendung von diakonía (COLLINS 1990 und HENTSCHEL 2007) stellen dieses Begriffsverständnis in Frage. Weder kann der Tischdienst als Grundbedeutung angesehen werden, noch bezeichnet die griechische Wortgruppe schwerpunktmäßig Versorgungsleistungen als verachtete DiensteDienst von Frauen oder Sklav*innenSklav*innen. Vergleicht man die Vorkommen der Wortgruppe, die in der klassisch-griechischen und jüdisch-hellenistischenHellenismus, hellenistisch Literatur ebenso wie im Neuen Testament in auffallend vielfältigen Kontexten und Situationen benutzt wird, zeigt sich, dass sie ganz unterschiedliche Tätigkeiten bezeichnen kann, die vor allem von Männern und manchmal auch von Frauen, von Sklav*innen ebenso wie von freien Bürger*innen, von Königen (selten Königinnen) oder Gottheiten durchgeführt werden. Als Gemeinsamkeit zwischen den Belegen lässt sich feststellen, dass es sich oft um Aufgaben handelt, die im Namen eines Dritten oder auch angesichts einer besonderen Situation erledigt werden. Wenn zum Beispiel eine MahlzeitMahlzeiten besonders feierlich sein soll, verrichten gerade nicht die Sklav*innen oder anderes Dienstpersonal den Tischdienst, sondern der Gastgeber bzw. die Gastgeberin oder deren Familienmitglieder oder auch eigens für diesen Anlass beauftragte diákonoiDiakon*in (vgl. z.B. Philo, Über das kontemplative Leben 70–75; Lukian Saturnalia 17f; Lk 10,40Lk10,40; Joh 12,2Joh12,2). Wenn die Überbringung z.B. von Geldspenden, Botschaften oder auch Strafen erforderlich ist, kann man vertrauenswürdige Personen, zum Teil auch Institutionen, als diákonoi einsetzen (vgl. Apg 11,29Apg11,29; 12,25Apg12,25; 20,24Apg20,24; Röm 13,4Röm13,4; 2Kor 3,62Kor3,6; 5,182Kor5,18; vgl. Testament Abrahams Rez. A 9Testament AbrahamsRez. A 9; Philo, Über den Dekalog, 177). Je nach Auftraggeber und Inhalt der Beauftragung kann die Tätigkeit mit mehr oder weniger VerantwortungVerantwortung, Autorität und Ansehen verbunden sein. Deshalb ist diakonía geeignet, unterschiedlichste Aufgaben als Beauftragungen zu beschreiben, deren konkreter Inhalt sich erst durch die Situation oder den literarischen Kontext erschließt. Diese eher funktionale Wortverwendung lässt sich sowohl in antiken griechischen Texten als auch bei den hundert neutestamentlichen Belegen beobachten. Im Neuen Testament werden zum Beispiel die Verkündigungstätigkeit im Namen Gottes oder Christi (Röm 11,13Röm11,13; 2Kor 5,182Kor5,18; 6,32Kor6,3), alle Aufgaben in der christlichen Gemeinde (1Kor 12,61Kor12,6; Apg 12,1–6Apg12,1–6), die grundlegende, oft auch als ApostolatApostolat (Sendung) bezeichnete Mission im Namen Christi (Apg 1,25Apg1,25; 20,24Apg20,24; Röm 11,13Röm11,13; 12,7Röm12,7; 2Kor 11,13–15.232Kor11,13–15.23) sowie Botengänge z.B. zur Überbringung der Kollekte im Namen der spendenden Gemeinden (Apg 11,29Apg11,29; 12,25Apg12,25; 2Kor 8,42Kor8,4; 9,1.12f2Kor9,1.12f; vgl. 2Kor 8,19f2Kor8,19f) als diakonía bezeichnet. Die Wortgruppe findet sich weder in der Briefliteratur noch in der Apostelgeschichte im Kontext von Abendmahl oder GottesdienstGottesdienst. Abgesehen von Apg 6,1f wird die Wortgruppe nur in den Evangelien für die Aufwartung bei Tisch verwendet, wobei der lukanischen Vorliebe für Mahlszenen wirkungsgeschichtlich eine besondere Bedeutung zukommt (Mt 8,15Mt8,15 ⫽ Mk 1,31Mk1,31; Lk 4,39Lk4,39; 12,37Lk12,37 (2x); Lk 17,8Lk17,8; Lk 22,27Lk22,27 (2x); evtl. auch Mt 4,11Mt4,11 ⫽ Mk 1,13Mk1,13). Apg 6,1–6Apg6,1–6 zur Einsetzung der Sieben dürfte der Text sein, der die Vorstellung von Armenhelfern in den frühchristlichen Gemeinden am meisten geprägt hat, doch bezüglich der Wortverwendung bleibt nur die nüchterne Feststellung, dass die Sieben in der Apg nicht als diakonoi bezeichnet werden und dass in Apg 6,1–6Apg6,1–6 zudem von zwei Arten von diakonía gesprochen wird: einmal mit Bezug auf die Tische (Apg 6,1fApg6,1f) und einmal mit Bezug auf die Wortverkündigung (Apg 6,4Apg6,4; vgl. Apg 1,17.25Apg1,17.25; 20,24Apg20,24; 21,19Apg21,19).
Nach diesem Wortverständnis beschreibt diakonía auch im Neuen Testament unterschiedliche Tätigkeiten als DiensteDienst im Sinne einer Beauftragung, charakterisiert diese aber nicht automatisch als (Liebes-)Dienst an den Nächsten. Nur wenn Personen wie in Apg 6,1fApg6,1f explizit mit karitativen Tätigkeiten beauftragt werden, handelt es sich in dieser Situation um eine karitativ ausgerichtete Dienstleistung. Das Lehnwort „DiakonieDiakonie“, das im Sinne der praktischen NächstenliebeNächstenliebe verstanden wird, nimmt zwar ein wichtiges Anliegen der neutestamentlichen Texte auf, kann sich nach dieser Interpretation aber nicht auf das Bedeutungsspektrum und die Vorkommen des griechischen Begriffs diakonía und seinen Ableitungen im Neuen Testament berufen. Dem entspricht, dass in neutestamentlichen Texten, die von karitativem Engagement handeln, die Wortgruppe in der Regel nicht verwendet wird – nur zwei der hundert Belege beziehen sich auf karitative Tätigkeiten (vgl. Mt 25,44Mt25,44; Apg 6,1fApg6,1f), wo Menschen explizit zur Barmherzigkeit beauftragt oder zur Rechenschaft gezogen werden. Bei der – karitativ motivierten – Kollektensammlung der paulinischen Gemeinde für Jerusalem bezeichnet diakonía wohl die Überbringung der Geldspende (Röm 15,25.31Röm15,25.31; 2 Kor 8,42Kor8,4.19f.19f; 9,1.12f2Kor9,1.12f; vgl. Apg 11,29Apg11,29; 12,25Apg12,25), während das karitative Engagement der spendenden Gemeinden im Begriff „Gnade“ bzw. Gnadengabe“ (cháris 2 Kor 8,4.6f.192Kor8,4.6f.19) enthalten ist, die in der Gnade Christi ihr Vorbild findet (2 Kor 8,92Kor8,9).
Angesichts dieses differenzierten Befunds lässt sich von den vielfältig verwendeten neutestamentlichen Belegen von diakonía nicht einfach auf das eine neutestamentliche Diakonieverständnis schließen, auch wenn dies in manchen diakoniewissenschaftlichen Ansätzen zum Beispiel im Sinne einer prophetischen DiakonieDiakonie oder im Sinne einer vermittelnden, kommunikativen Diakonie kreativ und mit wichtigen Anregungen diskutiert wird.