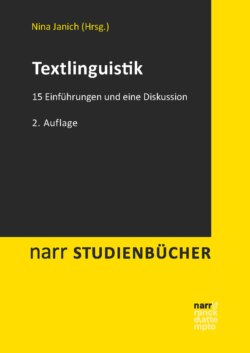Читать книгу Textlinguistik - Группа авторов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Text und Typik von Texten
ОглавлениеDas bisher als letztes in die Diskussion eingebrachte Feld von Wissensbeständen, das sich konzentrisch an das bisherige Textwissen anlagert, ist das Wissen um Textsorten in ihrer kulturellen Geprägtheit. Wissenschaftsgeschichtlich ist interessant, dass sich das Interesse von der Auseinandersetzung mit dem Wesen des ‚Textes an sich‘ immer mehr auf die Frage nach den Möglichkeiten der Klassifizierung von Texten, nach Textsorten also, verlagerte. Die pragmatische und später auch die kulturwissenschaftliche „Wende“ waren die Ursache, dass sich das Interesse von der Wesensbestimmung des Textes zunehmend auf den Text in seinen kommunikativen und kulturellen Zusammenhängen verlagerte (kritisch dazu Kap. 6), was folgerichtig die Frage nach der Typik, in der Texte auftreten, mit sich brachte, die Frage nach Sorten von Texten und ihrer Klassifizierung und nach ihrer kulturellen Geprägtheit (Fix/Habscheid/Klein 2001, Fix 2002). Der alltagssprachliche Kulturbegriff, der hier gemeint ist, bezieht sich darauf, dass die Mitglieder einer Kulturgemeinschaft für das im Sinne ihrer Gemeinschaft existenziell nötige Miteinanderhandeln, zu dem natürlich auch Kommunizieren gehört, Formen, Muster und Routinen entwickelt haben, auf die alle zurückgreifen können und müssen, wenn Zusammenleben gelingen soll. Zu den kommunikativen Mustern, die die Gemeinschaft entwickelt hat, um miteinander leben zu können, gehören neben nicht-sprachlichen Formen, wie z.B. Mimik und Gestik, auch die sprachlichen, d.h. auch Textsorten einer jeweiligen Kultur mit ihrer typischen Form, ihrem vereinbarten Weltbezug und ihrer Funktion, ihrem spezifischen „Zugriff“ auf das Leben. Zur Lösung bestimmter Probleme stehen bestimmte Textsorten zur Verfügung. Für die Erfüllung eines Bedarfs, also für die Formulierung einer Bitte z.B., stehen uns je nach HandlungsbereichHandlungsbereich formelhafte Antragstexte im institutionellen Verkehr, das Petitionsschreiben in der Politik und das Gebet im religiösen Bereich zur Verfügung. Zur Verdeutlichung: Textsorten – wie andere Routinen des Handelns auch – beruhen in zweierlei Hinsicht auf kulturellen Übereinkünften. Von der ersten war schon die Rede. Es geht darum, dass bereits die Tatsache der Existenz des Phänomens Textsorte an sich, das Faktum also, dass Kultur- und Kommunikationsgemeinschaften über die Textsorte als eine wichtige und komplexe Art von Handlungsroutine verfügen, ein im oben beschriebenen Sinne (alltags)kulturelles Phänomen ist. Sie haben also grundsätzlich einen kulturellen Status. Im konkreten Fall der Beschäftigung mit einer bestimmten Textsorte hat man zusätzlich die einzelkulturelle Spezifik der jeweiligen Textsorte zur Kenntnis zu nehmen. Konkrete Textsorten sind einzelkulturelle Übereinkünfte, von der jeweiligen Kultur, in der sie entstanden sind, geprägt. So gibt es in der Realität des Sprechens nicht ‚Textsorten an sich‘, sondern spezifische, von einer oder auch von mehreren Kulturen gemeinsam geprägte. Diese Prägung kann verschiedene Aspekte betreffen. Sie kann sich inhaltlich auswirken, aber auch funktional und formal. Zum Wissen über Textsorten gehört also auch Wissen über Traditionen von Texten und über deren kulturelles Prestige und dessen Wandel (Whatsapp gilt als attraktiv, der handschriftliche Brief weniger) sowie über den Wert des MediumsMedium (geschriebenen Texten wird mehr Wert zugebilligt als gesprochenen, siehe 1.6 und allgemein dazu Kap. 8). Hat man dies alles im Blick, wird man sich fragen müssen, ob nicht dieser Ring von Wissen, der sich als weitester um die anderen schon beschriebenen Wissensbestände legt, konstitutiv ist für den Textcharakter und man nicht das zusätzliche Kriterium der KULTURALITÄTKulturalität ansetzen sollte.
Interessant ist in diesem Kontext auch das Konzept der mündlichen ‚kommunikativen GattungenGattung‘, denen zugeschrieben wird, „historisch und kulturell spezifische, gesellschaftlich verfestigte Lösungsmuster für strukturelle kommunikative Probleme“ zu sein. Man kann dazu nachlesen bei Bergmann/Luckmann (1993) und Günthner (2000).