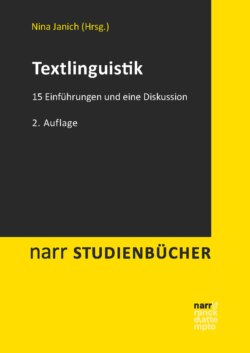Читать книгу Textlinguistik - Группа авторов - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung (1. Auflage 2008)
ОглавлениеNina Janich
Die Idee für eine Einführung in die Textlinguistik, deren Kapitel von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren geschrieben werden, die also sozusagen aus 15 Einzeleinführungen renommierter Textlinguistinnen und Textlinguisten besteht, entstand im Rahmen einer Ringvorlesung an der Technischen Universität Darmstadt im Wintersemester 2006/2007 (finanziell großzügig unterstützt von der AG „Modernes Lehren und Lernen“ der TU Darmstadt). Ich hatte in diesem Semester eine Textlinguistik-Vorlesung „mit lebendiger Bibliographie“ abgehalten, zu der ich zahlreiche der in diesem Buch vertretenen Autorinnen und Autoren eingeladen hatte, selbst über ihre textlinguistischen Forschungen zu berichten. Auf diesem Weg sollten die Studierenden die Möglichkeit haben, ihre Studienlektüre auch einmal „in persona“ kennenzulernen, anstatt nur durch das Referat ihrer Dozentin – denn viele der geladenen und hier vertretenen Forscherinnen und Forscher haben bereits selbst Einführungen in die Textlinguistik verfasst (z.B. Heinemann/Viehweger 1991, Fix/Poethe/Yos 2001, Gansel/Jürgens 22007, Heinemann/Heinemann 2002, Adamzik 2004, Bracˇicˇ u.a. 2007). Zur Ringvorlesung hatte auch der bekannte Textlinguist Klaus Brinker (auf den in vielen der vorliegenden Beiträge verwiesen wird) zugesagt, er verstarb jedoch leider nach kurzer schwerer Krankheit kurz vor Semesterbeginn – ihm sei die Einführung daher gewidmet.
Die Vorlesung profitierte ungemein nicht nur von der Lebendigkeit ihrer Beiträgerinnen und Beiträger, die in einem solchen Buch natürlich nicht vermittelt werden kann, sondern auch von der Vielfalt der Perspektiven, so dass die Idee entstand, diese Perspektivenvielfalt in einer Art „Sammeleinführung“ zusammenzubringen. Das bedeutet allerdings auch, dass kontroversen Ansichten Raum gegeben wurde und die in den einzelnen Kapiteln vertretenen Positionen einander widersprechen können (vgl. z.B. die Kapitel 6 und 8 und ihre unterschiedliche Einschätzung der Relevanz der mündlich-schriftlich-Kategorie für Texttypologisierungen oder die unterschiedlichen Diskursbegriffe in den Kap. 2 und 8).
Die vorliegende Einführung versucht, erstens einen klassischen Überblick über die textlinguistische Forschung der letzten vierzig Jahre sowie über aktuelle theoretische und methodische Fragen der Textlinguistik zu bieten und zweitens – handlungs- und anwendungsorientiert und dem aktuellen Fokus auf kognitionslinguistischen Ansätzen folgend – Einblicke in Problemstellungen der Textproduktion und Textrezeption zu geben. Dies alles tut sie nicht im Stile eines klassischen Sammelbandes mit völlig autonomen Beiträgen, wie er beispielsweise von Gerd Antos und Heike Tietz vor gut zehn Jahren mit „Die Zukunft der Textlinguistik. Traditionen, Transformationen, Trends“ (1997) vorgelegt wurde. Stattdessen haben wir versucht, in Form von vielfach aufeinander bezogenen Kapiteln gemeinsam ein Buch zu schreiben, das sich in Studium und wissenschaftlicher Lehre als eine Einführung lesen lässt, auch wenn eine gewisse Heterogenität bei insgesamt 18 verschiedenen Autorinnen und Autoren mit unterschiedlichen inhaltlichen Anliegen und Schreibstilen nicht geleugnet werden soll.
Als zentrales Problem eines solchen Konzepts (für die Textsorte Einführung!) erwies sich – nicht verwunderlich – der zugrunde gelegte Textbegriff, der dementsprechend auch von Kapitel zu Kapitel etwas variieren kann. Der Begriff des Textes selbst ist Gegenstand des ersten einführenden Kapitels von Ulla Fix und des sechsten Kapitels von Kirsten Adamzik im Rahmen der Grobdifferenzierung von Textsorten, unter der Perspektive von Mündlichkeit und SchriftlichkeitSchriftlichkeit diskutiert im 7. Kapitel von Peter Koch und Wulf Oesterreicher sowie am Phänomen des HypertextsHypertext problematisiert dann noch einmal im Kapitel 14 von Angelika Storrer. Ansonsten lässt sich die Frage des Textbegriffs für die vorliegende Einführung etwas pointiert auf die Feststellung verkürzen, dass insgesamt der konventionelle Begriff des sprachlichen, medial schriftlichen und linear aufgebauten Textes dominiert, dass aber beispielsweise mündliche Formen wie GesprächeGespräch in den Textbegriff der einzelnen Autorinnen und Autoren ebenso eingeschlossen sein können (z.B. ganz explizit in den Kapiteln 3, 5, 8 und 9, problematisiert auch in Kapitel 6) wie visuelle Bestandteile oder Teiltexte und damit das Textualitätsmerkmal der MultimedialitätMultimedialität (wie in den Kapiteln 1, 7, 13 oder 14). Diesen Dimensionen des Textbegriffs konnten jedoch aus Gründen des Umfangs keine spezifischen Kapitel gewidmet werden (also z.B. zu Gesprächssorten und Gesprächsanalyse (siehe Knapp nur unter 5.5) oder zu einem semiotischen Textverständnis und Text-Bild-BeziehungenText-Bild-Beziehung).
Wer sich für die Frage der Textdefinition – insbesondere im Zeitalter der neuen Medien – interessiert, dem sei zum einen ein Aufsatz von Maximilian Scherner (1996) zur Begriffsgeschichte von Text empfohlen und zum anderen der Sammelband von Ulla Fix u.a. (2002) zur linguistischen Preisfrage „Brauchen wir einen neuen Textbegriff?“ (darin zum Beispiel die von Michael Klemm zusammengestellte Sammlung von Textdefinitionen oder die Diskussion der Preisträgerin Eva Martha Eckkrammer).