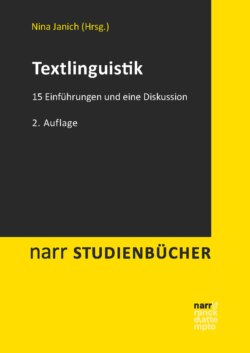Читать книгу Textlinguistik - Группа авторов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Richtungen und Akzentuierungen der Diskurslinguistik 2.2.1 Textualistische und epistemologische Diskurslinguistik
ОглавлениеUnter DISKURS wollen wir im Weiteren präzisiert einen textübergreifenden Verweiszusammenhang von thematisch gebundenen Aussagen verstehen (vgl. Busse/Teubert 1994 und Warnke 2007). Die Diskurslinguistik befasst sich mit diesem Gegenstand einerseits unter dem Gesichtspunkt der textübergreifenden Zeichenorganisation und andererseits mit Blick auf das im Diskurs manifeste gesellschaftliche Wissen. Wir sprechen daher von einer textualistischen Ausprägung der Diskurslinguistik, sofern die sprachstrukturelle Organisation von Aussagen in textübergreifenden Verweiszusammenhängen wissenschaftlicher Gegenstand ist. Sofern sprachlich manifestiertes Wissen Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses ist, kann von einem epistemologischen Diskursbegriff gesprochen werden.
1 Die textualistische Diskurslinguistik versteht sich als erweiterte Textlinguistik und lässt sich relativ leicht in das System der Linguistik einordnen. Hier werden intertextuelle Verweise und thematisch-funktionale Übereinstimmungen von Texten im Diskurs untersucht und beschrieben. Wir können auch sagen, dass die textualistische Diskurslinguistik Gebrauchsformationen von Sprache untersucht, also die Art und Weise, wie jenseits singulärer Texte Sprache verwendet wird. Mit Methoden der KorpuslinguistikKorpuslinguistik werden hier sprachliche Phänomene der Diskursrepräsentation beschrieben, also wiederkehrende Muster erfasst.
2 Demgegenüber nutzt die epistemologische Diskurslinguistik die Analyse textübergreifender Aussagenzusammenhänge, um Erkenntnisse über zeittypische Formationen des Sprechens und Denkens über die Welt gewinnen zu können. Kurz, es geht um das Wissen einer Zeit. Man fragt sich hier, was man wann und wie sagen kann, und wie über das Sagen die Welt überhaupt erst erfahrbar wird. Das sprachlich verankerte Wissen erscheint nicht zuletzt als Ausdruck von Haltungen und Einstellungen, von sprachlichen Routinen, von Macht und Regulierung. Der Diskurs reguliert immer auch, wer eine Stimme erhält, wer schweigen muss.
Beide Ausprägungen der Diskurslinguistik beziehen sich mehr oder weniger erkennbar auf den französischen Philosophen Michel Foucault (1926–1984). Insbesondere in der epistemologischen Diskurslinguistik, also mit dem Interesse an zeittypischen Formationen des Sprechens und Denkens über die Welt, erfolgt die sprachwissenschaftliche Aneignung der Werke Foucaults. So zielt etwa die diskurslinguistische Analyse so genannter Argumentationstopoi (vgl. Wengeler 2003) auf die Freilegung des impliziten Wissens einer Gesellschaft, das mit Foucault als anonyme Formation des Denkens über die Dinge verstanden wird. Der Diskurs ist hier eine Repräsentation von Topoi oder Schemata. Wir verstehen darunter schematisierte Formen des Sprechens und Meinens. In diesem Verständnis ist Diskurslinguistik letzthin Teil einer Semantik, die verstehensrelevantes Wissen einer Zeit rekonstruiert. Etwas komplexer ausgedrückt kann man auch von einer epistemischen Funktion sprechen. Die in den Blick genommenen Wissensbestände – etwa über Sexualität, Religion oder menschliches Zusammenleben – werden als Effekte von Aussagen beschrieben.
Textualistische und epistemologische Diskurslinguistik sind in der Forschungspraxis kaum zu trennen, ihre Abgrenzung ist eher theoretischer Art. Denn auch eine wissensbezogene Analyse von Diskursen wird, sofern sie linguistisch organisiert ist, die strukturellen Konstituenten des Diskurses in den Blick nehmen und mit Texten arbeiten. Folglich gilt die Analyse von Korpora auch als gängige Praxis aller diskurslinguistischen Arbeiten.