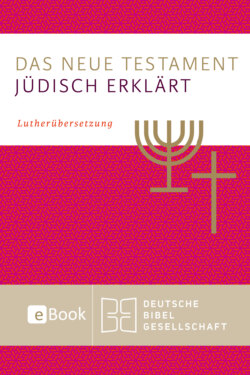Читать книгу Das Neue Testament - jüdisch erklärt - Группа авторов - Страница 49
ОглавлениеMarkus 7
1 Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. 2 Und sie sahen, dass einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen das Brot aßen. 3 Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben, und halten so an der Überlieferung der Ältesten fest; 4 und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich gewaschen haben. Und es gibt viele andre Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie: Becher und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. 5 Da fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten: Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen?
6 Er aber sprach zu ihnen: Richtig hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht (Jesaja 29,13): »Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. 7 Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote.« 8 Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. 9 Und er sprach zu ihnen: Trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferung aufrichtet! 10 Denn Mose hat gesagt (Exodus 20,12; 21,17): »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren«, und: »Wer Vater oder Mutter schmäht, der soll des Todes sterben.« 11 Ihr aber lehrt: Wenn einer zu Vater oder Mutter sagt: Korban[*], das heißt: Opfergabe, soll sein, was dir von mir zusteht, 12 so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter 13 und hebt so Gottes Wort auf durch eure Überlieferung, die ihr weitergegeben habt; und dergleichen tut ihr viel.
14 Und er rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und begreift‘s! 15 Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte; sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist‘s, was den Menschen unrein macht.[*]
17 Und als er von dem Volk ins Haus ging, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. 18 Und er sprach zu ihnen: Seid denn auch ihr so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? 19 Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. 20 Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. 21 Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, 22 Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. 23 All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein.
Mk 7,1–23 Das Waschen der Hände und das Gebot Gottes (Mt 15,1–20) Die Regelungen der Tora bezüglich des koscheren Essens, der rituellen Reinheit und der Beschneidung der Männer waren umstrittene Themen unter den Anhängern Jesu (vgl. Apg 15,19–20). 7,2 Unrein, vgl. „Das Mosegesetz“ und Anm. zu 1,40–45. 7,3–4 Die Erklärung dieser Praktiken könnte ein Hinweis dafür sein, dass Markus nichtjüdische Leserinnen und Leser anspricht; Matthäus (Mt 15,2) lässt die Erklärung aus; bei Lukas und Johannes fehlt die gesamte Erzählung. Die Pharisäer befolgten die Überlieferungen der Ältesten, die das Waschen der Hände einschloss (eine Observanz, die das Übertragen der Heiligkeit des Tempels in familiären Kontext voraussetzen könnte), aber nicht alle Juden praktizierten dies (die Sadduzäer beispielsweise nicht). 7,6–8 Jes 29,13. Markus erkennt Gottes Gebot[e] zwar an, aber es entstehen Streitigkeiten, welche davon verbindlich bleiben (V. 9) und welche nur eine Tradition sind. Heuchler, dieser Begriff aus dem griechischen Drama bezeichnet eine Person, die ihre Rolle spielt; hier steht er für Menschen, die nur den Anschein von Rechtschaffenheit haben (Mk 12,15; Mt 23; Did 8,1). Wie in Mk 2,25–26 gibt es mehrere Antworten auf die Provokation. 7,11 Die Auseinandersetzung besteht zum einen darin, welches der Gebote – das Ehren der Eltern oder das Einhalten von Eiden – den Vorrang hat, und zum anderen in der Frage, ob Eide zurückgenommen werden können. Die Mischna (mNed 9,1) berät darüber, ob man „jedermann einen Ausweg [zur Reue] […] öffnen“ darf (d.h. die Erlaubnis geben, einen Eid auszusetzen, sollte er zu einem Konflikt mit etwas Wichtigerem führen). Korban, hebr. qorban, ein Opfer oder Geschenk an Gott. Sobald etwas Gott gewidmet wurde, war es dem Spender im Allgemeinen nicht mehr möglich, das Geschenk zurückzunehmen. Die rabbinische Tradition erlaubte eine Befreiung vom qorban auch dann, wenn es Eltern der Dinge beraubte, die ihnen rechtmäßig zustanden. 7,14–15 Jesu Kommentar ist überspitzt, humorvoll und geradezu anstößig (wie V. 18–23 verdeutlichen). Die originelle Erwiderung wird nun wie eine Sonderoffenbarung behandelt: Hört […] und begreift‘s (V. 14) und Gleichnis (V. 17); vgl. Anm. zu 4,10–12. 7,17–23 Wie die anderen Gleichnisse, bedarf auch dieses einer Interpretation. 7,19 Damit erklärte er alle Speisen für rein, wörtl. „reinigte er alle Nahrung“. Die erste der oben genannten Problemstellungen – das Essen mit ungewaschenen Händen – wird hier ausgeweitet auf die Aufhebung der gesamten Kaschrut. Obwohl es möglich ist, dass die Erklärung die markinische Deutung einer Aussage Jesu ist (die sich auch in Röm 14,20 findet), ist dies eher unwahrscheinlich. Die Kontroverse über die Tora unter der frühen Gefolgschaft Jesu (z.B. Gal 1–2) wäre nicht so intensiv geführt worden, wäre bekannt gewesen, dass er die Kaschrut für nichtig erklärt hatte. Vielmehr könnte die Aussage eine ältere, jüdisch-apokalyptische Tradition widerspiegeln, die sich auf die Beseitigung von Unreinheit am Ende der Zeit bezieht (Sach 14,20–21; vgl. auch Anm. zu 1,40–45). 7,21–23 Die Liste des Bösen, das von innen kommt, beinhaltet sowohl Übertretungen des Dekalogs als auch geringere Sünden.
24 Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben; 25 sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen – 26 die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien – und bat ihn, dass er den Dämon aus ihrer Tochter austreibe. 27 Jesus aber sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden; denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. 28 Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Herr, aber doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. 29 Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. 30 Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen, und der Dämon war ausgefahren.
Mk 7,24–30 Die syrophönizische Frau (Mt 15,21–28) 7,26 Griechin, die Herkunftsbezeichnung steht hier als allgemeiner Begriff für nichtjüdisch. Syrophönizien, Phönizier aus Syrien und nicht aus Nordafrika. Die Frau steht in der Tradition der rechtschaffenen Nichtjuden wie Rut, die Moabiterin, Achior, der Ammoniter (Judit), oder die Handwerker aus den phönizischen (kanaanäischen) Städten Sidon und Tyrus (1Kön 5,1–12). Elia und Elisa haben auch Nichtjuden geheilt (1Kön 17,8–16; 2Kön 5,1–14). Die Syrophönizierin repräsentiert vielleicht die nichtjüdischen Konvertiten, die an Jesus als den Herrn glaubten. 7,27–29 Hunde, eine verbreitete Beleidigung; Hunde wurden als unrein und dreist betrachtet (Offb 22,15); die Frau dreht den Spieß um, indem sie diese Beleidigung bildlich auf sich nimmt.
31 Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. 32 Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. 33 Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge 34 und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hefata!, das heißt: Tu dich auf! 35 Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und er redete richtig.
36 Und er gebot ihnen, sie sollten‘s niemandem sagen. Je mehr er‘s ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. 37 Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.
Mk 7,31–37 Die Heilung eines Tauben (Mt 15,29–31) Manche rabbinische Quellen behandeln einen Gehörlosen (cheresch) ähnlich wie einen Minderjährigen (hebr. qatan) oder eine psychische kranke Person (schote); solche Menschen wurde nicht für mündig gehalten, das Gesetz einhalten zu müssen (bJev 99b). 7,33–34 Spuckte […] berührte […] seufzte, Jesu Heilungen wurden wurde gewöhnlich durch das Wort allein vollbracht, aber hier und in Mk 8,23 tritt ein physischer Kontakt hinzu. Hefata, vgl. Anm. zu 5,41. 7,36 Markus hebt den ironischen Gegensatz zwischen dem Messiasgeheimnis und dem Drängen der Nachfolgenden hervor. 7,37 Ein Zitat von Jes 35,5–6 über die ideale Zukunft; an anderer Stelle (Ex 4,11) hat nur Gott die Macht, Stumme zum Reden 0zu bringen.
Markus 8
1 Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: 2 Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. 3 Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen. 4 Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? 5 Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben. 6 Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. 7 Sie hatten auch einige Fische; und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. 8 Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. 9 Es waren aber etwa viertausend; und er ließ sie gehen.
10 Und alsbald stieg er in das Boot mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta. 11 Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. 12 Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden! 13 Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr ans andere Ufer.
Mk 8,1–10 Die Speisung der Viertausend (Mt 15,32–39). Dieses zweite Speisungswunder findet in einem vorwiegend nichtjüdischen Gebiet statt (vgl. Anm. zu 6,30–44). Während des Exodus gab es zwei Begebenheiten, an denen eine Speisung in der Wüste stattfand (Ex 16; Num 11). 8,5 Sieben, könnte Vollkommenheit symbolisieren, wie die Tage der Schöpfung (Gen 1) oder die Fülle des Lobpreises („Ich lobe dich des Tages siebenmal“, Ps 119,164).
Mk 8,11–13 Die Pharisäer fordern ein Zeichen (Mt 12,38–39; 16,1–4; Lk 11,16.29) 8,11 Zeichen, gr. sēmeion, hebr. ’ot; die Handlung eines Propheten, die beglaubigt, dass er von Gott gesandt wurde; Josephus beschreibt, dass Endzeitpropheten häufig solche Nachweise erbrachten (Ant. 20,167–70). Zeichen sind ein verbreitetes Motiv in der Hebräischen Bibel, weshalb die Anfrage der Pharisäer angemessen erscheinen könnte. Markus beschreibt Jesu Wunder eher als „Machttaten“ (gr. dunameis), weniger als Zeichen; vgl. Mk 13,22, im Gegensatz dazu Joh 2,11; 4,54. In der Hebräischen Bibel werden Zeichen teilweise missachtet (z.B. Ex 4,8.9); Gott bietet sie als Anzeichen von Verheißungen an (Ri 6, wo Gideon drei Zeichen erhält; Jes 7,11–14, wo der König Bedenken hat und dennoch ein Zeichen erfährt).
14 Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen, und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. 15 Und er gebot ihnen und sprach: Merkt auf, seht euch vor vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. 16 Und sie überlegten hin und her, weil sie kein Brot hatten. 17 Und er merkte das und sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht, und begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? 18 Habt ihr Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran: 19 Als ich die fünf Brote brach für die fünftausend, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten: Zwölf. 20 Und als ich die sieben brach für die viertausend, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten: Sieben. 21 Und er sprach zu ihnen: Begreift ihr denn noch nicht?
Mk 1,16–8,21 Die Verwirklichung des Reiches Gottes
Mk 8,14–21 Der Sauerteig (die Hefe) der Pharisäer und des Herodes (Mt 16,5–12; Lk 12,1). Pharisäer […] Herodes, vgl. Einleitung. Sauerteig, hebr. chamez, bzw. Hefe; ein Teig aus Weizen, Gerste, Dinkel, Roggen oder Hafer, der mit Wasser vermischt wurde und solange zog, bis er durchsäuert war. An Pesach wird dieser Teig nicht gegessen (Ex 12,39); wer ihn dennoch verzehrt, „soll ausgerottet werden“ (Ex 12,19). Hefe und Honig sind nicht als Teile des Speiseopfers erlaubt (Lev 2,11). Obwohl sie hier negativ betrachtet werden, gelten sie aber nicht als „unrein“. 8,18 Augen […] seht […] Ohren […] hört, steht sprichwörtlich für die Nichtbeachtung des Wortes Gottes (Jes 6,9–10; Jer 5,21) aber auch ein Kennzeichen von Götzen (Ps 115,3–8).
22 Und sie kamen nach Betsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. 23 Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: Siehst du etwas? 24 Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. 25 Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. 26 Und er schickte ihn heim und sprach: Geh aber nicht hinein in das Dorf!
Mk 8,22–26 Die Heilung eines Blinden (Joh 9,1–7) 8,22 Betsaida, am oberen Ende des Galiläischen Meeres, im Hoheitsgebiet von (Herodes) Philippus, einem der Söhne von Herodes dem Großen, der von 4 v.u.Z. bis 34 u.Z. geherrscht hat. Philippus errichtete die Stadt wieder und gab ihr den Namen „Betsaida Julias“, benannt nach Julia, einer der Töchter von Augustus. Matthäus und Lukas lassen diese Episode aus, vielleicht weil hier Jesu Unvermögen, unmittelbar zu heilen, explizit geschildert wird. Diese zweistufige Heilung könnte auch das zweistufige Verständnis der messianischen Identität durch die Jünger erahnen lassen: Den Jüngern fehlt noch eine klare Vorstellung (sie verstehen, dass Jesus der „Messias“ ist, aber sie verstehen nicht, was dieser Begriff bedeutet) und sie begreifen die volle Realität erst nach dem Tod Jesu (und nach dem Ende des Markusevangeliums, vgl. Anm. zu 16,8.).
27 Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer, sagen die Leute, dass ich sei? 28 Sie aber sprachen zu ihm: Sie sagen, du seiest Johannes der Täufer; andere sagen, du seiest Elia; wieder andere, du seiest einer der Propheten. 29 Und er fragte sie: Ihr aber, wer, sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus! 30 Und er bedrohte sie, dass sie niemandem von ihm sagen sollten.
31 Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. 32 Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. 33 Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.
Mk 8,27–33 Das Petrusbekenntnis und Jesu erste Passionsankündigung (Mt 16,13–23; Lk 9,18–22). Markus ordnet die Erwartung des machtvoll erscheinenden Menschensohns der Vorstellung des leidenden und gekreuzigten Menschensohnes unter. Obwohl Jesus bis jetzt von den Pharisäern angefeindet wurde, klang ihre mörderische Absicht nur an einer Stelle an (Mk 3,6). Von jetzt an werden es die Ältesten, Hohenpriester und Schriftgelehrten sein, die Jesus ablehnen und ihn dem römischen Statthalter überliefern, damit er getötet würde. Die Pharisäer tauchen in der Passionserzählung nicht mehr auf, weil sie vielleicht als Gruppe wahrgenommen wurden, die zwar mit den Anhängern Jesu in Konkurrenz stand, aber nicht an seinem Tod mitgewirkt hatte (nur in Mk 3,6 konspirieren die Pharisäer [mit den Herodianern], um ihn umzubringen). 8,27 Cäsarea Philippi, wurde ursprünglich „Panion“ genannt, nach dem Gott Pan, dem dort eine wichtige Kultstätte gewidmet war. Unter Herodes‘ Sohn Philippus wurde die Stadt neu gegründet und erhielt zu Ehren des Kaisers und seiner selbst einen neuen Namen. In der Nähe wurde ein großer Tempel entdeckt, der vermutlich dem Kaiser gewidmet war. Das Gebiet wurde zu einem heiligen Ort für verschiedene Götter, vermutlich weil es nahe einer den Jordan speisenden Quelle sowie unter einem heiligen Berg (Hermon) lag. Dort befand sich der antike israelitische Schrein von Dan. In äthHen 13,7 wird diese Stelle als der Schauplatz beschrieben, an dem Henoch seine Offenbarungen empfing. Nicht nur das Petrusbekenntnis, sondern auch die Verklärung (Mk 9,2–10) wird in diesem Gebiet lokalisiert, das sowohl für Juden als auch für Nichtjuden bedeutsam ist. Der Berg der Verklärung wird zwar nicht benannt, jedoch deutet die textliche Nähe für eine antike Hörerschaft an, dass es sich um den Berg Hermon handelt. Nach der Verklärung und der Heilung in Mk 9,14–29 ziehen Jesus und seine Jünger nach Galiläa und kommen nach Kapernaum (Mk 9,35), das an der nordwestlichen Küste des Galiläischen Meeres unweit der Grenze zur Tetrarchie des Philippus liegt. 8,28–29 Die Jünger sagen, dass Jesus mit prophetischen Gestalten in Verbindung gebracht wurde (Mk 6,15), aber Petrus verkündet, dass er der Christus ist (vgl. Anm. zu 1,1; Mt 16,16–22 bietet ein ausführlicheres Bekenntnis). 8,30–32 Hier wird das Messiasgeheimnis am deutlichsten; Jesus spricht frei und offen darüber, was mit ihm geschehen wird, aber nur zu seinen Jüngern. 8,31 Muss viel leiden, bringt die Vorbestimmtheit von Gottes Plan zum Ausdruck, wie sie auch in apokalyptischen Texten wie Daniel, 4Esr und äthHen zu finden ist. 8,32–33 Vgl. Sach 3,2, wo Gott in Anwesenheit des Hohepriesters Jeschua – im Griechischen Jesus! – Satan mit vergleichbaren Worten schilt. Petrus kann sich einen leidenden und scheiternden Messias nicht vorstellen, während die scharfe Reaktion Jesu diese Perikope als zentralen und entscheidenden Abschnitt des Evangeliums kennzeichnet. Die jüdische Tradition hat häufig über das Leid von guten Menschen nachgedacht (Spr 3,12: „Wen der Herr liebt, den weist er zurecht“; bSan 101a–b), hier aber geht es um die Rolle des Messias. Andere Texte haben sich das Leiden des Messias erklären können, indem sie auf Jes 52,13–53,12 verweisen (Mt 8,17; 1Petr 2,24–25), aber Markus zitiert die Passage nicht, sondern deutet sie in Mk 10,45; 14,12–25 nur an.
34 Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 35 Denn wer sein Leben behalten will, der wird‘s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird‘s behalten. 36 Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? 37 Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse?
38 Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.