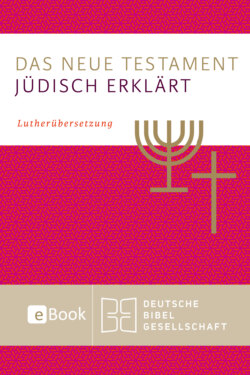Читать книгу Das Neue Testament - jüdisch erklärt - Группа авторов - Страница 54
Die Erfüllung der Schrift
ОглавлениеMarkus hebt einige Ereignisse als Erfüllung von Stellen aus dem Psalter oder dem Buch Jesaja hervor:
Markus AT14,1 Tod durch List Ps 10,7–814,10–11 Verrat Jes 53,6.1214,18 „einer …, der mit mir isst“ Ps 41,914,24 Blut vergossen für viele Jes 53,1214,57 Falsches Zeugnis Ps 27,12; 35,11
14,61; 15,5 Schweigen angesichts der Ankläger Ps 38,12–14? Jes 53,7?
14,65 Anspeien, Schlagen Jes 50,615,5.39 Verwunderung der Völker und Könige Jes 52,1515,6–15 Rettung des Verbrechers, Tod des Gerechten Jes 53,6.1215,24 Aufteilung der Kleider Ps 22,1815,29 Lästerungen und Kopfschütteln Ps 22,7; 109,2515,30–31 „hilf dir nun selber“ Ps 22,815,32 Schmähungen Ps 22,615,34 „Warum hast du mich verlassen?“ Ps 22,115,36 gaben ihm Essig zu trinken Ps 69,21
Diese Bezugnahmen lassen daran zweifeln, dass die Ereignisse, die Markus beschreibt, tatsächlich so stattgefunden haben. Wahrscheinlich wurden sie in die Erzählung eingefügt, um zu untermauern, dass Jesus „in Übereinstimmung mit der Schrift“ (1Kor 15,3–4) starb. Ob tatsächliche Geschehnisse hier im Lichte der Schrift interpretiert werden, ob Markus die Erzählung aus einer Reihe prophetischer Texte erschuf oder ob gar eine Kombination aus beidem vorliegt, bleibt Gegenstand der Diskussion.
3 Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. 4 Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? 5 Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an.
6 Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 7 Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. 8 Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. 9 Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.
10 Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn an sie verriete. 11 Da sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte.
Mk 14,3–11 Die Salbung und Vorhersage des Verrats (Mt 26,6–16; Lk 22,3–6; Joh 12,1–8). Eine Frau salbt Jesus: Die Handlung könnte entweder eine Königssalbung oder die Vorbereitung eines Körpers für die Bestattung darstellen. Die von Paradoxien geprägte Darstellungsweise des Markus könnte auf beides verweisen. Ein weiteres paradoxes Element ist, dass, obwohl sie prophetisch handelt, viele der Anwesenden die Bedeutung ihrer Handlung nicht erkennen und sehr negativ reagieren. 14,3 Alabastergefäß, ein kleines, vermutlich kugelförmiges Behältnis aus geschnittenem, lichtdurchlässigem Gips; um den Inhalt auszugießen, wurde der lange Hals zerbrochen. Narde, die Nardenähre, die in der Region des Himalaya wächst. 14,9 Die Salbung soll zu ihrem Gedächtnis erzählt werden, aber der Name der Frau wird nicht erwähnt. Vielleicht ist die Auslassung ihres Namens programmatisch: Die namenlose „Jedefrau“ versteht Jesus, die namentlich erwähnten Jünger nicht. Sie kann mit dem namenlosen Hauptmann (Mk 15,39) verglichen werden, der Jesu Rolle als Sohn Gottes im Gegensatz zu den Jüngern versteht. Darüber hinaus wird sie den drei namentlich identifizierten Frauen gegenübergestellt, die vergeblich versuchen, Jesus zu salben (Mk 16,1–8), so, wie auch der unbenannte Hauptmann den drei namentlich erwähnten Jüngern gegenübergestellt wird, die in Gethsemane versagen (Mk 14,33). Auch in jüdischen Novellen aus dieser Zeit (Ester, Judit, Susanna, Joseph und Aseneth) rücken weibliche Charaktere in den Mittelpunkt; ebenso wie in griechischen Novellen wurden sie zu wesentlichen Protagonistinnen für die Behandlung religiöser Fragestellungen. 14,10–11 Nur in Joh 12,4–6 wird berichtet, dass Judas derjenige war, der forderte, das Geld den Armen zu geben.
12 Und am ersten Tage der Ungesäuerten Brote, da man das Passalamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passalamm bereiten, damit du es essen kannst? 13 Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser; folgt ihm, 14 und wo er hineingeht, da sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen: Wo ist die Herberge für mich, in der ich das Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? 15 Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der schön ausgelegt und vorbereitet ist; und dort richtet für uns zu. 16 Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden‘s, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm.
17 Und am Abend kam er mit den Zwölfen. 18 Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. 19 Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem andern: Bin ich‘s? 20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. 21 Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht; weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre.
22 Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach‘s und gab‘s ihnen und sprach: Nehmet; das ist mein Leib. 23 Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus. 24 Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes[*], das für viele vergossen wird. 25 Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes.
Mk 14,12–25 Das letzte Abendmahl (Mt 26,17–29; Lk 22,7–20; 1Kor 11,23–26) Bei Markus ist das letzte Abendmahl das Pesachmahl (allerdings kein Seder, der erst nach der Zerstörung des Tempels 70 u.Z entstand), während in Joh 19,31 die Kreuzigung Jesu am Rüsttag des Pesachfestes stattfindet und das letzte Abendmahl somit kein Pesachmahl ist. Dtn 16,1–8 bestimmt, dass das Pesachlamm nur in Jerusalem gegessen werden könne. 14,22–25 Die Kirchen rezitieren die Worte des letzten Abendmahls als Eucharistie (gr. für „Danksagung“); das Ritual wird auch „Kommunion“, „heilige Kommunion“ und „Herrenmahl“ genannt. Markus und 1Kor 11,20–32 beschreiben es als volle Mahlzeit. Eine andere Darstellung des gemeinsamen Mahls stammt aus der frühchristlichen Schrift Didache (Did 9,1–10,7) und ähnelt bezüglich der Gebete (mBer 7,1–5) und Theologie eher jüdischen Mählern. Im Christentum herrscht seit Jahrhunderten kein Konsens darüber, ob Christus real oder symbolisch in Brot und Wein präsent ist, ob der Wein nur von den Priestern getrunken wird und die Gemeinde nur das Brot verzehrt, ob man Wein oder (nicht-alkoholischen) Traubensaft verwenden sollte, ob eine Hostie oder ein Brotlaib verwendet werden solle und wer überhaupt teilnehmen darf. Auch die Bedeutung der Handlung wird in den verschiedenen Denominationen unterschiedlich gedeutet: Wird das Opfer Jesu am Kreuz wiederholt oder handelt es sich nur um eine Erinnerung an diese Tat? Die Rede vom Verzehren des Leibes und Blutes ist vermutlich bewusst provokant und lässt an Kannibalismus denken; selbst der Genuss von tierischem Blut war und ist im Judentum verboten (z.B. Lev 17,10–11). 14,22 Brot, im Kontext des Pesachfestes verweist dies wohl auf ungesäuertes Brot (hebr. maza). 14,24 Bund, der Bund wird durch das Blut Jesu bestätigt, wie auch Mose den Sinaibund mit Blut bestätigt hatte (Ex 24,1–8; Sach 9,11). Trotz der Verwendung des Begriffs des „neuen Bundes“ in 1Kor 11,25 und Hebr 8,13 (die beide auf Jer 31,31 anspielen), deutet die Sprache bei Markus (und vermutlich auch bei Paulus) eher auf eine Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Bund hin und bezieht sich nicht auf einen neuen oder anderen Bund. Luther übernahm die textkritische Alternative „neuer Bund“, die einige Textzeugen bieten. Für viele, vgl. Jes 53,11 und „Jesu Tod als Lösegeld“. In Mt 26,28 wird ausdrücklich „zur Vergebung der Sünden“ hinzugefügt (vgl. 1Kor 15,3; Hebr 9,11–22; 1Petr 1,18–19). 14,25 Zum künftigen Festmahl des Messias vgl. Jes 25,6 und 1QM 2,11–22; ferner äthHen 10,18–19; mAv 3,16–17; BemR 13,2).
26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
27 Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen; denn es steht geschrieben (Sacharja 13,7): »Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen.« 28 Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa.
29 Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht! 30 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute, in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 31 Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen! Das Gleiche sagten sie alle.
Mk 14,26–31 Die Ankündigung der Verleugnung des Petrus (Mt 26,30–35; Lk 22,31–34). 14,26 Die Rabbinen ordneten Ps 113–118 als Gruppe der Hallel-Psalmen zusammen (mPes 5,7) und assoziierten diese mit Pesach. Obwohl es sich dabei um eine spätere Tradition handelt, berichtet auch der jüdische Schriftsteller Philo aus dem frühen ersten Jahrhundert, dass das Pesachmahl von Gebeten und Hymnen begleitet wurde (spec. 2,148). Ölberg, vgl. Anm. zu 11,1. 14,27 Sach 13,7. Gott steht hinter dem Leiden Jesu; vgl. Anm. zu 14,36. 14,28 Will ich vor euch hingehen, vgl. Anm. zu 16,7.
32 Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. 33 Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen 34 und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet!
35 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, 36 und sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst! 37 Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? 38 Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.
39 Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte 40 und kam wieder und fand sie schlafend; denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. 41 Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug; die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. 42 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist nahe.
Mk 14,32–42 Das Gebet in Gethsemane (Mt 26,36–46; Lk 22,40–46) 14,32 Gethsemane, bedeutet „Ölpresse“ und befindet sich auf dem Ölberg (Lk 22,39). 14,33 Petrus und Jakobus und Johannes, vgl. Mk 9,2–13. 14,36 Abba, aramäisch für Vater (nicht Hebräisch für „Papa“, wie die Forschung früher teilweise behauptete). Die Anhänger Jesu hoben – vielleicht aufgrund seines Vorbildes –besonders ihre Beziehung zu Gott als Vater hervor (Anm. zu 3,31–35 und 10,29–30; Mk 11,25; Mt 6,9; Lk 11,2; Röm 8,15–17; Gal 4,6–7). In der Hebräischen Bibel findet sich dieses Bild zwar nur vereinzelt, es war aber nicht unbekannt (Jes 63,16; 64,7; Jer 3,4.19; Ps 68,6; 89,27; 103,13). Die Bezeichnung „Vater“ allein wird in der jüdischen Tradition eher mit Abraham oder einem anderen Patriarchen assoziiert als mit Gott (mAv 3,11; vgl. Joh 4,12), während „König“ häufig ein Gottestitel ist. In Kombination wird „Vater“ teilweise verwendet, z.B. im späteren jüdischen Gebet avinu malkenu, übers. „unser Vater, unser König“. Nimm diesen Kelch von mir, vgl. Jes 51,17.22, wo Gott den Kelch des Zorns vom Volk wegnimmt; vgl. Anm. zu 10,38. Nicht, was ich will, impliziert, dass sich Jesus – wie auch Petrus in Mk 8,32 – gegen den Plan Gottes wehrt; im MtEv und LkEv fehlt dieser Satz. 14,37–41 In Mk 13,37 trug Jesus den Jüngern auf zu wachen, findet sie aber ironischerweise aber dreimal schlafend auf, was bereits das dreimalige Verleugnen durch Petrus antizipiert.
43 Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. 44 Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist‘s; den ergreift und führt ihn sicher ab. 45 Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi!, und küsste ihn. 46 Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. 47 Einer aber von denen, die dabeistanden, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab.
48 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich gefangen zu nehmen? 49 Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. 50 Da verließen ihn alle und flohen.
51 Und ein junger Mann folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen nach ihm. 52 Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt.
53 Und sie führten Jesus zu dem Hohenpriester; und es versammelten sich alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. 54 Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis hinein in den Palast des Hohenpriesters, und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer.
55 Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. 56 Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn; aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. 57 Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen: 58 Wir haben gehört, dass er gesagt hat: Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. 59 Aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht überein. 60 Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? 61 Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? 62 Jesus aber sprach: Ich bin‘s; und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels.
63 Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer Zeugen? 64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. 65 Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht.
Mk 14,43–65 Jesus wird gefangen genommen und dem Sanhedrin zum Gericht übergeben (Mt 26,47–68; Lk 22,47–71; Joh 18,2–11) 14,44–45 Küssen, der Kuss ist keine unerwartete Begrüßung (Gen 45,15; Lk 7,45), an dieser Stelle jedoch mit einer gewissen Spur Ironie. Vielleicht war er auch notwendig, um Jesus in der Dunkelheit zu identifizieren. 14,47–52 Für diese provokanten und symbolischen Handlungen gibt es bisher noch keine überzeugenden Erklärungen. Der Angriff auf den Knecht des Hohenpriesters impliziert, dass die Nachfolger Jesu bewaffnet waren. Ein junger Mann […] mit einem Leinengewand bekleidet […] floh nackt, vielleicht Teil eines früheren Berichts. Neue Mitglieder der christlichen Gemeinden wurden nackt getauft, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass eine solche Handlung nachts und unter diesen Umständen durchgeführt wurde; trotzdem erinnert die Szene an eine unterbrochene Taufhandlung und die panische Flucht eines Täuflings. 14,53 Hohenpriester und Älteste und Schriftgelehrte, bilden den Sanhedrin (vgl. „Der Sanhedrin“) oder Hohen Rat. Dieser war für das jüdische Leben in Judäa zuständig, aber die Römer behielten sich selbst die Kontrolle über gewisse rechtliche Regelungen vor, besonders über die Todesstrafe. Schon deshalb wird die Historizität dieser Szene in der Forschung meist bezweifelt; verstärkt werden diese Zweifel auch aufgrund der zeitlichen Verortung des Prozesses am Pesachfest, an dem solche Aktivitäten nach jüdischem Recht strengstens verboten waren (mPes 4,1.5–6 verfügt, dass man an jenem Tag, an dem Pesach mit dem Sonnenuntergang beginnt, höchstens bis mittags arbeiten darf) und somit eine Zusammenkunft des Sanhedrin in der ersten Nacht des Pesachfestes höchst unwahrscheinlich ist. Außerdem fehlt das Verfahren vor dem Sanhedrin im Johannesevangelium. 14,55–59 Das biblische Recht verbietet das Verleiten zum Meineid (Ex 20,16) und Verurteilungen, die sich auf widersprüchliche Beweise stützen (Dtn 19,15); das MkEv stellt demnach hier den Prozess gegen Jesus als Verletzung des jüdischen Strafverfahrens dar. Falsches Zeugnis, obwohl die Zeugenaussagen als falsch beschrieben werden, hat Jesus laut dem MkEv die Zerstörung des Tempels vorhergesagt (Mk 11,15; 13,2). 14,61–64 Christus […] Sohn des Hochgelobten, beide Titel stellen keine Gotteslästerung (V. 64) dar, da ein jüdischer König beides sein konnte; sie sind aber politisch gefährlich. Laut dem MkEv versteht der Hohepriester als Repräsentant des Sanhedrin die Zitate Jesu von Ps 110,1 und Dan 7,13 (V. 62) sowie seine Selbstidentifikation mit dem richtenden Menschensohn als Gotteslästerung; vgl. Anm. zu 2,6–7. Sein Urteil ist nicht legitimer als der gesamte Prozess. 14,61 Schwieg still, wie der leidende Knecht in Jes 53,7 schweigt auch Jesus. Hochgelobter, der Hohepriester verwendet eine Umschreibung für Gott, was seine Zurückhaltung andeutet, den göttlichen Namen auszusprechen. Dies ähnelt dem rabbinischen Ausdruck „Der Heilige, gepriesen sei er“ (hebr. ha-Qadosch baruch hu; vgl. Philo somn. II. 18,130).
66 Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters; 67 und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. 68 Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte.
69 Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabeistanden: Dieser ist einer von denen. 70 Und er leugnete abermals.
Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabeistanden, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen; denn du bist auch ein Galiläer. 71 Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. 72 Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen.
Mk 14,66–72 Die Verleugnung des Petrus (Mt 26,69–75; Lk 22,56–62; Joh 18,17.25–27) Indem die Szene in V. 54 mit Petrus beginnt und hier endet, vermittelt Markus auf ironische Weise, dass der Versuch des „Selbstfreispruchs“ des Petrus zeitgleich mit der Verurteilung Jesu stattfindet. Ebenso wie die Zeugen gegen Jesus falsches Zeugnis vorbringen, tut Petrus dies in Hinblick auf seine eigene Person. Die letzte und geradezu beschwörend wirkende Verleumdung Jesu durch Petrus kann mit der Verkündung der Schuld Jesu durch den Hohenpriester verglichen werden.