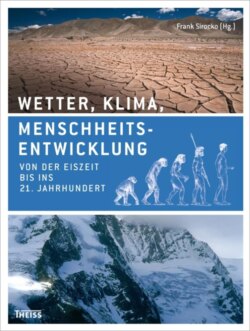Читать книгу Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pollenanalyse
ОглавлениеAls mikrofossile Hinterlassenschaft ehemaliger Vegetation liefert Blütenstaub (Pollen) eine Möglichkeit zur Rekonstruktion vergangener Pflanzengemeinschaften. Pollenkörner beherbergen im Inneren, geschützt von einer äußeren Hülle (der Pollenwand), das männliche Erbgut der Pflanze. Die Pollenwand ist unter Luftabschluss extrem haltbar und konserviert sich unter entsprechenden Bedingungen über Jahrmillionen. Ihre Gestalt ist charakteristisch (Abb. 3.1), weshalb die zwischen etwa /100–/5 mm messenden Pollenkörner die Bestimmung einzelner Pflanzenfamilien oder -gattungen, selten sogar -arten erlauben (BEUG 2004, FAEGRI 1993, MOORE et al. 1991). Als „Pollenfallen“ kommen insbesondere tiefere Gewässer, wie die Maarseen der Eifel, in Betracht. An deren sauerstofffreiem Seegrund sind optimale Erhaltungsbedingungen gegeben.
Aus dem relativen Miteinander der überlieferten Pollen kann jedoch nicht direkt auf das relative Miteinander der Pflanzen geschlossen werden, von welchen der Blütenstaub einst stammte. Vor allem standortbedingte und artspezifische Unterschiede in der Menge des produzierten Pollens führen zu Interpretationsschwierigkeiten, denn auf optimalen Standorten werden beispielsweise mehr Pollen produziert als auf suboptimalen, oder Insektenblütler produzieren weniger Pollen als Windblütler. Genauso trägt die unterschiedliche Selektion während des Transportes und der Lagerung zu den Interpretationsschwierigkeiten bei: Verschiedene Pollensorten werden unterschiedlich gut vom Wind transportiert oder sind unterschiedlich anfällig gegen Zersetzung. So sind in der Regel bei den Baumpollen vor allem die insektenbestäubten Gattungen Ahorn und Linde unterrepräsentiert, Kiefer und Hasel dagegen – als starke und zudem windblütige Pollenproduzenten – überrepräsentiert. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die überlieferten Pollen je nach Topographie kleinräumige/regionale oder weiträumige/überregionale Einzugsgebiete repräsentieren können. Insbesondere der Blütenstaub der windblütigen Nadelhölzer Kiefer und Fichte kann über Hunderte bis Tausende von Kilometern angeweht werden (Fernflug; KALIS & MEURERS-BALKE 1997).
Anhand von Pollendiagrammen lassen sich neben der Rekonstruktion des Vegetationsbildes auch Rückschlüsse auf begleitende Umweltbedingungen ziehen (ELLENBERG et al. 1992, OVERBECK et al. 1985, PRENTICE et al. 1996, PROSS et al. 2000). Dieser Transfer von der Floren- zur Umweltgeschichte gelingt jedoch oft nur qualitativ in der Beschreibung von Waldtypen oder relativ im zeitlich-räumlichen Vergleich. Absolute quantitative Aussagen, zum Beispiel zu Bodenbeschaffenheit, Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte oder Dauer der Vegetationsperiode, werden durch das komplizierte Zusammenspiel der auf die Vegetationsentwicklung einwirkenden Faktoren erschwert. Zudem vermögen Pflanzen in einem je nach Art verschiedenen Toleranzbereich um ihre optimalen Standortbedingungen herum zu existieren.
Bezüglich des Bodens sind die meisten Gewächse relativ unspezifiziert. In der Natur kommen in enger räumlicher Nachbarschaft außerdem oft verschiedene Bodentypen vor, sodass die im Sediment überlieferten Pollen immer ein Gemisch aus den jeweils unterschiedlichen Bewüchsen darstellen.
Die Temperaturansprüche der verschiedenen Pflanzen lassen dagegen präzisere Aussagen zu. Als klassische Temperaturindikatoren gelten in der Pollenkunde Efeu (Hedera helix), Stechpalme (Ilex aquifolium) und Mistel (Viscum alba; IVERSEN 1944). Hedera helix kommt heute auf Standorten vor, an denen im Juli etwa 15 °C und im Januar etwa −2 °C im Mittel nicht unterschritten werden. Ilex aquifolium benötigt mindestens etwa 12,5 °C mittlere Julitemperatur und verträgt minimal etwa 0 °C mittlere Januartemperatur. Viscum alba gedeiht nur bei Mittelwerten von über etwa –8 °C im kältesten Monat und benötigt minimal etwa gemittelte 16 °C im wärmsten Monat (AALBERSBERG & LITT 1998). Aus dem gemeinsamen Auftreten aller drei Arten lassen sich somit mittlere Minimaltemperaturen von ungefähr 16 °C im Juli und etwa 0 °C im Januar erschließen. Andere Gattungen oder Arten, darunter viele Bäume, tolerieren meist weitere, nur unscharf abgrenzbare Temperaturbereiche.
3.1 Lichtmikroskopische Aufnahmen ausgesuchter Pollenkörner (teilweise eingefärbt, unterschiedliche Maßstäbe, Maßstriche entsprechen jeweils etwa 30 μm).
Neben mittleren Minimaltemperaturen sind noch weitere Temperaturmittel oder Absoluttemperaturen aussagekräftig. Vor allem im Gartenbau werden die einzelnen Pflanzenarten in Bereiche gemittelter jährlicher Tiefsttemperaturen, sogenannte Winterhärtezonen, eingeteilt (HEINZE & SCHREIBER 1984), welche die einzelnen Arten langfristig vertragen. Komplexere Ansätze bedienen sich statistischer Januar- und Julitemperaturbereiche, die von einzelnen Arten angezeigt werden (KÜHL & LITT 2007). Das kombinierte Auftreten verschiedener Arten grenzt dann einen wahrscheinlichen Temperaturbereich ein. Kritisch für die Vegetationsentwicklung sind jedoch insbesondere Spät- oder Frühfröste, deren Auftreten, Häufigkeit und Strenge in den mittleren Temperaturdaten nur bedingt enthalten sind.
Abschätzungen für Niederschlagsmengen aus Pollendaten sind bisher nur ansatzweise realisiert. Der Wasserverbrauch/-anspruch der Gewächse ist unter anderem von Temperatur, Luftfeuchte, Windexponiertheit und Länge der Vegetationsperiode abhängig und kann zudem standortbedingt über verfügbares Grundwasser gedeckt werden. Anhaltspunkte liefern gegenwärtige Niederschlagsmengen. So fallen im westlichen Mitteleuropa pro Jahr durchschnittlich 600–850 mm, in Ostmitteleuropa lediglich um 500–600 mm. In den Mittelgebirgslagen werden über 2000 mm, im Saale- oder Odertal weniger als 500 mm erreicht (HÄRDTLE et al. 2004).
In Ökogrammen (Abb. 3.2) versucht man, das Einwirken bestimmter Umweltfaktoren auf die Vegetationsbedeckung im Konsens darzustellen.
Auch wenn alle Ansprüche der verschiedenen Pflanzenarten scharf eingrenzbar wären, würden immer zwei Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion vergangener Umweltbedingungen aus Pollendaten bleiben. Zum einen kann in der Praxis bei der lichtmikroskopischen Pollenbestimmung oft nur die Pflanzengattung erkannt werden, deren vorkommende Arten jedoch möglicherweise völlig verschiedene Ansprüche stellen. Makrofossile Hinterlassenschaften wie Blattreste, Holzreste oder Samen, welche eine Bestimmung der einzelnen Art erlauben, sollten daher den mikrofossilen Befund ergänzen. Prinzipiell problematisch ist zum anderen die Annahme, dass die Umweltansprüche einer Art heute und in der Vergangenheit gleich waren. So wird diskutiert, ob sich unsere heutige Rotbuche (Fagus sylvatica) erst im Quartär, gegebenenfalls sogar erst seit dem letzten Interglazial, der Eem-Warmzeit, als eigenständige Art mit neuen spezifischen Umweltanforderungen entwickelt hat (HUNTLEY & BIRKS 1983).
In Pollenzählungen werden nicht nur Baum-, sondern auch diverse Nichtbaumpollen sowie Sporen von Farnen und Moosen erfasst und zur Rekonstruktion der Vegetationsbedeckung beziehungsweise als Anzeiger von Umweltbedingungen mit herangezogen. So gelten Süß- und Sauer-/Riedgräser (Poaceae und Cyperaceae) als Offenland- beziehungsweise Vernässungsanzeiger. Die den Heidekrautgewächsen (Ericaceae) zugehörige Besenheide (Calluna) belegt saure, nährstoffarme Böden und waldfreie Flächen. Beifuß (Artemisia) gilt aufgrund seiner Kälteresistenz und seines hohen Lichtbedarfes als Indikator für Versteppung, ist aber auch als „Unkraut“ ein indirekter Anzeiger menschlicher Besiedlung. Direkter Anzeiger menschlicher Präsenz ist dagegen der Blütenstaub von Getreide. Dabei zählen Dinkel, Einkorn, Emmer und Weizen (sämtlich Triticum), Gerste (Hordeum), Hafer (Avena), Hirse (verschiede Gattungen) sowie Roggen (Secale) alle zur Familie der Süßgräser und sind pollenanalytisch nur aufwendig oder gar nicht zu unterscheiden, weshalb sie als Cerealien zusammengefasst werden.