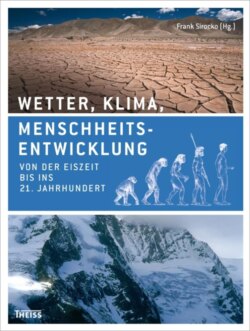Читать книгу Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vegetationsgeschichte
ОглавлениеDas jüngste Erdzeitalter, Känozoikum oder Erdneuzeit genannt, begann vor etwa 65 Mio. Jahren mit dem Aussterben der Dinosaurier und gliedert sich in Tertiär und Quartär (Abb. 1.3). In Ablagerungen aus dem Tertiär herrschen „exotische“ Florenelemente vor, beispielsweise Amberbaum (Liquidambar), Ginkgo (Ginkgo), Guttaperchabaum (Eucommia), Hemlocktanne (Tsuga), Hickorynuss (Carya), Hopfenbuche (Ostrya), Lebensbaum (Thuja), Magnolie (Magnolia), Mammutbäume (Metasequoia, Sequoia, Sequoiadendron), Palmen (Arecaceae), Rosskastanie (Aesculus), Schirmtanne (Sciadopitys), Sumpfzypresse (Taxodium), Tulpenbaum (Liriodendron), Tupelobaum (Nyssa) und Walnuss (Juglans), die aber alle spätestens im Laufe des Altpleistozäns (2.600.000–780.000 Jahre vor heute) in Mitteleuropa ausstarben (MAI 1995).
3.2 Vorherrschende Baumarten in der natürlichen Vegetation des Alpenraumes in Abhängigkeit von Jahresmitteltemperatur und jährlichem Niederschlag (nach HÄRDTLE et al. 2004)
Während im Tertiär noch tropisches bis subtropisches Klima herrschte, ist das nachfolgende Quartär durch einen vielfachen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten mit wiederholten Inlandvereisungen auf der nördlichen Hemisphäre geprägt. Die Tertiär-Quartär-Grenze setzt man momentan bei 1,8 Mio. Jahren vor heute an (DEUTSCHE STRATIGRAPHISCHE KOMMISSION 2002). Jedoch ist in Europa bereits um etwa 2,6 Mio. Jahren vor heute ein „Florenschnitt“ von einer „typisch“ tertiären zu einer „typisch“ quartären, kaltzeitlichen Pflanzengemeinschaft zu verzeichnen (siehe auch Abb. 10.1).
Die Warmzeiten des Quartärs prägen die uns vertrauten Laubbaumvertreter Ahorn (Acer), Birke (Betula), Eiche (Quercus), Erle (Alnus), Esche (Fraxinus), Linde (Tilia), Hainbuche (Carpinus), Hasel (Corylus), Pappel (Populus), Rotbuche (Fagus), Ulme (Ulmus) und Weide (Salix) zeitweise auch Buchsbaum (Buxus) oder das Tertiärrelikt Flügelnuss (Pterocarya) sowie die Nadelbaumvertreter Fichte (Picea), Kiefer (Pinus), Lärche (Larix), Tanne (Abies) und die weniger geläufige Eibe (Taxus; LANG 1994).
Die letzte große Eiszeit des Quartärs, das Weichsel-Würm-Glazial, erreichte vor etwa 20.000 Jahren den Höhepunkt mit der maximalen Flächenausdehnung des Inlandeises und endete vor etwa 14.500 Jahren. Ausgehend von noch arktischen Verhältnissen (etwa der heutigen Tundra entsprechend; Abb. 3.3a) etablierte sich zu dieser Zeit auf noch eiszeitlichen Rohböden eine offene Parkvegetation mit den Pioniergehölzen Wacholder (Juniperus) und Sanddorn (Hippophaë; Abb. 3.3b). Diese Pioniervegetation wurde noch in der ausklingenden Eiszeit, dem Spätglazial, von Birken und Kiefern ersetzt und es bildeten sich erstmals wieder sogenannte „boreale“ Wälder (Abb. 3.3c, d).
3.3 Rezente Vegetations- beziehungsweise Waldtypen, wie sie in etwa die Florenentwicklung im Holozän und in älteren quartären Warmzeiten widerspiegeln: a) baumlose Tundra; b) offene Park-/Steppenvegetation mit Pioniergehölzen; c) borealer Wald mit Ausprägung als offener Birkenwald; d) borealer Wald mit Ausprägung als fichtendominierter Nadelwald (Taiga); e) Eichenmischwald; f) Buchenmischwald.
Seit etwa 11.600 Jahren leben wir in der jüngsten Warmzeit des Quartärs, dem Holozän, die bis heute andauert. Seit Beginn des Holozäns erlaubt das Klima wieder eine durchgängige Bewaldung. Im Holozän entwickelten sich nährstoffreiche Braunerdeböden, auf denen mit Hasel- und Eibenbeteiligung Laubmischwälder von Ahorn, Eiche, Esche, Linde und Ulme aufwachsen (Abb. 3.3e). Lokal auf entsprechenden Standorten stocken Erlenbruch- und Auenwälder. Unter Einwirkung spät eingewanderter Arten wie Rotbuche, Hainbuche oder Tanne etablierten sich schließlich auf zunehmend versauernden Böden Schattholzwaldtypen wie Rotbuchen- (Abb. 3.3f) oder Tannenmischwälder. Im Holozän ist die Vegetationsentwicklung spätestens seit dem Sesshaftwerden des Menschen zu Beginn der Jungsteinzeit (Neolithikum) durch Wald- und Bodennutzung anthropogen beeinflusst (FRENZEL 1991). Die uns heute geläufigen Wald- und Landschaftstypen stellen daher keine natürlichen Pflanzenvergesellschaftungen dar.
Aus vielen Pollendiagrammen ist bekannt, dass der Übergang von Hochglazial zu Holozän nicht kontinuierlich verlief. Vielmehr ist das Weichsel-Würm-Spätglazial durch mehrere die Erwärmung zeitweilig unterbrechende Kältephasen (Älteste, Ältere und Jüngere Dryas/Tundrenzeit, benannt nach der Silberwurz Dryas octopetala) gekennzeichnet.
3.4 Schematisierte holozäne bis späteiszeitliche Durchschnittspollendiagramme für Süd- und Norddeutschland (nach BEHRE 2003).
In Abbildung 3.4 sind stark vereinfachte holozäne bis spätglaziale Durchschnittspollendiagramme für Süd- und Norddeutschland wiedergegeben. Es zeigt sich eine prinzipiell ähnliche Abfolge verschiedener Vegetationsphasen (Waldtypen nach Abbildung 3.3), die der beschriebenen Abfolge von borealer Birken-Kiefern-Phase über Eichenmischwald- zu Schattholzwaldphase (Rotbuchen-/Tannenphase) entspricht. Bedingt durch klimatische, bodenstandörtliche und geographisch-morphologische Gegebenheiten, durch die Lage der eiszeitlichen Rückzugsgebiete der Gehölze (meist im Mittelmeerraum) sowie deren Ausbreitungs- und Konkurrenzverhalten treten diese Vegetationsphasen aber regional zeitlich verschoben und mit unterschiedlicher prozentualer Präsenz (insbesondere bei Fichte und Tanne) auf. Prinzipiell setzten Erwärmung und Bewaldungsphasen im Süden früher ein als im Norden.
Für den Mittelgebirgsraum dokumentieren zahlreiche Pollendiagramme aus Eifelmaaren (FIRBAS 1949/1952, STRAKA 1975, DÖRFLER et al. 2000, LITT & STEBICH 1999, KUBITZ 2000) eine intermediäre Stellung innerhalb dieser Entwicklung (Abb. 3.5). So breitete sich beispielsweise die Rotbuche in Süddeutschland schon in der dortigen Jungsteinzeit, im Mittelgebirgsraum seit der Bronze-, in Norddeutschland dagegen erst seit der Eisenzeit stark aus. Prinzipiell Ähnliches gilt auch für andere Gattungen wie Eiche, Linde oder Ulme.
Die Holozängliederung in Präboreal (Vorwärmezeit), Boreal (Frühe Wärmezeit), Atlantikum (Mittlere Wärmezeit), Subboreal (Späte Wärmezeit) und Subatlantikum (Nachwärmezeit) ist ursprünglich nach markanten Veränderungen in der Vegetationsbedeckung definiert (OVERBECK 1975, STRAKA 1975), die sich aber nicht überregional mit absoluten Zeitmarken korrelieren lassen (Abb. 3.4). Die Verwendung der Begriffe „Präboreal“, „Boreal“ und so weiter in chronostratigraphischem Sinne, also unter Verwendung fester Zeitmarken für deren Begrenzung, führt daher zu Diskrepanzen mit ihrer ursprünglichen Definition als vegetationsgeschichtliche Abschnitte.
Allgemein dürfen vegetationsgeschichtliche Abschnitte nicht mit zeitlich definiertem Beginn und fester Dauer verstanden werden, sondern umschreiben ineinander übergehende Entwicklungsphasen, die räumlich (geographisch) und zeitlich verschoben, also nebeneinander beziehungsweise nacheinander auftreten. Gleiches gilt prinzipiell für jede Gliederung auf entwicklungsgeschichtlicher Basis, also auch für menschheitsgeschichtliche Epochen (vergleiche Grenzziehung Mittel-/Jungsteinzeit, Abb. 3.4). Unter dieser Prämisse lassen sich Spätglazial (für dessen Gliederung dieselben Überlegungen gelten) und Holozän der Eifel chronologisch gliedern und vegetationsgeschichtlich beschreiben (Tab. 3.1). Die Alterszuweisungen stellen die Grundlage dar, auf der die stratigraphische Einstufung der Pollendiagramme in Kapitel 6 erfolgte.
3.5 Holozänes Pollendiagramm aus der Eifel (Meerfelder Maar; nach KUBITZ 2000).
Ein starker Anstieg der Nichtbaumpollenanteile bei 850 BC (Abb. 3.5) – vor allem bei Gräsern, Siedlungsanzeigern wie Ampfer (Rumex), Beifuß (Artemisia) oder Wegerich (Plantago), weniger betont aber auch bei Getreide – spiegelt zunehmende Waldrodung, Viehwirtschaft und Ackerbau in der Eisen- und Römerzeit wider. Als Nutzbäume kultivierten die Römer Walnuss (Juglans regia) und Esskastanie (Castanea sativa), außerdem werden Weinreben (Vitis vinifera) und diverse Obstbaumsorten wie etwa Äpfel (Malus), Birnen (Pyrus) oder Pflaumen (Prunus) angebaut. Es folgte die Phase der Völkerwanderungszeit mit zurückgehenden Werten bei den Siedlungsanzeigern und wieder dichterer Bewaldung, im Zuge derer vor allem Rot- und Hainbuche (wieder) aufkamen. Im Frühmittelalter (seit etwa 500 AD) stiegen die Prozentanteile der krautigen Gewächse wieder stark an. Getreide (neben Roggen/Secale später auch Buchweizen/Fagopyrum) waren deutlich präsent. Der Erlenanteil war stark rückläufig. Die seit dem Atlantikum im Pollenregen des Eifelraumes nur sporadisch auftauchende Fichte gewinnt erst mit der preußischen Aufforstung im frühen 19. Jahrhundert deutliche Anteile und dominiert heute die Nutzwälder.
Da das Pollendiagramm aus dem Meerfelder Maar (Abb. 3.5) auf einer warvengestützten Alterseinstufung beruht (BRAUER 1999), stellt es für den Eifelraum eine Art „Masterchronologie“ dar. Für die Alterseinstufung der ELSA-Bohrkerne (Kap. 4) werden folgende markante Stufen der Vegetationsentwicklung auf andere Kerne aus den Maaren übertragen (LITT 2007):
14.450 BP (Before Present): Beginn Meiendorf
13.800 BP: Beginn Älteste Dryas
12.700 BP: Beginn Jüngere Dryas
11.600 BP: Beginn Holozän (Präboreal)
10.800 BP/8850 BC (Before Christ, die Altersangabe erfolgt nun in Jahren vor Christus): Beginn Boreal, starke Ausbreitung von Hasel
6600 BC: Beginn Atlantikum, Einwanderung von Linde und Esche
4250 BC: Beginn Subboreal, starke Ausbreitung von Erle
1850 BC: starke Ausbreitung von Rotbuche
850 BC: Beginn Subatlantikum, starker Anstieg von Nichtbaumpollen
Diese pollenanalytischen Zeitmarken wurden als palynostratigraphische Marker in das Altersmodell der ELSA-Kerne übernommen (Kap. 6).
Tab. 3.1 Vegetationsgeschichte der Eifel. Alterseinstufung nach KUBITZ (2000) und LITT (2007).