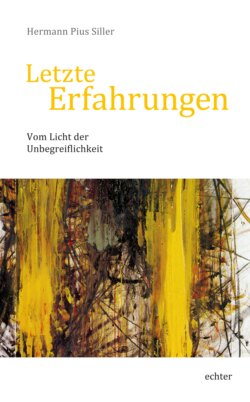Читать книгу Letzte Erfahrungen - Hermann Pius Siller - Страница 18
Virtuelle Vorsehung und befreiende Providenz
ОглавлениеVor kurzem habe ich eine Art Parabel gesehen, was göttliche Providenz nicht ist, wohl aber wie sie als systemische Lenkung annähernd bei uns passiert: den Film „Die Truman Show“. Der Film erzählt das Unternehmen eines Regisseurs, in dem das ganze Leben eines Herrn Truman von seiner Geburt an gefilmt und es nicht nur life, sondern auch synchron zu seinem Leben dem Fernsehpublikum vorgeführt wird. Der Regisseur inszeniert die Totalität dieses Lebens. Alle, die mit dem Protagonisten Truman zu tun haben, sind Schauspieler, sind Rollenträger. Architektur und Landschaft sind Kulisse. Der Regisseur versteht sich selber als „Schöpfer“ dieser totalen virtuellen Welt. Der einzig „echte“ in dieser Schau ist Truman. Er weiß von der bloßen Virtualität dessen, was er für Wirklichkeit hält, nichts. Er hält als einziger alles für echt. Von ca. 5000 Kameras wird er überall und immer gesehen und kontrolliert. Die Filmaufnahmen von ihm sind meist durch das Objektiv der Kamera oder auf dem Monitor des Fernsehpublikums zu sehen. Trumans Entscheidungen sind in jedem Fall vorhergesehen. Unvorhergesehenes wird abgeblockt. Selbst seine Ehefrau wird von einer Schauspielerin dargestellt, wenngleich diese manchmal von der Kälte dieser Aufgabe überfordert ist. Aus ihrer Rolle als Schauspielerin aber fällt eine andere Frau. Da begegnet Truman ein Blick, der mit seiner empfindsamen, verletzbaren Unbedingtheit von jenseits dieser Virtualität herkommt. Diese Rollenträgerin durchbricht ihre Rolle, gerät deshalb in Konflikt mit dem Regisseur, kündigt ihre Rolle auf und findet damit wieder selber auf den Boden der Wirklichkeit. Im kritischen Moment sucht sie Truman ihre eigene und seine Lage verständlich zu machen: „Alles ist gefälscht“; die Filmemacher „wissen alles“. Truman allerdings versteht zunächst nicht. Aber dann fängt er an, das Ganze zu durchschauen. Das Kamerateam ist nicht mehr sicher, ob nicht vielmehr Truman in das Objektiv der Kamera sieht und mit dem Kamerateam spielt. Es gelingt ihm nun, durch ein Loch in der Decke den Augen der omnipräsenten Kameras zu entkommen. Die Kameras suchen ihn, bis sie ihn auf dem Meer in einem Segelboot entdecken auf dem Weg nach „Fidschi“. Der Regisseur versucht ihn mit allen Mitteln zurückzubringen und wieder in seine „Vorsehung“ zu integrieren. Truman fügt sich nicht mehr. Da stößt er mitten auf dem Meer und seinem endlosen Horizont mit einem Krach auf die Kulisse, die diesen Horizont bildet. Es die Grenze der manipulierten Illusion. Der Schöpfer der virtuellen Welt ersucht Truman, doch weiter in der wohlbehüteten Welt seiner Bilder zu bleiben. Truman aber beendet den Film. Er verlässt die für ihn vorgesehene Bilderwelt.
Ich halte die Truman Show für die Parabel eines von den Medien total „vorgesehenen“ Lebens. Die Truman Show zeigt den virtuellen „Lebensstil“ des Fernsehens. Dieser Lebensstil zerbricht an der Bestimmung des Menschen zur Wirklichkeit, zur Wahrheit, zur Freiheit. Newman hat dazu einen Widerspruch formuliert, der mit dem Bild des platonischen Höhlengleichnisses die virtuelle Totalität unserer Gegenwart enthüllt. Die Providenz dagegen führt sein Leben „ex umbris et imaginibus in veritatem“, aus Schatten und Bildern zur Wahrheit.31
16 Ludwig Weimer, Wodurch kam das Sprechen von Vorsehung und Handeln Gottes in die Krise? Analyse und Deutung des Problemstandes seit der Aufklärung, in: Theodor Schneider und Lothar Ullrich (Hg.), Bennoverlag Leipzig 1988, 17–71.
17 Odo Marquard, Der angeklagte und der entlastete Mensch in der Philosophie des 18. Jahrhunderts, in: ders., Abschied vom Prinzipiellen, Reclam Stuttgart 1984, 39–66.
18 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werkausgabe Suhrkamp Frankfurt a. M. I, 355.
19 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Bd. VI der Kritischen Ausgabe von Wilhelm Weischedel.
20 Gotthold Ephraim Lessing, Erziehung des Menschengeschlechts. Reclam Stuttgart, § 91 und 92.
21 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Hg. v. Elisabeth Ströker, Meiner Hamburg 1996.
22 Jürgen Habermas, Theorie kommunikativen Handelns, Frankfurt a. M. 1981, hier insbes. Band II.
23 O’Donovan, tempi – Bildung im Zeitalter der Beschleunigung, Bildungskongress der Kirchen am 16. November 2000 in Berlin, hrg. Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz.
24 O’Donovan [Fn. 22] ebd.
25 G. Biemer, Wahrheit [Fn. 6], 104.
26 F.X. Kaufmann, Wie überlebt das Christentum? Herder Freiburg i. Br. 2000, 62.
27 O’Donovan [Fn. 22], ebd.
28 Hier ist an die Religion der Deutschen Christen zu erinnern.
29 Vgl. Emmanuel Levinas, Totalität und Unendlichkeit, Freiburg i, Brg.1987, 183.
30 Bernhard Casper, Der Zugang zu Religion im Denken von Emmanuel Levinas, in: Franz Joseph Klehr, Den Andern denken. Philosophische Fachgespräch mit Emmanuel Levinas, Hohenheimer Protokolle Bd. 31, 37–50, Akademie Stuttgart-Hohenheim 1988.
31 Inschrift auf einem Gedenkstein im Oratorium zu Birmingham.