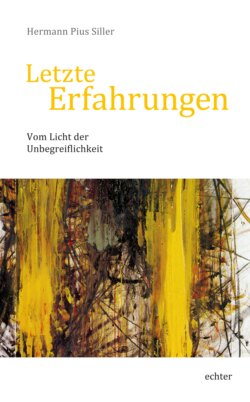Читать книгу Letzte Erfahrungen - Hermann Pius Siller - Страница 27
Die keinen Sinn ihres Daseins finden können
ОглавлениеEin Schlüssel des liberalen Bewusstseins ist der Begriff „Sinn“. Die Frage nach dem Sinn steht in Korrelation dazu, ob sich einer als Subjekt begreift. Das individuelle, liberale Bewusstsein sieht sich durch die Wirklichkeit in der Weise herausgefordert, dass es für diese eine Rechtfertigung suchen muss. Wirklichkeit muss sinnvoll sein. Sinnvoll aber ist für das neuzeitliche Subjekt, was verständlich und begreifbar ist, vor allem aber was verfügbar und machbar ist. Wenn sich die Wirklichkeit diesem verfügenden Anspruch verweigert, droht das Subjekt in den leeren Abgrund der Sinnlosigkeit und Verzweiflung zu stürzen. Nun verweigern sich aber gerade die schwerwiegenden Kontingenzen der Lebensgeschichte und die Katastrophen im Gang der Weltgeschichte dem Tribunal der Vernunft und ihrem Sinnpostulat. Sie sind unverfügbar. Die Alternative dazu scheint dann nur die Abschaffung dieser unsere Vernunft beleidigenden Wirklichkeit oder die Auslöschung der nach Sinn verlangenden Vernunft zu bleiben.
Wie geht Newman mit diesem Sinnbegriff um? Er fragt in seiner Predigt: Was kann der Christ denen sagen, die der Wirklichkeit einen solchen Sinn nicht abgewinnen können? „Tiefer empfindende Menschen würden von Mutlosigkeit erfasst und selbst des Lebens überdrüssig werden, müssten sie sagen, sie unterständen lediglich dem Walten starrer Gesetze und hätten keinerlei Möglichkeit, einen Blick von jenem zu erhalten, der diese Gesetze gab. … Was sollten vor allem solche denken, die mit Menschen zusammenleben müssen, die ihr Inneres nicht verstehen können, … oder solchen, die in innere Schwierigkeiten geraten sind, die sie sich selbst nicht erklären, geschweige denn lösen können, … oder die keine Aufgabe für sich erkennen können und keinen Sinn ihres Daseins finden können und anderen im Wege zu stehen glauben.“ Newman spricht damit die Rechtfertigungsansprüche des liberalistischen Subjekts an die Wirklichkeit an und weist überzogene Sinnansprüche zurück. Wir werden inne werden müssen, dass die Vernunft weiter zu spannen ist, dass wir noch andere sind als nur Verfügende und Begreifende, dass es daneben die radikalere Möglichkeit gibt: sich vertrauensvoll fügen zu können. Es kann durchaus sinnvoll und vernünftig sein, sich dem unbegreifbaren und unverfügbaren Geheimnis zu überantworten. Es kann sinnvoll und vernünftig sein, sich in der Aufmerksamkeit Gottes zu erfahren. Die anthropomorphe Vorstellung eines beobachtenden Gottes, der den Menschen kühl und unbeteiligt zusieht und von außen in den Gang der Geschichte gelegentlich eingreift, ohne die Faktoren, die Geschichte machen, einzubeziehen geht an dem, was Newman unter Providenz versteht, vorbei. Providenz meint, dass das Geheimnis der Schöpfung und der Geschichte ein wissendes und beteiligtes Geheimnis ist. Man könnte, wenn man von dem anthropozentrischen Bedeutungsgehalt von „Sinn“ abstrahiert, statt Providenz auch sagen, Schöpfung und Geschichte haben einen eigenen Sinn, der uns entzogen ist.
32 Karl-Otto Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik: Können die Rationalitätsdifferenzen zwischen Moralität, Recht und Politik selbst noch durch die Diskursethik normativ-rational gerechtfertigt werden?, in: Karl-Otto Apel / Matthias Kettner (Hg.), Zur Anwendung der Diskursethik in Politik, Recht und Wissenschaft, Suhrkamp Frankfurt a. M. 1992, 29–61, hier 47.
33 I. Kant, in: Werkausgabe, Frankfurt a. M. 1964, Bd. VI, 34–50.
34 Ebd. 38.
35 Ebd.
36 Ebd. 47.
37 Ebd. 48.
38 Ebd. 49.
39 John Burke, Betrachtungen zur Französischen Revolution, in der Bearbeitung von Friedrich Gentz, Berlin 1793, hrg. von Hermann Klenn, Akademie Verlag Berlin 1991.
40 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Piper München 1991.
41 Ebd. 455. Vgl. Sabine Rothemann, Aufweichung der Menschenrechte. Zur Aktualität von Hannah Arendt, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 12/ 2005, 60–63.
42 Karl-Otto Apel, Das Anliegen des anglo-amerikanischen ‚Kommunitarismus‘ in der Sicht der Diskursethik. Worin liegen die ‚kommunitä-ren‘ Bedingungen der Möglichkeit einer post-konventionellen Identität der Vernunftperson?, in: Micha Brumlik / Hauke Brunkhorst (Hg.), Gemeinschaft und Gerechtigkeit, Fischer Frankfurt a. M. 1993, 149–172, hier 156.
43 Ebd. 169.
44 Karl-Otto Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik [Fn. 31], 36.
45 Ebd.
46 Ebd. und 46.
47 Ebd. 60.
48 Odo Marquard, Ende des Schicksals? Einige Bemerkungen über die Unvermeidlichkeit des Unverfügbaren, in: ders. Abschied vom Prinzipiellen, Reclam Stuttgart 1981, 67–90, hier 69.
49 Gotthold Ephraim Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, in: ders., Die Erziehung des Menschengeschlechts und andere Schriften, Reclam Stuttgart 1965, 29; vgl. dazu: Arno Schilson, Geschichte im Horizont der Vorsehung. G.E. Lessings Beiträge zu einer Theologie der Geschichte, Grünewald Mainz 1974.
50 Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Werkausgabe Bd. IV, Suhrkamp Frankfurt a. Main 1964, 683; ders., Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, ebd. 169; ders., Zum ewigen Frieden, ebd. 217; ders., Der Streit der Fakultäten, ebd. 356.
51 Zum ewigen Frieden ebd. 217.
52 Anthropologie ebd. 683.
53 Über den Gemeinspruch ebd. 169.
54 Odo Marquard, Abschied vom Prinzipiellen, Reclam Stuttgart 75.
55 Ebd. 76.
56 Ebd. 80.
57 Ebd. 85.
58 Friedrich Wilhelm Schleiermacher, Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt, Band 1 und 2, Berlin 1861, § 30.
59 Ebd. § 3.
60 Ebd. § 4.
61 Ebd. § 3.
62 Ebd. § 30.
63 Günter Biemer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Newman sich ausdrücklich in seinem Postskript zum Traktat 73, verfasst 1835, ECH, Vol I, 30–101, London 1871 auf Schleiermacher bezieht. Schleiermachers Glaubenslehre hat er kaum gelesen, wohl aber einen amerikanischen Artikel in The Biblical Repository, Nos 18 and 19 mit dem Titel: Schleiermacher’s Comparison of the Athanasian and Sabellian Views of the Trinity. Dieser Artikel trifft die §§ 170–172 am Ende von Schleiermachers Glaubenslehre sehr gut. Schleiermacher fragt sich, ob der ewige Hervorgang des Wortes und des Geistes aus dem Vater, wie es das Athanasianum will, biblisch zwingend ist, ob die Ablehnung des Sabellianismus mit seiner Betonung des einen Wesens notwendig daraus gefolgert werden kann, ob nicht doch die Widersprüche, die sich bei Athanasius ergeben, im Sabellianismus vermeidbar sind. Schleiermachers Option geht unverkennbar in Richtung des Sabellianismus. Newman referiert die Schleiermachersche Ansicht korrekt, bemerkt aber in kritischer Absicht drei – wie mir scheint – leitende Kriterien:
– That the one object of the christian Revelation, or Dispensation, is to stir the affections, and soothe the heart.
– That the realy contains nothing, which is unintelligibel to the intellect.
– That the misbelievers, such as Unitarians, etc. are made so, for the most part, by Creeds; which are to be considered as the great impediments to the spread of the Gospel, both as being stumbling-blocks to the reason, and shackles and weights on the affection.
64 Hermann Pius Siller, Newman – ein ausgeprägt autobiographischer Mensch. Zur Pragmatik autobiographischen Handelns, in: Günter Biemer / Lothar Kuld / Roman Siebenrock (Hg.), Sinnsuche und Lebenswelten. Internationale Cardinal-Newman-Studien, XVI. Folge, Frankfurt a. M. 1998, 15–29.
65 John Henry Newman, Selbstbiographie nach seinen Tagebüchern, hg. v. Henry Tristram, Schwabenverlag Stuttgart 1959, 180.
66 Ebd.
67 Zitiert nach Günter Biemer und James Derek Holmes (Hg.), Leben als Ringen um Wahrheit, Grünewald Mainz 1984, 111.
68 Vgl. dazu Karl Barths lebenslange Auseinandersetzung mit Schleiermacher abschließend, mit Respekt und sehr fair das Nachwort zur Schleiermacher-Auswahl, München und Hamburg 1968, 290–312.
69 John Henry Newman, Predigten, 3. Band, Stuttgart 1953, 127–141; hier wird die Übersetzung von Otto Karrer benutzt in: Kardinal John Henry Newman, Christliches Reifen. Texte zur religiösen Lebensgestaltung, Einsiedeln 1954, 40–51.
70 Jean Paul Sartre, Die Wörter, Rowohlt Hamburg 1965, 78.
71 In „Die Eingeschlossenen“ („Bei geschlossenen Türen“) wird dieses Gesehenwerden zur Hölle; analysiert wird dieser Blick in „Das Sein und das Nichts“, Rowohlt Hamburg 1962, 338–397.
72 Bernd Trocholepczy, Realizing. Newmans inkarnatorisches Prinzip als Beitrag zum Theorie-Praxis-Verständnis der Praktischen Theologie, in: Günter Biemer / Bernd Trocholepczy (Hg.), Realisation – Verwirklichung und Wirkungsgeschichte, in: Internationale Cardinal-Newman-Studien XX. Folge, Peter Lang Frankfurt a. M. 2010, 77–239.
73 Vgl. Thomas von Aquin, Sum. Theol. I-II, 112, 1 ad 1; III, 7, 1 ad 1; III, 19. Dazu D. van Magerem, De causalitate instrumentali humanitatis Christi iuxta D. Thomae doctrinam, Venlo 1939.
74 Thomas von Aquin, Summa Theologiae I, q. 22.
75 Ders., Summa contra gentiles, LIII, 71–77.