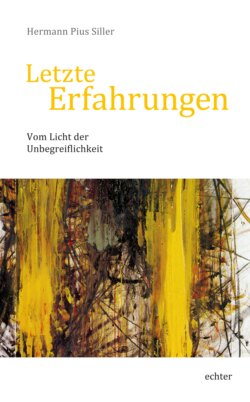Читать книгу Letzte Erfahrungen - Hermann Pius Siller - Страница 9
Die akademische Wegstrecke
ОглавлениеDas Jahr 1816 war für Newman ein ereignisreiches Jahr: der wirtschaftliche Zusammenbruch der väterlichen Bank, eine Krankheit, die in den autobiographischen Schriften nur angedeutet wird, die an seiner Schule in Ealing verbrachten Sommerferien, der in dieser Zeit durch seinen Lehrer Mayers ausgeübte evangelikale Einfluss, den er als „Bekehrung zu Gott“ erlebt und beschrieben hat, und damit verbunden, die Aufnahme dogmatischer Eindrücke, „die durch Gottes Güte niemals ausgelöscht und getrübt wurden“ (A 22). Im Dezember des Jahres 1816, brachte ihn sein Vater nach Oxford, um ihn im Trinity-College immatrikulieren zu lassen. Ein Jahr später bewarb er sich dort um ein Stipendium. In seinem Tagebuch betete er: „Gott, lass nicht zu, dass ich durch diese Erwartung (den erwarteten Erfolg dieser Bewerbung H.P.S.) von Dir getrennt werde. Gewähre, meinen Geist so in Zucht zu halten, dass ich nicht enttäuscht bin, wenn es schlecht ausgeht; sondern deinen Namen lobe und preise, weil du besser weißt, was für mich gut ist“ (SB 204). Damit wird ein Konflikt angesprochen, der für die folgenden Jahre kennzeichnend blieb: der Konflikt zwischen Eigenwille, Eigensinn, Ehrgeiz, zu wenig Selbstverleugnung, zu viel Freude am Erfolg einerseits und Gottvertrauen, Frieden des Herzens, Geborgenheit im Willen Gottes, Glaube an Gottes Providenz andererseits. Sein persönliches Gegenbild wurde das selbstgerechte Verhalten Sauls (SB 219; DP III, 39–54). Vor dem dann für ihn selber doch nicht zufriedenstellend gelungenen Abschlußexamen schrieb er: „Ich will nicht um den Erfolg beten, sondern um das Gute“ (SB 54f.). Und in einem Tagebucheintrag: „Ich bitte nicht um Erfolg, sondern um den Frieden des Herzens“ (SB 208). Vor der Prüfung bei der Bewerbung um eine Fellowstelle am Oriel-College betete er an seinem Geburtstag: „Du siehst, wie versessen und, ich fürchte, abgöttisch meine Sehnsucht danach ist, im Oriel-College Erfolg zu haben. Nimm all meine Hoffnung weg, warte keinen Augenblick, o mein Gott, wenn ich dabei deinen Geist gewinne“ (SB 237). Aus der Zeit vor seiner Diakon- und Priesterweihe gibt es ähnliche Äußerungen.
Dieser spirituelle und asketische Konflikt war für eine Religiosität insbesondere des vergangenen 19. und 20. Jahrhunderts oder für ein Bildungsverständnis, das sich als Selbstverwirklichung versteht, unschwer nachvollziehbar. Hier stand die Providenz dem Interesse an sich selber wie eine fremde Macht gegenüber. Aber inzwischen ist uns, den Menschen im einundzwanzigsten Jahrhundert, das so völlig fremd vielleicht auch nicht mehr. Das abgeschlossene, souveräne Subjekt, das allein Herr im eigenen Haus ist, wurde unter anderem durch Sigmund Freuds und George Herbert Meads Identitätsverständnis nachhaltig desillusioniert. Das schlägt inzwischen auch im Lebensgefühl – manchmal vielleicht schon zu stark – durch. Jeder von uns trägt – das wissen wir – auch Fremdbestimmendes in sich, mit dem er sich ständig auseinander zu setzen hat. In die Identität gehört neben der Selbstbestimmung auch das Fremdbestimmende.6 Wer einer sein kann und sein will, muss er erst in konkreten Situationen herausbekommen. Insofern ist uns Newmans Konflikt Selbstbestimmung versus Providenz so völlig fremd nicht.