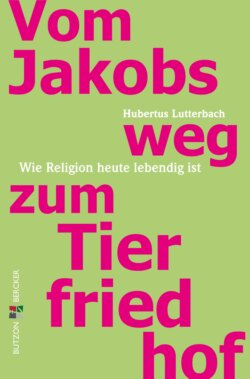Читать книгу Vom Jakobsweg zum Tierfriedhof - Hubertus Lutterbach - Страница 12
a) Hape Kerkeling und andere Pilgerberichte
ОглавлениеHeutige Pilger bezweifeln vieles, was früher selbstverständlich geglaubt wurde: die Echtheit der Heiligenknochen, die Möglichkeit eines Wunders am heiligen Zielort oder den „Heilsnutzen“ einer solchen Strapaze auch für ein jenseitiges Fortleben. Stattdessen verbinden sie mit dem „Ausgeliefertsein“ auf dem Pilgerweg erstrangig neue Impulse für die möglichst entschiedene, individuelle und selbstbestimmte Fortsetzung des eigenen Lebensweges.18 Die vier Santiago-Pilger Hape Kerkeling, Lee Hoinacki, Carmen Rohrbach und Paulo Coelho, die sich den Mühen des weiten Weges ausgesetzt haben, veranschaulichen diese Feststellung in ihren Pilgerberichten auch durch die Art, wie sie sich – abgrenzend oder anknüpfend – auf die Geschichte der christlichen Pilgerschaft beziehen.
Kaum jemand hätte von dem bekannten Unterhaltungskünstler Hape Kerkeling erwartet, dass er, der erfolgsverwöhnte Showmaster, in eine Sinnkrise gerät und im Anschluss erst einmal nach Santiago de Compostela pilgert. Doch genau das tat er: „Da ich gerade einen Hörsturz und die Entfernung meiner Gallenblase hinter mir habe, zwei Krankheiten, die meiner Einschätzung nach großartig zu einem Komiker passen, ist es für mich allerhöchste Zeit zum Umdenken – Zeit für eine Pilgerreise. […] Wütend darüber, dass ich es so weit habe kommen lassen, bin ich immer noch! Aber ich habe auch endlich wieder meiner inneren Stimme Beachtung geschenkt, und siehe da: Ich beschließe, während der diesjährigen Sommermonate keinerlei vertragliche Verpflichtungen einzugehen und mir eine Auszeit zu spendieren.“19
Die Suche nach sich selbst ist tatsächlich Hape Kerkelings Hauptmotivation für sein Wandern auf dem Jakobsweg: „Als ich mit einer Fahrkarte den Bahnhof verlasse und mich gerade wieder frage, was ich hier eigentlich tue […], ob das alles denn auch vernünftig ist […], und überhaupt […] sehe ich vor mir ein Riesenwerbeplakat für eine neue Telekommunikationserrungenschaft mit dem Slogan: ,Wissen Sie, wer Sie wirklich sind?‘ Meine Antwort ist spontan und unumwunden: ,Nein, pas-du-tout!‘“20
Umso mehr quält ihn die Frage, wer er selbst ist, weil er sie auch für seine Gottesbeziehung als entscheidend ansieht: „Anscheinend weiß ich ja nicht mal so genau, wer ich selbst bin. Wie soll ich da herausfinden, wer Gott ist? Meine Frage muss also erst mal ganz bescheiden lauten: Wer bin ich? Damit wollte ich mich ursprünglich zwar nicht beschäftigen, aber da ich ständig von Werbeplakaten dazu aufgefordert werde, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Also gut – als Erstes suche ich nach mir; dann sehe ich weiter. Vielleicht habe ich Glück und Gott wohnt gar nicht so weit weg von mir. Sollte er jedoch in Wattenscheid leben, wäre ich hier allerdings ganz falsch!“21 In schonungsloser Ehrlichkeit hält er als Fazit des ersten Tages in seinem Pilgertagebuch fest: „Erkenntnis des Tages – Erst mal herausfinden, wer ich selbst bin.“22
Die Suche nach sich selbst erweist sich für den Pilger Hape Kerkeling als das tragende Motiv seiner gesamten Tour. Sein Pilgerbericht ist durchzogen von entsprechenden Tagesrückblicken: „Erkenntnis des Tages – Ich bin in mir zu Hause.“ Oder: „Erkenntnis des Tages – Keep on running. Ich halte mehr aus, als ich denke!“ Oder: „Erkenntnis des Tages – Es ist keine Frage der Zeit, wo man sich zu Hause fühlt.“ Oder: „Erkenntnis des Tages – Es ist die Leere, die vollends glücklich macht.“ Er sieht sich in einer großen inneren Nähe zu den vielen Pilgern, die gleichfalls mit der Frage nach sich selbst unterwegs waren: „Mit all den Menschen, die diesen Weg gegangen sind, fühle ich mich hier mit einem Male verbunden, mit ihren Wünschen, Sehnsüchten, Träumen, Ängsten, und ich spüre, dass ich diesen Weg nicht allein gehe.“23
Das Unterwegssein auf dem Jakobsweg hilft Hape Kerkeling, seine Suche nach sich selbst mit anderen religiösen Themen und Traditionen in Verbindung zu bringen. So fragt er sich, was eigentlich eine Erleuchtung sei und in welcher Weise sie einem am ehesten widerfahren könnte: „In meinem allwissenden Reiseführer steht, dass dieser Weg ein Erleuchtungsweg ist. Ich glaube allerdings, es ist ein Weg ohne Erleuchtungsgarantie. So wie Urlaub keine Erholungsgarantie bietet. Gut, ich will nicht zu viel erhoffen, aber Erleuchtung wäre schon nicht schlecht! Was immer das auch ist! Ich stelle mir die Erleuchtung wie ein Tor vor, durch das man schreiten muss. Wahrscheinlich darf man keine Angst haben, durch das Tor zu treten, und man darf es sich andererseits auch nicht zu sehr wünschen, hindurchzugehen. Je gleichgültiger man durch das Tor der Erleuchtung zieht, desto schneller und einfacher passiert es vielleicht? Man darf sich nicht nach dem sehnen, was hinter dem Tor ist, und nicht das hassen, was vor dem Tor ist. Es ist gleichgültig. Vielleicht ist Gleichgültigkeit ja Lebensfreude? Keine Erwartungen, keine Befürchtungen.“24
Besonders am letzten Tag des langen Weges wendet Hape Kerkeling seinen Blick von sich selbst auf den Zielort. Mit den vielen anderen Pilgern singt er das berühmte Pilgerlied, das die Anziehungskraft von Compostela zum Ausdruck bringt:
Jeden Tag nehmen wir den Weg,
Jeden Tag laufen wir weiter, weiter, weiter.
Tag für Tag ruft uns der Weg,
Es ist die Stimme von Compostela.25
Im Singen des Liedes empfindet sich Hape Kerkeling in Harmonie mit den vielen anderen Pilgern: „Da es im Wald ansonsten still ist, können wir sogar mit entfernt vor uns pilgernden Gruppen im Kanon singen. Ein absurdes Gefühl mit Menschen, die man gar nicht sieht und nie kennen wird, im Gleichklang zu singen. Wir stimmen in einen mystischen Chor mit Abwesenden ein.“26 Als er kurz darauf den Kathedralenvorplatz von Santiago de Compostela mit all dem bunten Treiben erreicht, spricht er von seinem Eintritt in den „Pilgerhimmel“. Der Empfang der Pilgerurkunde geht ihm so nahe, dass er sogar ihren lateinischen Text wiederholt:
Dominum Joannem Petrum Kerkeling hoc sacratissimum Templum pietatis causa devote visitasse. In quorum fidem praesentes litteras, sigillo ejusdem Sanctae Ecclesiae munitas, ei confero! Datum Compostellae die 20 mensis Julii anno Domini 2001.27
Im anschließenden Pilgergottesdienst wird er persönlich begrüßt. Den Ritus empfindet er wie aus einer anderen Welt: „Wir kommen uns vor wie im Jenseits.“ Doch hält ihn das gemeinschaftliche religiöse Erleben letztlich auf dem Boden: „Mit heißroten Backen und den schweren Rucksäcken stehen wir freudig erschöpft da. Natürlich umarmen wir im Anschluss an die Zeremonie, wie es sich gehört, die goldene Statue des Sankt Jakob über dem Apostelgrab.“28
In einem abschließenden Gedanken fasst Hape Kerkeling zusammen, wie er seine eigene Suche nach vertiefter Identität und den Traditionsreichtum des Pilgerweges miteinander verbunden sieht: „In unserer nahezu entspiritualisierten westlichen Welt mangelt es leider an geeigneten Initiationsritualen, die für jeden Menschen eigentlich lebenswichtig sind. Der Camino bietet eine echte, fast vergessene Möglichkeit, sich zu stellen. Jeder Mensch sucht nach Halt. Dabei liegt der einzige Halt im Loslassen.“29 Hape Kerkeling sieht den Camino gewissermaßen als einen von heiligen Traditionen und gläubigen Menschen vieler Jahrhunderte geprägten und göttlich „aufgeladenen“ Raum, der ihm in der Begegnung die Selbstannahme ermöglicht: „Gott ist das ,eine Individuum‘, das sich unendlich öffnet, um ,alle‘ zu befreien.“30
Inwieweit akzentuieren auch andere Berichte von Santiago-Pilgern der letzten Jahre die Suche nach der eigenen Identität und sprechen dabei zugleich religiösen Traditionen eine Orientierungskraft zu?
Viele deutschsprachige Pilgerberichte der vergangenen Jahre faszinieren, weil sie die individuelle Sinnsuche in Bezug setzen zu religiösen Vorgaben. Am ehesten lässt sich dieser doppelte Akzent anhand der Literaturhinweise erkennen, die bisweilen am Schluss der Pilgerberichte angefügt werden: „Erfahrungsberichte“ und „spirituelle Wegbegleiter“ finden sich hier, überdies Leseempfehlungen zur „Kulturgeschichte des Pilgerns und der Pilgerorte“ sowie Listen mit nützlichen Adressen für die Organisation des eigenen Pilgerns.31 – Eben diese Mischung aus persönlichen Reflexionen mit bisweilen existenziell-religiösen Fragestellungen einerseits und ortsbezogen-konkreten Eindrücken im Sinne eines Reiseberichts andererseits bestätigen auch die folgenden Beispiele.32
Einen eher „mystisch“ ausgerichteten Pilgertyp verkörpert der Philosoph, Theologe und Ökonomieprofessor Lee Hoinacki mit seinem 1997 auf Deutsch erschienenen Titel „El Camino“ – Ein spirituelles Abenteuer. Allein auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela33: Als Pilger, der ehedem als Mitglied des Dominikanerordens in Lateinamerika arbeitete und später als Professor für Politologie tätig war, geht es ihm auf seinem Pilgerweg darum, dass er die Orte und deren Traditionen auf seine ganz eigene Art wahrnimmt: „Nun passen meine Schuhe genau in die Fußspuren von Tausenden, vielleicht Millionen, die vor mir hierher kamen und die zu demselben Ort gingen, zu dem ich jetzt gehe. Doch weiß ich aus den ,relatos‘ und der Reflexion über meine eigene Erkenntnis, dass wir alle sehr verschieden sind, jeder sucht die eigene Gnade, ein inniges, nicht mitteilbares Geheimnis in jeder Seele.“34
In einer anderen Tagebucheintragung hält Lee Hoinacki fest, wie stark er sich auch mit seiner Gottesbeziehung als „kleiner“ Pilger in die „große“ Pilgergeschichte hineinverwoben sieht: „Ich bin noch weiter in die Welt der alten Pilger hineingereist.“ Ihnen gegenüber empfindet Lee Hoinacki eine besondere Solidarität. Als Teil ihrer Pilgergemeinschaft fühlt er sich zugleich verbunden mit dem Leiden Christi, ja mit dem Leiden aller Menschen: „Wie ich schon verstanden habe, beteiligt sich der Schmerz notwendigerweise und unvermeidlicherweise an dem Schmerz des Herrn. Er ergänzt, was an dem Schmerz des Herrn fehlt. Daher muss mein Gebet für einen anderen ähnlich wirkungsvoll sein.“35
Andere Akzente als Hape Kerkeling und Lee Hoinacki setzt die Naturwissenschaftlerin Carmen Rohrbach in ihrem 1999 veröffentlichten Pilgerbericht Jakobsweg. Wandern auf dem Himmelspfad36. Ihre Beschreibung zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich auf dem Jakobsweg im ziellosen Kreislauf des Kosmos erlebt, der überhaupt nicht am Wohl des Individuums interessiert ist. Umso erstaunlicher wirkt es, dass die Autorin während ihrer Pilgerschaft zugleich eine besondere Geborgenheit fühlt. Ihre ehrliche Offenheit für die kosmische Einsamkeit des Menschen führt sie in eine Harmonie mit Gott und mit sich selbst. Am eindrucksvollsten bringt sie diesen schöpferischen Zusammenhang von allem Sein in der Passage zum Ausdruck, die über ihren weiteren Weg von Santiago de Compostela an jenen noch etwa 15 Kilometer entfernten Ort am Meer berichtet, den das Mittelalter mit dem biblischen „Ende der Welt“ (Finisterrae) identifizierte: „Es ist schön, wieder unterwegs zu sein. Von Santiago de Compostela hatte ich Abschied genommen. Eine wichtige Erfahrung für mich, doch konnte sie nicht der Abschluss meiner Pilgerreise sein. Ich glaube, erst wenn ich das ,Ende der Welt‘, Finisterrae, erreiche, wird sich mein Unterwegssein wirklich mit Sinn erfüllen. Ich denke darüber nach, was die Bezeichnung ,Ende der Welt‘ für mich bedeutet. Es klingt nach absolutem Ende: Ende der Welt – Ende des Lebens. Das ist aber für mich keine schreckliche Vorstellung. Nicht mehr als Lebewesen existent zu sein, ist für mich ein befreiender Gedanke. Die Auflösung ist eine Erlösung von der Verantwortung als Individuum. Meine Substanz als Einzelwesen kann sich dann überall hin verteilen, in alles einfließen, wieder dem Gesamten angehören.“37 Der Ort „Finisterrae“ lässt Carmen Rohrbach ihr Leben vom Ende her denken. So fällt sie während ihrer Pilgerschaft an diesem Ort die Lebensentscheidung, fortan allein zu leben.
Mehr als alle anderen bislang angesprochenen Pilgerberichte bezieht der von Paulo Coelho verfasste und 1999 auf Deutsch erschienene Pilgerbericht Auf dem Jakobsweg. Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela religiöse Gebräuche und Deutungen mittelalterlicher Menschen ein.38 Diese Perspektive geht darauf zurück, dass der Autor zuvor über fünf Jahre hinweg in einer christlichen Gemeinschaft gelebt hatte („Regnus Agnus Mundi“), die 1492 gegründet worden war.
Paulo Coelho geht seinen Pilgerweg als Ausgleich für die ihm innerhalb der geistlichen Gemeinschaft verweigerte „Meisterweihe“. So beschreibt er sich als „Hochleistungsasket“. Sein religiös motivierter Verzichtseinsatz steht im Kontrast zu allen hier ansonsten vorgestellten Pilgerberichten. Doch eröffnet sich ihm nach allen Anstrengungen und nach allem Mühen schließlich eine gänzlich neue spirituelle Dimension: das Beschenktwerden. Er selbst hält diese innere Wende in bewegenden Worten fest: „Hier nun, kurz vor Cebreiro [in der Nähe von Santiago], merkte ich, dass das Wunder geschehen war. Bisher war ich den Jakobsweg gegangen, jetzt ,ging er mich‘“, wie Paulo Coelho überwältigt erkennt.39
Die unterschiedlichen Gesamtperspektiven der Pilgerberichte wirken sich auch auf die jeweilige Sicht des Wallfahrtsortes Santiago de Compostela aus. Lee Hoinacki und Carmen Rohrbach stimmen mit Hape Kerkeling darin überein, dass sie den Pilgerweg wichtiger finden als den Zielort. Die drei Pilger erleben ihre Ankunft beim heiligen Jakobus nicht als das Erreichen eines erhabenen Ortes, der Geborgenheit und Sicherheit ausstrahlt. So distanziert sich Lee Hoinacki ausdrücklich von jeder Gebeinverehrung im Zentrum der Kathedrale: „Ich habe nicht den Wunsch, irgendeine Reliquie zu sehen oder zu berühren.“40 Stattdessen bringt er seine inneren Begegnungen mit den Pilgern auf seinem Lebensweg und auf seinem Jakobsweg als seine ganz persönliche Berührung von Reliquien ins Wort: „Ich existiere nur insoweit, wie ich an den unzähligen Handlungen teilnehme, die in ihrer Summe die lebendige Tradition begründen, die mein Erbe ist, das meine Eltern und die Pilger mir gegeben haben. All die ,inneren‘ Erfahrungen dieser vier Wochen haben sich nur insofern ereignet, als sie wirkliche Verbindungen mit den Erfahrungen der Toten hatten, die mich begleitet haben. Ich habe gelernt, wie ich ein ehrliches ,wir‘ aussprechen muss, etwas grundsätzlich anderes als das unechte und selbstherrliche ,wir‘, das man heutzutage so oft hört. Die Reliquien, die ich berühre, das sind sie, das ist ihre wirkliche Anwesenheit. Ich habe sie getroffen, umarmt und geküsst; ihre Lippen waren nicht kalt. […] Die meisten sind dort draußen, auf dem ,camino‘, und warten darauf, den Pilger von heute willkommen zu heißen.“41
Ähnlich gefasst beschreibt Carmen Rohrbach ihre Ankunft in Santiago de Compostela in ausdrücklicher Abgrenzung von den mittelalterlichen Pilgergesängen („Herr Sankt Jakob, Großer Sankt Jakob, vorwärts jetzt und immerdar, Gott helfe uns“): „So sangen sie. Ich aber verspürte keinen Freudenrausch. Seltsam nüchtern stellte ich nur fest, dass ich nun wohl angekommen war. Das sollte mein Ziel sein, diese große Stadt? Aber was hatte ich denn anderes erwartet? Etwas Besonderes, ohne mir dessen jedoch ganz bewusst gewesen zu sein. Ich fühlte mich plötzlich innerlich sehr müde. Ich dachte, ich müsste einfach an diesem Wirrwarr der Dächer, Kirchtürme vorbeiwandern, einem imaginären Ziel entgegen, ohne jemals anzukommen.“42 Und mit Blick auf das Heiligtum des heiligen Jakobus hält sie fest: „Am stärksten in der Kathedrale beeindrucken mich die Menschen. Zu jeder Tageszeit habe ich in dem Gotteshaus Gläubige angetroffen, versunken in stiller Andacht.“ Einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen bei ihr die zahlreichen Pilger, die die Statue des Heiligen umarmen: „Mich berührt der feierliche Ernst dieser Leute, aber mich erschüttert die Macht, die der Glaube auf die Vernunft ausübt.“43 – Auch mit Santiago de Compostela vor Augen erleben die beiden Autoren die Ausdrucksweisen christlicher Religion nicht so, als ob sie Gewissheit stifteten. Diese Beobachtung ist umso erstaunlicher, da der Jakobsweg mit seiner reichen mittelalterlichen Bausubstanz und der Zielort mit seinen legendarischen Sinnzuschreibungen einen für heutige Verhältnisse geschlossenen weltanschaulichen Deutungskosmos anbieten.
Allein der Pilgerbericht von Paulo Coelho ist von einem tiefen inneren Wissen um jahrhundertealte Glaubenstraditionen, ja vom Bemühen um die möglichst originalgetreue Übernahme der mittelalterlich-christlichen religiösen Ausdrucksformen durchzogen. So kann er mit Blick auf die in einer kleinen Kirche am Rande des Jakobsweges versammelten Reliquien – in diesem Falle Reste von konsekriertem Brot und Wein – hervorheben: „Die Reliquien, ein Schatz, der größer ist als aller Reichtum des Vatikans, werden noch immer dort in der kleinen Kapelle aufgehoben.“44 Coelhos Wertschätzung der Jakobusreliquien am Zielort seines Pilgerweges findet in seiner Erzählung ebenso klare wie knappe Erwähnung: „Bald werde ich zum Grab des heiligen Jacobus gehen und die auf die Jakobsmuscheln montierte Statue der heiligen Jungfrau von Aparecida dort niederlegen. Anschließend werde ich so bald wie möglich zurück nach Brasilien fliegen, denn ich habe viel zu tun.“45
Kurzum: Mit Ausnahme der Darstellung von Paulo Coelho tun die einbezogenen Berichte kund, dass die Pilgernden das „Eigentliche“ ihrer Pilgerschaft nicht länger im Zielort – in der Begegnung mit dem Heiligen in seinen Reliquien –, sondern in der Begegnung mit sich selbst und den Mitsuchenden auf dem Pilgerweg sehen. Auch eine praktisch-theologische Auswertung von aktuellen Pilgerberichten kommt hier zu einem vergleichbaren Ergebnis: „Die Verehrung des Apostels im traditionellen Sinn spielt heute nur noch bei den wenigsten Pilgern und Pilgerinnen eine Rolle. Für die meisten ist es nicht besonders wichtig, ob in dem Grab in der Kathedrale von Santiago nun tatsächlich die Knochen des Apostels liegen. Was zählt, sind die entlang des Weges gemachten Erfahrungen.“46 So ist die Pilgerschaft aktuell erstrangig geprägt von der Vertiefung der eigenen Individualität sowie von einem Mühen um Ganzheitlichkeit (Leib – Seele, Außenorientierung – Innenorientierung, Geschichte – Gegenwart etc.), jedoch kaum von institutionellen Vorgaben.