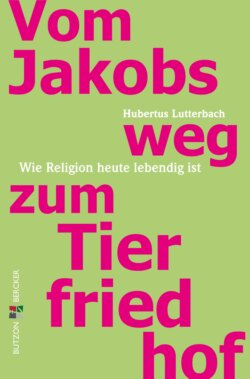Читать книгу Vom Jakobsweg zum Tierfriedhof - Hubertus Lutterbach - Страница 5
Einleitung
ОглавлениеÜber Jahre hinweg habe ich als ehrenamtlicher Sterbebegleiter in einem Hospiz gearbeitet und Menschen in ihrer letzten Lebensphase unterstützt. Ich habe Schwerkranke erlebt, die von sich sagten, dass sie jahrzehntelang ihr Leben gemäß den kirchlichen Vorgaben gestaltet hätten. Doch in ihren letzten Wochen und Tagen hatten sie kein Verlangen mehr nach den ihnen vertrauten äußeren Zeichen. Stattdessen zogen sie sich in ihre eigene Stille zurück, waren wach für den Augenblick, öffneten sich für musiktherapeutische Angebote oder richteten ihre Blicke auf schöne Fotos. Umgekehrt traf ich auf Menschen, die mit ihrer grundsätzlichen Offenheit für Spiritualität keinen Kontakt zu einer verfassten Kirchlichkeit gepflegt hatten, allerdings in der Situation ihrer schweren Krankheit das Gespräch mit dem Pfarrer suchten, das Gebet guter Freunde erbaten oder sogar die Spendung des Krankensakramentes wünschten.
Während meiner Jahre im ehrenamtlichen Dienst der Telefonseelsorge habe ich immer wieder erlebt, wie überraschend sich „Religion“ in der Vielfalt der Lebensgestaltung zeigen kann – sowohl unter den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch bei den anonymen Anruferinnen und Anrufern. Ehrenamtliche, die sich schon vor Jahren vom kirchengemeindlichen Leben abgewandt hatten, schildern ihre Arbeit in der Telefonseelsorge als ihre eigentliche christliche Praxis. „Mein Gottesdienst ist die Nächstenliebe“, formulieren einige. Vom menschenfreundlichen Klima unter den Ehrenamtlichen inspiriert, fragen sie: „Kann es mehr Religion geben, als wenn Menschen sich in einem Geist der Aufmerksamkeit und der Gastfreundschaft miteinander verbunden fühlen und für Ratsuchende oder Einsame da sind?“ – Wie oft habe ich es erlebt, dass Anruferinnen und Anrufer zu Beginn eines Telefonates bei der Telefonseelsorge fragen: „Sind Sie Priester?“, und auf meine verneinende Antwort spontan reagieren mit den Worten: „Das macht auch nichts, Hauptsache Sie sind ein Seelsorger.“
Im Bereich der ehrenamtlichen Gefangenenbetreuung sagt mir ein Gefangener: „Ob ich Christ bin, weiß ich nicht. Ich gehöre jedenfalls keiner Kirche an. Aber den Rosenkranz, den habe ich in meiner Zelle über dem Bett hängen und bete ihn täglich. Das brauche ich einfach.“ Ein anderer Gefangener betätigt sich bei der sonntäglichen Messe als Ministrant: „Das ist für mich die einzige Möglichkeit, mal aus der grauen Unscheinbarkeit aufzutauchen und mich meinen Mitgefangenen gegenüberzustellen, auch wenn ich von denen für diesen Dienst eher mit Verachtung als mit Bewunderung angeschaut werde.“
Zuletzt denke ich an eine kürzlich verstorbene, akademisch gebildete und hochbetagte langjährige Nachbarin, die sich selbst als Anhängerin sowohl des Anthroposophen Rudolf Steiner († 1925) als auch des Dalai Lama bezeichnete. Von beiden Vorbildern hatte sie beinahe das gesamte Schrifttum gelesen. Mit Blick auf ihre Nachbarschaft vor Ort sagte sie oft mit einem Schmunzeln: „Dass ein katholischer Theologe und ein evangelischer Allgemeinmediziner neben mir wohnen und ich mit beiden befreundet bin, betrachte ich als das Glück meines Alters. Was soll mir denn da noch passieren?!“
Die vorgetragenen Schlaglichter zur aktuellen Gestaltung religiös beeinflussten Lebens zeigen individuelle Zugangswege und persönliche Ausdrucksweisen. Über ihre Suche nach Authentizität hinaus stimmen sie im Bemühen um eine ganzheitliche Alltagsgestaltung und in der Überzeugung einer gewissen Institutionenskepsis überein.
Die angesprochene Vielfalt der Lebensgestaltung unter Einschluss des Faktors „Religion“ ist auch im öffentlichen Leben unseres Landes gegenwärtig: Seit fast zwanzig Jahren moderiert Jürgen Domian allabendlich seinen in Radio und Fernsehen übertragenen „EinsLive Talk“. Als das Ziel seiner live übertragenen Telefongespräche mit inzwischen weit mehr als 20.000 Anruferinnen und Anrufern über Themen wie Glück, Liebe, Sexualität, Glauben, Papst, Politik, Krankheiten, Tod etc. formuliert er: „Ich frage die Leute alles, und die Leute können mich alles fragen.“ Auch während seiner Sendungen will Domian „Privatperson bleiben“: „Nur so entsteht Vertrauen“, unterstreicht er.1 Ebenso versteht er sich in seinem monografisch publizierten „Interview mit dem Tod“, das der ehemalige evangelische Christ nach dem Tod seines Vaters aus einer nunmehr buddhistisch beeinflussten Fragehaltung führt, als „Privatperson“: persönlich ehrlich, ganzheitlich ausgerichtet und institutionenskeptisch vorsichtig.2
Nicht zuletzt zeigen sich die Spuren religiösen Lebens aktuell in den Bereichen Sport und Musik. Ohne hier näher auf die auch wissenschaftlich heiß diskutierte Frage einzugehen, wie weit die Parallelen von Fußball und Religion tatsächlich reichen, sei immerhin an den beliebten Song „An Tagen wie diesen“ erinnert. Mit diesem Lied, das reich ist an religiösen Anspielungen und Bildern („Das hier ist ewig, ewig für heute“), besingt die Musikgruppe „Die toten Hosen“ wie selbstverständlich den Fußball ihrer Lieblingsmannschaft. Auch hier stimmen individueller Enthusiasmus („Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht“), Gemeinschaftszugehörigkeit als Ausdruck der Ganzheitlichkeit („Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom“) und eine gewisse Institutionenskepsis eine Rolle („An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. Wünsch ich mir Unendlichkeit“).
Schon lange lassen mich die vielfältigen Ausdrucksweisen religiösen Lebens in der Gegenwart aufmerken und wecken immer wieder neu mein Interesse. Dass aus dieser Beobachtungsfreude ein Buch geworden ist, verdanke ich meinen Theologie- und Philosophiestudierenden an der Universität Essen ebenso wie manchen Rückfragen meiner Kolleginnen und Kollegen. Sie haben mich zu einer solchen Orientierungshilfe angeregt. Uns alle bewegt die Frage nach der Deutung von religiösem Leben in der Gegenwart. Um dieses Projekt, das den Fragehorizont vieler wacher Zeitgenossen erreichen mag, möglichst konkret zu gestalten, mische ich mich in die wissenschaftliche Diskussion mit zehn ausgewählten Fallstudien ein.
Der in Berlin lehrende Religionssoziologe Hubert Knoblauch teilt die wissenschaftliche Frage nach der Ausdeutung des gegenwärtigen Alltagslebens unter Einschluss des Religiösen3: „Die Vielfalt der gegenwärtigen Lebensführung schreit geradezu nach einer Beschreibung, die die Unübersichtlichkeit der eigenen Lebenswelt überwinden hilft. Denn während wir über historische Religionen (und historische Texte heutiger Religionen) enorm viel wissen, beschäftigen sich nur wenige mit dem, was man die gelebte Religion nennen kann. Das Verhältnis der Forschungen, die sich mit historischen Texten beschäftigen, zu denjenigen, die die gelebte Religion erkunden, fällt nach wie vor überdeutlich zu Ungunsten der Gegenwartsreligion aus. Entsprechend wissen wir zwar sehr viel über die ,Tradition‘ und die ,Schriften‘, wenig aber über die gelebte Religion der heutigen Menschen.“4
Die „gelebte Religion“ zeigt sich heutzutage vielfältig als „populäre Religion“: Genauerhin bildet die populäre Religion die Schnittmenge zwischen populärer Kultur und Religion und entwickelt sich zu einer immer bedeutenderen Arena, in der weltanschauliches und religiöses Wissen gelebt und vermittelt werden. So formt sie es in Weisen, die den sozial und kulturell unterschiedlichen Anforderungen der Subjekte auf den Leib geschnitten sind. Es verdient ausdrückliche Hervorhebung, dass die populäre Religion die Kommunikation in den Kirchen ebenso wie die zwischen den Kirchen und ihren Mitgliedern mit umfasst. Anders gesagt: Aufgrund der Mitberücksichtigung der spezifischeren kirchlichen religiösen Kommunikation geht der Fokus dieses Buches über die populäre Spiritualität mit ihrer Betonung von Erfahrung und Gefühl sowie mit ihrer Abstinenz hinsichtlich Lehre und geprägter Deutungsmuster deutlich hinaus.
Das vorliegende Buch greift das durch den Religionssoziologen Hubert Knoblauch formulierte Desiderat („Erforscht die gelebte Religion!“) in zweifacher Hinsicht auf. Erstens bietet es ausgewählte aktuelle Beispiele dafür, wo und wie Religion in ihren gelebt-populären Ausdrucksweisen im unübersichtlichen Alltag eine Rolle spielt. Wo lässt sich Religion „dingfest“ machen und wie wirkt sie sich in ihrer konfrontierenden Kraft oder in ihren hilfreichen Zeichen aus? Zweitens werden die zutage geförderten Ausprägungen von „gelebter Religion“ historisch eingeordnet: Inwieweit sind innerhalb des aktuell religiös pluriformen Verstehenshorizonts auch christentumsgeschichtlich geprägte „Erzählfiguren“ im Spiel? Sind sie den gegenwärtigen Akteuren unbekannt oder bekannt? Wie werden sie weitererzählt – in traditionellen oder neuartigen Weisen – und mit welchen Wirkungen? Überdies können die Leserinnen und Leser des vorliegenden Buches aus den historischen Vergewisserungen für ihr eigenes Religions- und Sozialleben umso mehr Orientierung ziehen.