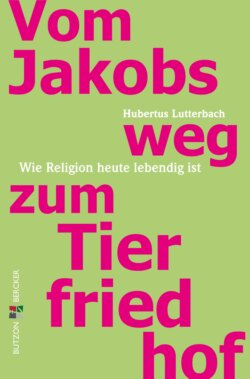Читать книгу Vom Jakobsweg zum Tierfriedhof - Hubertus Lutterbach - Страница 14
Christliche Sakralorte und Pilgerschaft
ОглавлениеBekanntermaßen berichten die Evangelien, dass Jesus in seinem Erdenleben vielfältig umherzog und dass seine Anhänger ihn begleiteten. Unvorstellbar aber ist, dass Jesus eine christliche Wallfahrt angestoßen oder gar einen christlichen Pilgerweg initiiert hätte. Auch seine Jünger und Apostel richteten solche Gedenkstätten nicht ein.
In der Spur des Alten Testaments leiteten die frühen Christen jede Heiligkeit von der alles überstrahlenden Heiligkeit Gottes ab (Habakuk 1,12; Habakuk 3,3). Gemäß alttestamentlicher Überzeugung kann Gott auch „Menschen und Dingen, Orten und Zeiten“ Anteil an seiner Heiligkeit geben, sodass sie dadurch fortan aus der profanen Umgebung ausgesondert sind.49 Sogar eine Vermischung aus personen- und ortsgebundener Heiligkeit bezeugen die jüdischen Traditionen. Insofern seit der makkabäischen Verfolgung im 2. Jahrhundert v. Chr. die Blutzeugen und Märtyrer als besondere Freunde Gottes galten, wurden auch ihre Gräber geehrt und als Kraftquellen wertgeschätzt: „Die Wirkkraft des verstorbenen Gerechten geht von seinem Grabe aus, und deshalb werden die Heiligengräber von den Juden der jesuanischen Zeit hoch in Ehren gehalten.“50
In Abgrenzung vom Alten Testament überliefert das Neue Testament eine ortsunabhängige Vorstellung von Sakralität. Heiligkeit manifestiert sich in der Begegnung zwischen Gott und den Menschen ebenso wie im zwischenmenschlichen Kontakt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus 18,20) Von Gebäuden und ihren Einzelkomponenten sprechen die frühen Christen allenfalls metaphorisch, um das Miteinander zwischen Gott und den Menschen zu verdeutlichen: Christus als Eckstein, die Gläubigen als lebendige Steine, die Gemeinde als geistiges Haus (Epheser 2,20; 1 Petrus 2,5). Auch die Rede vom Christen als „Tempel des Heiligen Geistes“ gehört in diesen Bereich der bildhaften Rede (1 Korinther 6,19).
Tatsächlich machte das frühe Christentum als eine mobile Religion auf sich aufmerksam. Anstatt dass sich ihre Anhänger zu einem Haus Gottes begaben, vertrauten sie auf das Kommen Gottes in ihre Mitte: „In jedem Raum durfte und konnte sich die Gemeinde zur Eucharistie und zum Gebet versammeln.“51 So zählt es zu den Besonderheiten der frühen christlichen Tradition, dass sie im Unterschied zur gesamten antiken Welt „keine christliche Sakralarchitektur“ hervorgebracht hat.52 Ebenso wenig kannte das früheste Christentum irgendwelche Kultgegenstände, weder heilige Bilder noch heilige Statuen. Die „christliche Ortlosigkeit“53 wurzelte in der Überzeugung von Gottes „Allanwesenheit“54 und machte nicht zuletzt jedwedes Wallfahrtswesen überflüssig.
Schon ab dem 2. Jahrhundert sollte sich das christliche Anfangsplädoyer zugunsten der Ortlosigkeit relativieren. So erhielt die Wertschätzung des Heiligengrabes ihren größten Schub durch die Verehrung der blutig gestorbenen christlichen Märtyrer. Aufgrund ihrer Überzeugungsstärke zu Lebzeiten galten sie auch über ihren Tod hinaus als „Orte“ göttlicher Präsenz.
Wie stellten sich die Christen die Anwesenheit Gottes im begrabenen Märtyrer und Heiligen genau vor? Maßgeblich war die bis weit über das Mittelalter hinaus leitende Vorstellung einer „Doppelexistenz des Heiligen im Himmel und auf Erden“. Man sieht den begrabenen Leib und die in den Himmel aufgefahrene Seele in einem „bleibenden Verbund“55. So gelten die Heiligen in ihren Gräbern als äußerst gotterfüllt und wirkmächtig, theologisch gesprochen: als „realpräsent“56. Die Annäherung an den heiligen Leib – mehr noch: die Berührung der Gebeine – vermittelt dem Menschen göttliche Kraft. Entsprechend dieser Vorstellung verwandeln sich alle Personen und Gegenstände, die mit einem solchen Grab in Kontakt kommen, indem sie diese göttliche Kraft in sich aufnehmen.
Auf die Dauer sollte sich im Christentum eine Mischung aus ortsbezogener und personaler Heiligkeit durchsetzen. Genau genommen beruhte die Wertschätzung der Pilger- oder Wallfahrtsorte darauf, dass man sich den dort in seinem Grab ruhenden Heiligen als einen mit göttlicher Kraft erfüllten Fortlebenden vorstellte.57 In diesen himmlisch garantierten Wirkmöglichkeiten und im Wunsch nach der unmittelbaren Begegnung mit dem Heiligen liegt der Ursprung all jener Wallfahrtsorte, die auf die Pilger bis heute ihre Anziehungskraft ausüben.