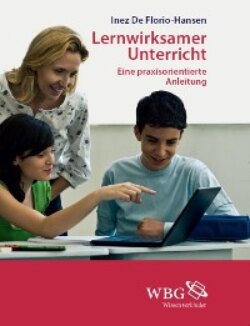Читать книгу Lernwirksamer Unterricht - Inez De Florio-Hansen - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Evidenz durch nicht-experimentelle Forschung
ОглавлениеExperimente mit großen Stichproben sind sehr aufwendig und werden deshalb im deutschsprachigen Raum nicht so häufig durchgeführt wie beispielsweise in den USA. Auch aus diesem Grund ist es oft unumgänglich, nicht-experimentelle Untersuchungen in die Betrachtung einzubeziehen, obgleich der Kausalzusammenhang fehlt, d.h. eine Zuordnung von Ursache und Wirkung nur eingeschränkt möglich ist. Aus der Fülle empirischer Forschungsansätze betrachten wir im Folgenden einige wenige Methoden, die für evidenzbasiertes Lehren und Lernen von Bedeutung sind.
In der Unterrichtsforschung werden häufig Quer- und Längsschnittuntersuchungen, sogenannte Korrelationsstudien, durchgeführt. Sie belegen Wechselwirkungen zwischen mindestens zwei Merkmalen. Es wird aber immer wieder darauf hingewiesen, dass die Wechselwirkung zwischen zwei Variablen keine Kausalität darstellt. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht diesen Sachverhalt: Man hat beobachtet, dass Schülerinnen und Schüler, die während des Unterrichts immer wieder einen Schluck Wasser trinken, konzentrierter mitarbeiten als Lernende ohne regelmäßige Wasserzufuhr. Daraus zu folgern, dass die verbesserte Konzentration ursächlich mit dem Wasserkonsum zusammenhängt, ist ein Fehlschluss. Zumindest bedarf diese Behauptung der Überprüfung durch ein Experiment. Dann kann sich zeigen, dass die höhere Konzentration vermutlich andere, durch den Unterricht und/oder sonstige Faktoren bedingte Ursachen hat.
Bei Querschnittsuntersuchungen werden unabhängige und abhängige Variablen zum gleichen Zeitpunkt ermittelt. Durch eine Befragung von Lernenden und Lehrpersonen wird beispielsweise der Einfluss einer bestimmten Unterrichtsmethode, die vor der Untersuchung eingesetzt wurde, auf die Lernleistung ermittelt. Aus Korrelationen wird dann fälschlich auf Ursache und Wirkung geschlossen. Längsschnittuntersuchungen verfahren in ähnlicher Weise wie Querschnittuntersuchungen, erheben die Wechselwirkung (Korrelation) aber mehrmals und zu verschiedenen Zeitpunkten. Diese Untersuchungsmethoden beruhen also nicht auf dem kontrollierten Einsatz einer Strategie, wie z.B. des concept mapping, und der Messung des Effekts auf die Schülerleistung durch Vor- und Nachtest. Dennoch bieten Quer- und Längsschnittuntersuchungen interessante Einblicke in unterrichtliche Zusammenhänge. Oft führen sie zu relevanten Forschungsfragen und haben schon allein deshalb ihre Berechtigung.
Auch die Ergebnisse empirisch-qualitativer Studien werfen häufig wichtige Fragen auf, denen man in experimentellen Untersuchungen oder mit anderen quantitativen Methoden nachgehen kann. Qualitative Untersuchungen gewähren darüber hinaus nützliche Einblicke in soziale und affektive Zusammenhänge, die mit anderen Forschungsmethoden nur unzureichend erfasst werden können. Wie wir noch sehen werden, beruhen (ältere und neuere) Lern- und Gedächtnismodelle sowie Motivationstheorien häufig auf Ergebnissen empirisch-qualitativer Forschung (vgl. Kap. 3 und Kap. 4).
Auf welcher Grundlage legt ein Forscher bei der Erstellung einer systematischen Übersichtsarbeit oder einer Meta-Analyse die Güte der vorhandenen Untersuchungen genau fest? Wie können wir selbst bei der Lektüre solcher Forschungsüberblicke besser einschätzen, wie hieb- und stichfest die vorliegenden Ergebnisse sind? Hier kann die evidenzbasierte Medizin für die Unterrichtsforschung richtungsweisend sein, obgleich es ohne Zweifel Unterschiede zwischen nachweisorientierter medizinischer Forschung und evidenzbasierter Pädagogik gibt. Gegen eine zu starke Orientierung evidenzbasierter Lehr- und Lernforschung an der medizinischen Forschung wird oft die ‚Faktorenkomplexion‘ von Unterricht angeführt. Die Wirkung des Medikaments A im Vergleich zu derjenigen von Medikament B sei hingegen relativ leicht zu belegen. Überschätzt man da nicht die Komplexität eines Bereichs, den man gut kennt, im Vergleich zu der einer anderen Wissenschaftsdisziplin?
Um der medizinischen Forschung Kriterien an die Hand zu geben, wie mit unterschiedlichen Untersuchungen umzugehen ist, gibt es eine Reihe verbindlicher Klassifizierungen (z.B. das Klassifikationssystem des ÄZQ, Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin oder dasjenige des Centre for Evidence-based Medicine in Oxford). Für das evidenzbasierte Lehren und Lernen ist die Klassifizierung der AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality; www.ahrq.gov) nützlich. Die AHRQ empfiehlt eine Unterteilung in fünf Evidenzklassen.
Abb. 2: Grade der Evidenz
Den höchsten Grad der Evidenz (Klasse I und Klasse II) erreichen hochwertige, randomisierte Experimente bzw. quasi-experimentelle Studien. Im mittleren Evidenzbereich (Klasse III) liegen gut angelegte, nicht-experimentelle deskriptive Studien (z.B. Vergleichs- oder Korrelationsstudien). Geringere Evidenz (Klasse IV und Klasse V) weisen beschreibende Studien sowie Expertenmeinungen auf. Diese Abstufung beruht auf der oben dargestellten Wertschätzung experimenteller Untersuchungen im Vergleich zu nicht-experimenteller Forschung. Die Ergebnisse der in den Klassen III, IV und V angeführten wissenschaftlichen Veröffentlichungen gelten daher als weniger aussagekräftig.