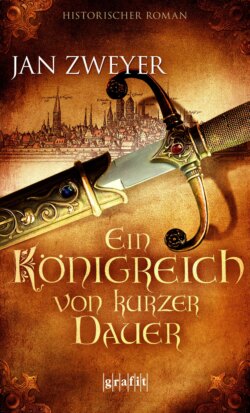Читать книгу Ein Königreich von kurzer Dauer - Jan Zweyer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 – Münster, 7. April 1531
ОглавлениеIn Münster brodelte es. Schon lange schwelte der Streit zwischen den alteingesessenen Patrizierfamilien und den aufstrebenden Handwerkern. Die Patrizier hielten an ihrer Herrschaft fest, heirateten nur untereinander und sicherten so in Verbindung mit dem Klerus ihre Pfründe. Die Handwerker hingegen forderten ihren Anteil an der Macht. Als die Patrizier dieses Ansinnen zurückwiesen, kam es zu einem Aufstand, der mit Gewalt niedergeschlagen wurde. Aber auf Dauer ließ sich der Unmut nicht unterdrücken.
Ein Ventil lieferte ein Mönch im fernen Wittenberg. Vierzehn Jahre war es her, dass Martin Luther seine Thesen an das Hauptportal der Schlosskirche geschlagen hatte. Fünfundneunzig Thesen, die das Fundament der katholischen Kirche ins Schwanken brachten.
Die benachteiligten Handwerker griffen nach der neuen Lehre wie Ertrinkende nach einem Strohhalm. Einige Jahre war es den Münsteraner Herrscherfamilien gelungen, die Bewegung unter Kontrolle zu halten. Als aber der Konflikt zwischen Klerus und Patriziern auf der einen Seite und den Handwerkergilden auf der anderen Seite offen ausbrach, fanden Letztere Unterstützung bei den Vertretern des neuen Glaubens.
In der Nacht vor Karfreitag versammelten sich auf dem Münsteraner Domplatz wenige Dutzend Menschen. Sie folgten einem Aufruf des Kaplans von Sankt Mauritz, Bernd Rothmann, der sich als charismatischer Prediger im Sinne der Ideen Luthers einen Namen in der Stadt und ihrer Umgebung gemacht hatte.
Rothmann ging weiter als Luther. Er prangerte die Zahl der Feiertage an, die zu groß sei, verkündete, der Gottesdienst sei vom Teufel, ebenso wie der Reichtum der Kirchen. Und als er auch noch erklärte, Kirchengut sei herrenlos und leicht zu gewinnen, liefen ihm die armen Leute in Scharen zu, in der Hoffnung, sich so ihrer Schulden zu entledigen. Aber auch bei einigen der wohlhabenderen Bürgern Münsters fielen seine Predigten auf fruchtbaren Boden. Zu faszinierend erschien das, was ein Mönch in Wittenberg losgetreten und Rothmann weitergedacht hatte.
Schon bald lief ein Gerücht durch die Menge: Bernd Rothmann habe gefordert, die Mauritzkirche, in der er selbst predigte, aufzusuchen und von den teuflischen Götzenbildern und dem eitlen Tand zu befreien. Rothmann warte dort bereits auf die Gläubigen. Deshalb sei er auch nicht auf dem Domplatz erschienen.
Mittlerweile war die Menschenansammlung weiter angewachsen. Zahlreiche Fackeln brannten. Lieder wurden gesungen.
Einige Hundert Gläubige machten sich schließlich, laut betend, auf den Marsch nach Osten, um der vermeintlichen Aufforderung ihres Kaplans zu folgen. Unter ihnen befanden sich viele jüngere Menschen wie der knapp zwanzigjährige Jobst, Sohn des Heinrich Xantus.
Jobst war wie sein Vater Schmied. Dementsprechend kräftig waren seine Muskeln. Fast immer ging er als Sieger aus den zahlreichen Streitereien mit anderen Männern hervor, in die er aufgrund seines aufbrausenden Wesens verwickelt wurde. Alles Zureden seines Vaters half nicht: Jobst liebte kaltes Bier, schweren Wein, das Würfelspiel und die Rauferei.
Schon mehrmals hatte sein Vater ihn davor bewahrt, wegen seiner Schlägereien vor Gericht gezerrt zu werden. Einige Groschen, die er den Opfern zahlte, ließen diese die Angriffe Jobsts schnell vergessen. Auch die Spielschulden seines Sohnes hatte der Schmied schon häufiger beglichen, damit sein Sprössling nicht im Schuldturm landete.
Jobst waren die theologischen Dispute, die die Münsteraner Gläubigen umtrieben, ziemlich egal. Er war mit seinen Freunden nur deshalb dem Aufruf Rothmanns gefolgt, weil ihn jedwede Auseinandersetzung magisch anzog. Und dass es zu einer solchen kommen würde, stand für ihn fest. Wenn er sich dann noch etwas aneignen konnte, was sich zu Geld machen ließ – umso besser. Darum hatte er sich auch an die Spitze des Zuges gestellt.
»Macht auf«, rief er der Stadtwache zu, als die Menge in den frühen Morgenstunden vor dem verschlossenen Mauritztor stand. »Wir wollen hinaus.«
Einer der Soldaten verließ das Wachhaus und hob die Laterne, um besser sehen zu können. »Wer will die Stadt verlassen?«, fragte er.
»Wir natürlich«, plusterte sich Jobst auf. »Oder siehst du hier noch andere?«
Seine Freunde quittierten diese Antwort mit Gelächter.
Jobst grinste ihnen zu. »Wird’s bald?«, blaffte er dann den Soldaten an, der angesichts der Menge, die ihm gegenüberstand, weiche Knie bekam.
»Wir dürfen das Tor nicht zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang öffnen. So hat’s der Rat beschlossen«, versuchte der Wächter, die Situation zu retten.
»Was schert uns der Rat?«, rief Jobst fröhlich. Solche Auseinandersetzungen waren nach seinem Geschmack. »Öffne endlich das Tor.« Er machte einen Schritt auf den Soldaten zu. »Wir können auch anders«, drohte er mit leiser Stimme.
Eingeschüchtert trat der Wachhabende zur Seite, rief seinen Kameraden zu Hilfe und die beiden Männer schoben den schweren Riegel beiseite, der das Tor sicherte. Dann drückten sie die Flügel auf und die Menge flutete aus der Stadt.
Es war nicht weit bis Sankt Mauritz. Wäre es nicht so dunkel gewesen, hätten die Menschen den mächtigen Westturm ausmachen können, der das Stift beschützte.
Jobst schritt zügig aus, bis sie vor der Kirche standen. Von hinten drängten die anderen nach. Rufe nach Rothmann wurden laut, den alle hier erwartet hatten. Aber ihr Prediger glänzte durch Abwesenheit. Die Enttäuschung der Menge war spürbar.
Wieder war es Jobst, der das Heft des Handelns in die Hand nahm. »Kaplan Rothmann hat uns aufgefordert, dem wahren Glauben in seiner Kirche zum Durchbruch zu verhelfen. Stimmt das?«, rief er.
»Ja«, brüllte es aus zahlreichen Kehlen.
»Sieht Gott auf das, was wir vorhaben, mit Wohlgefallen?«
»Das tut er«, antwortete die Menge.
»Dann sollten wir seinem Befehl folgen.« Jobst marschierte zu einem der Eingänge am Seitenschiff der Kirche. Er rüttelte an der Tür. Sie war natürlich verschlossen. »Weiß einer von euch, wo der Dechant wohnt?«
Er bekam keine Antwort.
»Auch gut. Dann müssen wir uns eben ohne Schlüssel Zutritt verschaffen.« Er zog zwei seiner Freunde zu sich heran. »Nehmt noch ein paar andere Leute und sucht Steine, die wir als Hammer benutzen können. Wir sind doch eben an einer Mauer vorbeigekommen. Dort werdet ihr sicher fündig.«
Es dauerte nicht lange, da störte der Knall heftiger Schläge die Nachtruhe. Und noch ehe der mittlerweile herbeigeeilte Dechant beruhigend auf die Menschen einwirken konnte, hatten Jobst und seine Kumpane die Tür zur Kirche aufgesprengt.
»Für Gott und Rothmann«, brüllte der Schmied, schnappte sich eine Fackel und stürmte ins Kircheninnere. Den Dechanten, der sich in den Weg stellen wollte, stieß er barsch beiseite.
Jobst lief zum Altar, um sich die Silberleuchter zu schnappen, die dort üblicherweise standen. Aber da waren keine Leuchter. Auch die silbernen Teller, auf denen die Hostien gereicht wurden, waren verschwunden. Keine edelsteinverzierten Kreuze, einfach nichts, was einen gewissen Wert besaß.
»Wo sind die Leuchter und das ganze Zeug?«, fuhr er den verschreckten Dechanten an, der ihm ins Kircheninnere gefolgt war.
Der schwieg.
Jobst griff den Geistlichen bei den Schultern, schüttelte ihn und hob drohend die Faust: »Antworte, sonst …«
»Jobst, lass.« Einer seiner Freunde war hinzugetreten und zog den jungen Schmied mit sich. »Er wird es dir ohnehin nicht sagen.«
Wütend riss sich Jobst los. Für einen Moment sah es so aus, als ob er sich erneut auf den Dechanten stürzen wollte. Dann besann er sich eines anderen. »Schlagt alles kurz und klein«, brüllte er. »Die Altäre, die Bilder, einfach alles. Es ist vom Teufel.«
Johlend folgte ihm die Menge, zog die alten Bilder von den Wänden, schlitzte die Leinwände auf, riss die Bänke aus ihren Verankerungen. Auch vor dem Altar machte der Mob nicht halt. Nur das hölzerne Kreuz mit dem leidenden Christus ließen sie an seinem Platz.
Mit Tränen in den Augen musste der Dechant zusehen, wie seine Kirche verwüstet wurde.