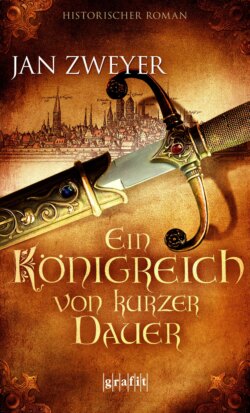Читать книгу Ein Königreich von kurzer Dauer - Jan Zweyer - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14 – Lübeck, 4. Mai 1531
ОглавлениеDas öffentliche Leben in der Stadt war weitgehend zum Erliegen gekommen. Einige der Bewohner hatten Lübeck fluchtartig verlassen, die meisten aber waren geblieben. Wo sollten sie auch hin? Die Krankheit machte vor Stadtmauern nicht halt. Und auch in den anderen Orten der Umgebung grassierte die Seuche, wie sich herumgesprochen hatte.
Nur wer unbedingt sein Haus verlassen musste, zeigte sich auf den Straßen und Plätzen der Hansestadt. Und die wenigen Menschen, die unterwegs waren, beeilten sich, so schnell wie möglich in die vermeintliche Sicherheit ihrer Häuser zurückzukehren.
Die Märkte waren geschlossen, die Läden der Bäcker und Fleischhauer verwaist. Wer sich nicht rechtzeitig mit Nahrung versorgt hatte, musste hungern – oder bei besonders mutigen Händlern einen Risikoaufschlag zahlen, der die Preise explodieren ließ.
Es dürften einige Hundert sein, die in den letzten zehn Tagen ihr Leben gelassen hatten. Die wenigen Mediziner, die versuchten, sich tapfer der Krankheit entgegenzustellen, konnten keine Systematik in ihrer Ausbreitung erkennen: Manche Menschen, die Kontakt mit einem Infizierten hatten, erkrankten und starben ein oder zwei Tage später, bei anderen dauerte es eine Woche oder länger bis zum Ausbruch der Seuche. Und wenige Glückliche blieben verschont oder überstanden sogar den tödlichen Schlaf, der die meisten Opfer dahinraffte. Da sich aber auch fast jeder Medikus ansteckte, machte sich schon bald keiner mehr Gedanken über solche Fragen.
Die Leichen wurden hastig in weiße Tücher gepackt und von den Totengräbern auf Karren gestapelt, zu großen Gruben außerhalb der Stadt gebracht und dort verscharrt. Die Geistlichen der Stadt glänzten bei diesen Beerdigungen in der Regel durch Abwesenheit. Die Toten wurden ohne christlichen Segen unter die Erde gebracht. Die Priester und Pastoren verletzten damit eigentlich ihre heiligen Pflichten. Sie verstießen gegen den Eid, den sie Gott geleistet hatten. Aber wer wollte es ihnen verdenken? Ihre Angst vor dem Englischen Schweiß war größer als die Furcht vor dem Zorn Gottes ob dieses Frevels.
Auch Linhardt hatte seine Vorräte aufgestockt. Frisches Wasser konnte er glücklicherweise aus dem Brunnen schöpfen, der hinter seinem Haus lag. Der Schacht war tiefer als die seiner meisten Nachbarn und befand sich in ausreichender Entfernung von der Latrine. Das Wasser war also relativ frisch und sauber.
Verdursten musste Linhardt nicht, jedoch würden seine Nahrungsmittel nicht ewig vorhalten. Wenn die Seuche noch länger wütete, würde er sich über kurz oder lang doch noch einmal auf die Straße trauen müssen.
Um das so lange wie möglich hinauszuzögern, rationierte er seine Vorräte. Zwar war er nun ständig hungrig und sein Magen knurrte ohne Unterlass, aber dafür vermied er den Kontakt mit anderen Menschen. So blieb ihm viel Zeit zum Nachdenken.
Linhardt machte sich Vorwürfe, Peter so überhastet nach Hattingen geschickt zu haben. Hätte er doch nur zwei Tage gewartet! Oder wäre selbst geritten.
Dann wieder zwang er sich zur Ruhe. Vielleicht hatte der Schreiber sich ja gar nicht angesteckt, erfreute sich bester Gesundheit und Linhardts Sorgen waren gegenstandslos. Nur was, wenn nicht?
Und wie stand es um ihn? Jedes Frösteln, welches ihn überkam, ließ Linhardt erzittern, jeder Schweißtropfen erschaudern. Ging er abends zu Bett, fragte er sich, ob er am nächsten Morgen wieder aufwachen würde. Und am Morgen befürchtete er, den Abend nicht mehr zu erleben. Die Angst raubte ihm in manchen Momenten fast den Atem.
Aber nicht heute. Heute würde er seine Befürchtungen in Wein ertränken.
Seine Welt war schon etwas verschwommen, als lautes Klopfen durch das Haus hallte. Linhardt erhob sich schwerfällig und wankte zur Eingangstür. »Wer ist da?«, rief er.
»Ich bin’s, Martin.«
»Kein besonders guter Zeitpunkt für einen Besuch, mein Freund.«
»Ich weiß. Aber ich muss mit jemandem reden.«
»Sprich mit deinen Eltern.«
»Mutter hat sich in einer Kammer eingeschlossen, Vater in seinem Kontor. Die Mägde und Gehilfen sind, soweit sie sich nicht irgendwo verkrochen haben, bei ihren Familien. Außerdem benötige ich den Beistand eines Freundes.«
Martins Stimme hörte sich so verzweifelt an, dass ein schrecklicher Verdacht durch Linhardts Alkoholnebel kroch. »Bist du etwa krank?«, fragte er heiser.
»Nicht, dass ich wüsste. Ich fühle mich gesund.«
»Was treibt dich dann zu mir?«
Für einen langen Moment schwieg Martin. Dann murmelte er etwas Unverständliches.
»Sprich lauter. Die Tür ist aus massiver Eiche. Ich kann dich kaum verstehen.«
»Es geht um Madlen«, antwortete Martin. »Sie ist an der Seuche erkrankt, verdammt noch mal«, brüllte er dann los. »Ich darf nicht zu ihr. Und jetzt mach endlich die Tür auf!«
Linhardt atmete tief durch. Dann nahm er seinen ganzen Mut zusammen, hob den schweren Balken, der den Eingang sicherte, aus seiner Halterung, ließ ihn fast auf seinen Fuß fallen, fluchte leise, schob endlich den Riegel beiseite und öffnete.
Schnell schlüpfte Martin durch den entstandenen Spalt. »Danke«, stammelte er. »Du bist ein wahrer Freund.«
»Ich bin ein Vollidiot«, stellte Linhardt mit schwerer Zunge fest. »Du verstehst, dass wir darauf verzichten sollten, uns zur Begrüßung zu umarmen?«
Martin verzog das Gesicht zu einem gequälten Grinsen. »Natürlich. Hast du Wein?« Er sah seinen Freund prüfend an. »Natürlich hast du. Was soll man in diesen Zeiten auch anderes tun, als sich zu besaufen?«
»Sicher. Es reicht für uns beide.«
Die Freunde gingen in die Stube, in der trotz der milden Witterung der Kamin brannte.
Martin deutete auf die knisternden Flammen. »Ist dir etwa kalt?«
»Nein. Ich habe versäumt, Zunder zu besorgen, und weiß nicht, wo die Magd ihn aufbewahrt. Ich habe schon alles auf den Kopf gestellt – leider erfolglos. Geht das Feuer aus, kann ich mir keinen Brei mehr kochen und muss mit kalter Kost vorliebnehmen.«
»Verstehe.«
»Willst du nun Wein?«
Martin nickte dankbar und Linhardt schlurfte zum Tisch, wo der nur noch halb volle Weinkrug wartete. Er goss ein und drückte Martin einen Becher in die Hand. Dann meinte er: »Ich setze mich an die gegenüberliegende Ecke des Tisches. Obwohl du wirklich gesund aussiehst, ziehe ich es vor, etwas Abstand zu halten.«
»Das ist mir ebenfalls recht, wie du dir denken kannst.« Martin hob den Becher.
Linhardt tat es ihm nach. »Warum bist du gekommen?«
»Ich habe auf der Sonntagsmesse von Madlens Erkrankung erfahren. Tagelang habe ich mit mir gerungen. Aber jetzt habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich musste mit jemandem reden.«
»Du gehst in diesen Tagen in die Kirche?«, wunderte sich Linhardt.
»Ja. Ich wollte Madlen treffen. Aber sie war nicht da.«
»Das wundert mich nicht. Ist sie nicht Protestantin?« Linhardt bemühte sich, einen klaren Gedanken zu fassen.
»Sie hat sich noch nicht für eine Religion entschieden.«
»Sie darf auswählen? Das erledigt nicht ihr Vater für sie?«, wunderte sich Linhardt.
Martin lachte auf. »Wenn du sie erst kennenlerntest, würdest du eine solche Frage nicht stellen.«
»Aha. Vielleicht hast du Madlen einfach verpasst?«
Martin lachte bitter auf. »Die Kirche war fast leer. Ich hätte sie niemals übersehen können. Deshalb bin ich zum Haus ihrer Eltern gegangen und habe geklopft. Im Gegensatz zu dir hat mir dort niemand geöffnet.«
»Wenig verwunderlich. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum ich so dämlich gewesen bin, dich hereinzulassen.« Linhardt trank einen Schluck. Der schwere Rotwein wärmte seinen Bauch und, was noch wichtiger war, seine Seele.
»Weil du mein Freund bist«, stellte Martin fest.
»Freunde über den Tod hinaus«, sinnierte Linhardt. »Das sind wirklich schöne Aussichten.« Er kippte den Wein in mehreren großen Schlucken, hob den Becher und sah Martin fragend an. Der schüttelte den Kopf. Linhardt zuckte mit den Schultern und goss sich nach.
»Zumindest hat mir eine Bedienstete erzählt, dass Madlen am Englischen Schweiß erkrankt ist. Das war vor vier Tagen.« Martins Augen wurden feucht. »Die meisten sterben innerhalb der ersten Stunden, heißt es. Stimmt das?«
Linhardt versuchte, sich an das zu erinnern, was er von Medikus Upberge erfahren hatte, und widerstand dem Bedürfnis, seinen verzweifelten Freund in den Arm zu nehmen. Dann berichtete er.
Martin wahrte nur mühsam die Fassung. »Dann ist sie bestimmt schon tot. Wir wollten heiraten.«
Linhardt glotzte erst seinen Freund, dann den Weinkrug an. Schließlich meinte er mit schwerer Stimme: »Das überrascht mich tatsächlich, wo du doch vor einem Monat noch nicht einmal mit ihr gesprochen hattest.«
»Das war damals.«
»Wirklich lange her, stimmt.«
»Wir haben uns mehrmals getroffen. Schließlich haben wir uns geküsst.«
Linhardt schenkte sich einen weiteren Becher ein. »Deshalb muss man ja nicht gleich heiraten«, meinte er. Als er den bestürzten Blick Martins sah, fragte er sich, was er da eigentlich gerade von sich gegeben hatte. Es fiel ihm nicht mehr ein.
»Natürlich nicht. Aber wir wollten.«
»Und was sagen eure Eltern dazu?«
»Noch wissen sie von nichts. Madlen befürchtet, dass sich ihr Vater einer Eheschließung widersetzen wird. Sie hat zwar ihren eigenen Kopf und weiß ihn auch durchzusetzen, aber gegen ihre Familie möchte sie sich nicht stellen. Ihre Eltern hängen dem neuen Glauben an, meine schwanken zwischen dem alten und dem neuen.«
Die Wolken in Linhardts Kopf ballten sich weiter zusammen. Er versuchte, sich zu konzentrieren. Als er glaubte, die Lösung gefunden zu haben, nuschelte er: »Dann sind es weniger eure Eltern als ihr selbst, die nicht zusammenkommen können?«
»Wenn du das so sehen willst. Jetzt ist ohnehin alles egal.« Martin machte eine Pause. »Vielleicht sollte ich mich freiwillig als Totengräber melden.«
Für einen kurzen Moment wurde Linhardt nüchtern. Sein Freund war impulsiv und schoss häufig über das Ziel hinaus. Und so tragisch die Erkrankung Madlens auch war, ging er wieder einmal zu weit. »Martin! Bist du jetzt völlig übergeschnappt?«
Obwohl gut bezahlt, fanden sich nur wenige Lübecker, die diese Arbeit erledigen wollten. Kein Wunder, starben doch auffällig viele von ihnen denselben Tod wie die Opfer, die sie begruben. Nur die ärmsten der Armen oder verurteilte Verbrecher, denen man im Gegenzug für diese Arbeit die Freiheit versprach, meldeten sich.
»Das ist der reine Selbstmord.«
»Ich weiß«, jammerte Martin. »Deshalb ja.«
Linhardt griff wieder zum Becher. Sein Verstand versank immer tiefer in einem gnädigen Rausch. »Nicht jeder stirbt an der Seuche«, stammelte er. »Einige überleben.«
»Hast du schon einen von ihnen getroffen?«, wollte Martin wissen.
»Getroffen? Ich?« Linhardt stierte in seinen Wein. »Nein. Wie denn? Ich verlasse das Haus ja nicht mehr.«
»Siehst du.« Martin zeigte auf den Tonkrug. »Ist da noch etwas drin?«
»Bedien dich. Ich gehe derweil in den Keller und hole Nachschub.«
Drei Stunden später verließ Martin das Haus in der Fischergrube. Linhardt gelang es nur mit Mühe, die Tür wieder ordnungsgemäß zu verriegeln. Auf der Treppe schlug er lang hin. Etwas Gutes hatte der Besuch seines Freundes bei allen Risiken, die sie eingegangen waren, allerdings gehabt: In dieser Nacht quälten Linhardt keine Dämonen des schlechten Gewissens und der Angst, im Gegenteil. Trotz des aufgeschürften Knies schlief er wie ein Stein.