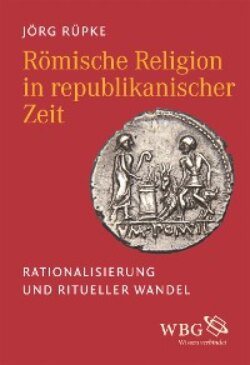Читать книгу Römische Religion in republikanischer Zeit - Jorg Rupke - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wie müssen wir uns frühe römische Religion vorstellen?
ОглавлениеDas Interesse an Roms Frühgeschichte ist wahrscheinlich so alt wie die Stadt selbst. Römische mythologische Erzählungen zeigten ein massives Interesse an der Stadt. Sie besaßen die Form ätiologischer Mythen, traten aber auch als Erzählungen über gestaltgebende Normen und Werte auf, die das Aussehen von „Geschichte“ hatten. Das sowohl zeitlich als auch geographisch universalisierende Muster griechischer und hellenistischer Mythologie und Geschichte war in Rom seit Anbeginn der für uns noch greifbaren Belege bekannt. Gleichwohl wurde es erst im dritten Jahrhundert v. Chr. als Rahmen für die Selbstverortung der Römer im Mittelmeerraum angewandt.14 Seit dieser Zeit nahmen Vorhaben dieser Art die Form griechischer Historiographie an, das heißt, dass sie sowohl die literarische Form aufnahmen wie auch auf Griechisch verfasst waren. Latein wurde die Sprache historischer Erzählungen erst des zweiten Jahrhunderts. Unsere, zugegebenermaßen bereits kaiserzeitliche, Sichtweise auf frühe römische Geschichte wird von Schreibern der späten Republik und augusteischen Zeit dominiert – Cicero, Livius, Vergil, der Grieche Dionysios von Halikarnass –, die sowohl an Prozessen der Kanonisierung teilnahmen als auch Kritik an deren Ergebnissen übten. Indem sie von den Taten der ersten Könige, Romulus und Numa, berichteten, bereiteten sie erzählerisch den Boden für Bürgerkrieg und Reichsbildung: Die Ermordung von Romulus’ Bruder Remus sah den späteren inneren Zwist voraus: Die frühe Verbindung von Expansion mit der Rekrutierung von Bundesgenossen legte den Grundstein für das spätere Imperium.
Frühe Versuche griechischer Autoren, das aufsteigende Rom in ihre mythologischen Geflechte zu integrieren, wurden nicht immer widerstandslos aufgenommen. Die Abstammung von Troja, so bereits zu Beginn des dritten Jahrhunderts vom griechischen Geschichtsschreiber Timaios von Tauromenion verfochten, eignete man sich in Rom nicht vor dem ersten Jahrhundert an. Dann jedoch wurde die Geschichte des flüchtigen trojanischen Prinzen Aeneas zum Mittelpunkt der römischen Selbstwahrnehmung.
Ungeachtet des großen griechischen Einflusses auf alle Bereiche, die etwas mit Schreiben zu tun hatten, versuchten römische Autoren diesen Einfluss zu verringern. Sie hoben, trotz der gemeinsamen Abstammung, Unterschiede hervor. Roms mächtige Rezeption griechischer Kultur und Religion, ob nun direkt aus der Magna Graecia, nämlich den griechischen Siedlungen in Süditalien und Sizilien, oder indirekt durch die Vermittlung von Etruskern und Kampaniern, wurde aus Gründen, die in den späteren Kapiteln deutlicher werden sollen, durch die literarische Tradition nicht hinreichend dargestellt.15 Die Archäologie zeigt uns, wie erwähnt, die Präsenz Griechenlands in den Tempeln des sechsten Jahrhunderts ebenso wie das Vorhandensein von dionysischen Bildmotiven im Rom des vierten und dritten Jahrhunderts v. Chr.16
Angesichts der enormen Prominenz von Religion und religiösem Wandel in ihrer eigenen Zeit ist das Interesse der bisher genannten Autoren an Religion nicht weiter verwunderlich. Wir können dieses Interesse sogar bis in die Zeit des Polybios zurückverfolgen. Als griechischer Politiker und Historiker versuchte er im dritten Viertel des zweiten Jahrhunderts v. Chr., die Ursachen des Aufstiegs Roms zum Weltreich zu ermitteln – eines Machtzuwachses, den zwar alle beobachtet hatten, dessen Plötzlichkeit aber trotzdem einer Erklärung bedurfte. Polybios identifizierte die römische Religiosität, die er selbst als Aberglaube abtat, als einen Hauptfaktor für den militärischen Erfolg Roms.
Weil viel Wissen über die frühe römische Religion auf diesen Texten basiert – derweil, wie Christopher Smith es beschreibt, „die Zeugnisse, die wir über römische Religion haben, oft bloß antike Interpretationen sind“17 – müssen wir beginnen, das Religionskonzept dieser Autoren näher zu beleuchten. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass sie kein kohärentes Konzept von Religion besaßen. Die Existenz von Göttern und ihr Charakter, also ihre Grundhaltung gegenüber den Menschen, waren eine Angelegenheit der Naturphilosophie, in heutiger Diktion also eher der Physik als der Metaphysik oder der Religionsphilosophie. Da die Existenz von Göttern als gegeben angesehen wurde, war diesen überlegenen Gestalten gegenüber eine Haltung, die wir als „Religiosität“ bezeichnen würden, die aber lateinisch nur als Analogie zur wichtigeren pietas gesehen wurde, natürlich und wurde zu dem, was als religio bezeichnet wurde: eine Art Verpflichtung, die auf der Voraussetzung beruht, dass Götter oder ein bestimmter unsterblicher Gott geehrt werden sollen.18 Diese Ehren hatten die Gestalt von Tempeln, Ritualen (sacra) und Spezialisten, die dafür zuständig waren (sacerdotes). Cultus mag ab und an als Sammelbegriff genutzt worden sein.
Dadurch gerieten Erscheinungen von Gottheiten (durchaus kritisch betrachtet) und Divination (die Erkundung des göttlichen Willens), die Stiftungen von Tempeln, öffentliche Rituale und die Einrichtungen und Veränderungen der öffentlichen Priesterschaften, in das Blickfeld von Autoren. Einmalige und daher meist aufwändige und ungewöhnliche Krisenrituale erregten dabei besonderes Interesse. Außergewöhnliche Riten in Zeiten von Krisen boten die Möglichkeit, Bemerkungen zur Beteiligung und auch zur individuellen Ritualaktivität zu machen – ein Aspekt, der sonst nicht sichtbar ist. Details von Kulten, theologischer Spekulation, Routineritualen und dem alltäglichen Betrieb der Heiligtümer fanden dagegen keinen Niederschlag in der schriftlichen Überlieferung. Die Ablage von Votivgaben und Bestattungspraktiken, die in der archäologischen Überlieferung sehr dominant sind, flossen nicht in das schriftlich weitergegebene Wissen ein. Wir lernen durch Letzteres mehr über die Finanzierung eines Kultes als über das Nachdenken über eine Gottheit, lernen mehr über institutionalisierte als über eingebettete oder diffuse Religion.
Mit Blick auf die verfügbaren Quellen scheint es angebracht, eine substantialistische, besser noch: eine relationale Definition von „Religion“ zum Einsatz zu bringen: Es geht um kulturelle Praktiken und Zeichensysteme, die sich auf „Götter“ beziehen, selbst eine Klasse religiöser Zeichen, die sowohl Namen als auch Bilder umfasst, aber auch um die individuelle Aneignung, strategische Nutzung, ja Erfindung solcher Traditionen. „Religion“, wie der Begriff im weiteren verwendet wird, bezieht sich damit auf eine Menge von Praktiken, Institutionen, Gewohnheiten und Vorstellungen, von denen keine innere Stimmigkeit erwartet werden kann und auch nicht gesucht werden soll. Diese Definition reicht auch deswegen aus, weil es nicht das Vorhaben dieses Werkes ist, religiöse Kommunikation im weiten Feld von Kommunikation und Institutionen dieser frühen Gesellschaft zu isolieren, um sie mit späteren Zeiträumen zu vergleichen.
Es darf nicht vergessen werden, dass sowohl emische (also kulturinterne) als auch etische (mit den Maßstäben des Außenbeobachters arbeitende) Perspektiven auf religiöse Kompetenzen von Einzelnen und Gruppen durch Geschlecht und soziale Ordnung der jeweiligen Beobachter(innen) geformt sind. Die weitreichenden Kompetenzen römischer Frauen der späten Republik,19 vor allem Matronen, wurden in den späten Quellen nicht auf die früheren Zeiten zurückprojiziert. Diese Autoren dachten vielmehr, dass sich religiöse Aktivitäten von Frauen auf die Rolle der Vestalinnen konzentrierten. Im Blick auf Geschlecht lässt sich keine solide Aussage, nicht einmal ein Vergleich zwischen archaischer und spätrepublikanischer Zeit treffen. Für die spät- und nachrepublikanische Historiographie war es der Kontrast zwischen Patriziern und Plebejern, der die Rekonstruktion der frühen Religion bestimmte.20 Für die frühe Periode reichte die Bandbreite der den Patriziern zugeschriebenen Kompetenzen vom Recht auf Weissagung in Form von Auspizien (die Beobachtung des Vogelfluges, von Blitzen und so weiter) bis zur Zugehörigkeit zu den Priesterkollegien, kurzum, zentrale Elemente der Kommunikation mit den Göttern. Es muss hervorgehoben werden, dass die Lex Ogulnia von 300 v. Chr., ein Gesetz, das auch Nichtpatriziern die Bekleidung religiöser Ämter gestattete, nicht die Zahl patrizischer Priester verkleinerte, sondern nur zusätzliche Ämter plebejischer Pontifices und Auguren schuf.21
Die moderne Forschung hat oft versucht, die römische Gesellschaft durch die Brille von face-to-face-Gesellschaften zu sehen, die in den Klassikern der Anthropologie des zwanzigsten Jahrhunderts sehr detailreich geschildert worden sind. In dieser Optik ist sie dadurch charakterisiert, dass solche Gesellschaften von Altersgruppen, die zusammen einem Initiationsritus unterzogen werden, gebildet werden und ihre ökonomischen und soziale Aktivitäten durch einen gemeinsamen und detaillierten Kalender einen Rhythmus erhalten.22 Ich möchte nicht das Konzept der Initiation insgesamt in Frage stellen, aber sein Nutzen ist im besten Falle der einer Analogie, und selbst das auch nur dann, wenn ein solches Konzept auf (selbsternannte oder aristokratisch definierte) Repräsentanten einer Altersgruppe in einer Stadt mit den genannten dreißigtausend Einwohnern angewendet wird.