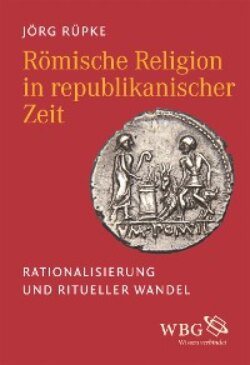Читать книгу Römische Religion in republikanischer Zeit - Jorg Rupke - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gliederung des Buches
ОглавлениеEine ernsthafte Geschichte der republikanischen Religion wurde bislang noch nicht geschrieben.9 Dieses Buch soll diese Lücke in der Forschung füllen, indem es sich sowohl mit römischer Geschichte als auch mit der Religionsgeschichte Roms beschäftigt, einen forschenden Blick auf die formative Phase erster römischer Experimente imperialer Eroberung wirft und bis in die späte mittlere und späte Republik vordringt. Deswegen werden, auch wenn der Hauptfokus dieses Buchs auf der Zeit von 240 bis 40 v. Chr. liegt, immer wieder Blicke auf frühere Zeiten geworfen. Um Wandel darzustellen, muss natürlich auch die Chronologie eine Rolle spielen. Daher ist dieses Buch so strukturiert, dass es sowohl den Charakter des Wandels als auch dessen Chronologie beleuchtet. Während das letzte Kapitel (Kapitel 14) die Prozesse, die Gegenstand der vorangegangenen Kapitel gewesen sein werden, zusammenfasst, versucht Kapitel 1 die römische Religion zu Beginn des Untersuchungszeitraums zu rekonstruieren – soweit dies überhaupt mit den dürftigen Belegen möglich ist.10
Der erste Teil des Buches (Kapitel 2 bis 5) widmet sich den öffentlichen Ritualen. Der Begriff „öffentlich“ verweist auf jeweils große Zielgruppen, die in den Quellen typischerweise als Römer identifiziert werden, auch wenn diese Gruppen wohl weder rechtlich noch statistisch repräsentativ für „die Römer“ waren. In diesem Band ist „öffentlich“ daher kein genau differenzierter analytischer Begriff, sondern eher ein heuristischer. Besonders als ein anachronistischer Begriff, der durch eine moderne Sichtweise gefärbt ist, nach der er auf die Teilnahme an Entscheidungsfindungsprozessen verweist, wirft er Fragen nach jenen Kommunikationsräumen auf, die in Anspruch nehmen, für die gesamte Gesellschaft zu stehen. In diesem Sinne repräsentiert die „Öffentlichkeit“ einen Kommunikationsbereich, der eine (offene) Kommunikation und umfassende Vergesellschaftung ermöglicht – publicité und communauté. Kommunikationssituationen, die eine Zielgruppe dieser Art haben, werden zuerst betrachtet (Kapitel 2). Die Rituale der republikanischen Religion werden im Anschluss daran auf Veränderungen in ihrer Sichtbarkeit und der Größe ihrer Zielgruppe genauso wie auf Situationen – politische und gerichtliche Versammlungen, um nur zwei zu nennen – hin untersucht, die Kommunikationsarenen schaffen können (Kapitel 3). In diesem rituellen Kontext von Kommunikation, in dem Argumente gebildet oder wirksam wurden, konnten die Anwesenden kritische Reflexion auf Institutionen üben und so weitere Institutionalisierungen aus diesen Reflexionen heraus anstoßen.
Dramenaufführungen boten, wie vielfach betont worden ist, einen herausragenden Raum für Kommunikation. Die Texte, die in diesem Kontext dargeboten wurden – in den Anfangskapiteln soll hierauf nur ein kurzer Blick geworfen werden – werden in Kapitel 4 detailliert untersucht.11 Trotzdem soll der performative Aspekt des Dramas die Aufmerksamkeit nicht soweit absorbieren, dass unterschätzt werden könnte, welche Rolle die schriftliche Verbreitung von Dramen einnahm, die ab dem späten zweiten Jahrhundert vor Christus kursierten.12 Einige in Fragmenten erhaltene Textstellen des Dichters Accius aus dem zweiten Jahrhundert erlauben uns einen wichtigen Einblick in die beginnende rationalisierende Interpretation von Religion in dieser Zeit.
Zum Schluss dieses ersten Teils soll der Fokus auf die Sprache des Rituals gelenkt werden. Die Entwicklung des Triumphzuges stellt ein Beispiel der Folgen von Rationalisierung in Form eines öffentlichen Rituals dar, das eine Kontrollfunktion ausübt, indem es Akteure in eine spezifische, nämlich eine rituelle Öffentlichkeit drängt (Kapitel 5).
Der zweite Teil dieses Buches (Kapitel 6 bis 9) beschäftigt sich direkt mit Texten und der Entwicklung von Regeln, zumal Rechtsnormen, im Medium dieser Texte und verlagert so den Fokus von der mittleren auf die späte Republik. Meine Ausgangsannahme ist das Vorhandensein von praktischen und theoretischen Rationalisierungen: praktische in der Form von instrumentellen Rationalisierungen, das heißt die Lösung technischer Probleme und die Rationalisierung von Werten betreffend; theoretische in der Form kausaler, also beispielsweise intellektueller, Rationalisierungen im Bereich der Erkenntnistheorie und der Weltbilder. Außerhalb des Bereiches der Religion können wir solche Rationalisierungstendenzen in der spätrepublikanischen Kultur als erstes anhand der Verbreitung „griechischer“ Bildung und von textbezogenen Praktiken ausmachen.13 Die griechische Kultur nimmt in dieser Zeit natürlich eine prestigeträchtige Position ein: Die römische Oberschicht wetteiferte darum, ihre Villen mit griechischer Kunst auszustatten, und die griechische Kultur dominierte die Bühnen. Allerdings richtet sich mein Blick hauptsächlich auf Formen der Rationalisierung innerhalb dieser bloß geliehenen griechischen Kultur sowie dem, was ich inselartige Rationalisierungen nenne, nämlich segmentäre Systematisierung.
Die Rhetorik ist ein Beispiel solcher inselartiger Rationalisierung. Bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts v. Chr. wurde sie zur lehrbaren Kunst des überzeugenden Argumentierens entwickelt. In Übereinstimmung mit den Gepflogenheiten des römischen historischen Erinnerns wurde ganz einfach eine Geschichte erzählt, wie die Rhetorik nach Rom kam: Im Jahre 155 v. Chr. zeigte Carneades die Rechtmäßigkeit einer Behauptung an einem Tag und die Rechtmäßigkeit der gegensätzlichen Aussage am folgenden Tag auf.14 Er wurde aus der Stadt vertrieben. Trotzdem zog die griechische Rhetorik in den nachfolgenden Jahrzehnten Römer magisch an. Gleichwohl blieb sie umstritten: Die Gründung lateinischer Rhetorikschulen blieb bis 92 v. Chr. verboten. Diese Art von Rationalisierung bleibt also auf zwei Weisen eine Insel: Sie war einer Mehrheit versagt und die erfolgreiche Anwendung war auf den intellektuellen Diskurs in Privathäusern, Bücher und Gerichtsverhandlungen beschränkt. Auch Divination wurde zum Gegenstand einer diskursiven Tradition, sowohl innerhalb als auch außerhalb der institutionellen Kontrolle. Wie die Rhetorik auch, trat sie vor dem Hintergrund intensiver griechischer philosophischer Diskussion auf. Opferpraktiken dagegen wurden – anders als in Griechenland und in der Kaiserzeit – in der Republik kaum einer ähnlichen Systematisierung oder Kritik unterworfen.15
Nach einer kurzen Einführung, die sich mit der Schriftverbreitung beschäftigt (Kapitel 6), befassen sich die Kapitel dieses Abschnitts mit den römischen fasti – also dem Kalender (Kapitel 7) – mit den religiösen Regeln und ihrer Rolle in der historiographischen Reflexion (Kapitel 8) sowie mit dem Versuch in der späten Republik, die Stellung von Religion mithilfe einer Art von Verfassung, nämlich der lex Ursonensis, festzuschreiben (Kapitel 9).
Trotz ihres insulären Charakters behaupte ich, dass die beschriebenen historischen Fälle nicht nur Versuche, sondern tatsächlich erfolgreiche Beispiele von Rationalisierung waren. Das ist die Kernthese dieses Buches. Auch wenn der Begriff der Rationalisierung zunächst an formale Kriterien gebunden werden muss, vor allem mit Systematisierung im Modus der Sprache, kann die Frage nach der Problemlösungskapazität einer solch formalen Rationalität in den Augen der Zeitgenossen nicht ignoriert werden. Auf dieser Basis wird dieses Buch den originellen und überzeugenden Ansatz von Claudia Moatti weiterverfolgen, die „die Geburt der Rationalität in Rom“ in Ciceros Generation, also dem ersten Jahrhundert v. Chr., verortet, und ihn um eine Entstehungsgeschichte und durch die Differenzierung ihres Konzepts von Rationalität erweitern.16 Dies eröffnet uns eine neue Perspektive auf eine römische Gesellschaft, die rationalitätsgeschichtlich sehr oft nur als Durchgangsstation angesehen und der nur selten Originalität zugestanden wurde.17
Tatsächlich ist genau diese Gelegenheit zur Untersuchung der Entwicklung und Verbreitung von Rationalität und der Kollision von rationalisierenden und mythologischen Weltanschauungen (um diese abgedroschenen Floskeln zu nutzen) das, was die Attraktivität meines Themas ausmacht.18 Daher soll sich der dritte Teil (Kapitel 10 bis 13) mit zwei theorielastigen Gattungen, und zwar antiquarischer Literatur und Philosophie, beschäftigen. Auf eine kurze Einführung zu den Problemen und den analytischen Instrumenten (Kapitel 10) wird die Analyse zweier Personen folgen, deren Schriften zwar nur in Fragmenten erhalten sind, die aber trotzdem wichtige Indikatoren des religiösen Wandels darstellen, nämlich Ennius und Varro (Kapitel 11 und 12). Eine Analyse von Ciceros klassischen philosophischen Abhandlungen über Religion vervollständigt diesen Abschnitt (Kapitel 13).
Da kultureller Wandel durch kulturellen Austausch im Verlauf des Buches immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird im letzten Kapitel (Kapitel 14) die Wechselbeziehung zwischen beiden Prozessen, also ihre Verflechtung untersucht. Die letzten beiden Jahrhunderte der Republik waren durch a) komplizierte Prozesse von Expansion und Rezeption, b) die Bildung neuer Eliten, c) die Entwicklungen insulärer Rationalisierungen noch vor dem Auftreten umfassender alternativer Weltanschauungen und d) durch drastischen institutionellen Wandel gekennzeichnet. All dies drängte eine versteinerte Tradition in eine Abwehrhaltung. Auch religiöse Praktiken blieben nicht unangefochten. Gerade Religion gewann an Bedeutung und an Vielfalt in der Anwendung sowie in der Systematisierung. Die zugrundeliegende Überzeugung dieses Buches ist, dass es möglich ist, Religion bis in die augusteische und die Kaiserzeit hinein als einen herausragenden Indikator für historischen Wandel anzusehen.
∗ ∗ ∗
Dieses Buch hat eine lange Vorgeschichte und geht von seinen Ausgangsfragen zurück bis auf ein Jahr als „Erfurt-Fellow“ am Max-Weber-Kolleg im Jahr 2002/3. Es war dann erneut unter den außergewöhnlichen Bedingungen des Max-Weber-Kollegs, diesmal im Rahmen der Kolleg-Forschergruppe „Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive“ und einer von der DFG hälftig finanzierten Freistellung, dass ich aus vielen Vorarbeiten ein Buch entwickeln konnte, das mit intensiver Unterstützung durch Clifford Ando und Ruth Abbey (University of Chicago) als „Religion in Republican Rome: Rationalization and Ritual Change“ in der Reihe „Empire and After“ (University of Pennsylvania Press) im Jahr 2012 erscheinen konnte. Das vorliegende Werk entspricht dieser Publikation; nur gelegentlich habe ich Fußnoten mit Blick auf deutschsprachige Forschungstraditionen gekürzt oder ergänzt. Karoline Koch, Erfurt, lieferte für viele Kapitel eine Rohübersetzung und kümmerte sich um die Fußnoten; ihr bin ich zu großem Dank verpflichtet. Andrea Graziano di Benedetto Cipolla hat in einem gründlichen Lektorat noch einmal Fehler reduziert und Formulierungen geglättet. Ihm gilt mein Dank ebenso wie Julia Rietsch, die die Entstehung des Buches im Verlag begleitet hat, nachdem Harald Baulig das Projekt angestoßen hatte.
Gewidmet sei das Buch meinen Geschwistern Ulrike, Regina und Ingolf als Dank für ihre bleibende ebenso irrationale wie unritualisierte Verbundenheit.