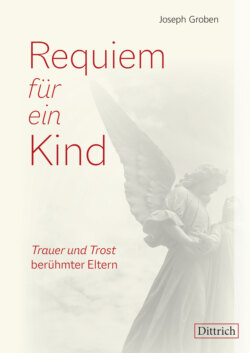Читать книгу Requiem für ein Kind - Joseph Groben - Страница 60
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Tod der Tochter
ОглавлениеAls Konzertmeister und Orchesterdirektor der fürsterzbischöflichen Kapelle hatte Michael Haydn mit seinem Jahresgehalt von 300 Gulden und freier Kost an der »Offiziers-Tafel bey Hof« ein gutes Auskommen. Am 17. August 1768 heiratete er die 23-jährige Hofsängerin Maria Magdalena Lipp, die Tochter des Hoforganisten, eine ausgezeichnete Musikerin. Als sie 16 Jahre alt war, hatte der Erzbischof sie zur Ausbildung ihrer prächtigen Stimme nach Venedig geschickt, wo sie drei Jahre lang die »Singkunst« studierte. Die erste Biographie, die 1808 in Salzburg erschien, kennzeichnet Haydns Gattin als ein »vortreffliches«, von ihm selbst »vorzüglich geschätztes Weib«. Die gemeinsame Liebe zur Musik war vermutlich ein engeres Band als die wenig ausgeprägten Eigenschaften der Hausfrau, die nicht wirtschaften konnte und immer wieder Schulden anhäufte.
Am 31. Januar 1770 brachte Maria Magdalena ihr einziges Kind zur Welt. Auf Befehl des Erzbischofs wurde es noch am selben Tag »solemniter« auf den Namen Aloisia Josefa getauft. Der »überglückliche« Vater hing mit »wahrhaft inniger Liebe« an seinem »Töchterchen«, für das er die schönsten Zukunftspläne schmiedete. Aber schon am 27. Januar 1771 wurde ihm das einjährige Kind durch den Tod entrissen und auf dem Sankt-Peters-Friedhof begraben. Das Wohnhaus der Familie Haydn lag unmittelbar neben dem Friedhofseingang, so dass die Eltern das Bild des frischen Grabes stets vor Augen hatten. Beide waren gleicherweise tief getroffen und betrauerten diesen Verlust viele Jahre lang. Wenn wir W. A. Mozart Glauben schenken dürfen, wurde Maria Magdalena kränklich und verfiel in eine überstreng frömmelnde Lebensart: »Mich wundert, dass sie durch ihr beständiges geiseln, Peitschen, Cilicia-tragen, übernatürlich fasten, nächtliches betten – ihre Stimme nicht schon längst verlohren hat.« (7. August 1778) Zu welch hohen Leistungen diese Stimme fähig war, erkennen wir aus den herrlichen Solopartien der Marienantiphon »Regina coeli« KV 127, die der junge Mozart einst für die »Haydin« komponiert hatte.
Wir besitzen keine schriftlichen Zeugnisse Haydns mehr über seinen Schmerz, da die meisten Briefe verschollen sind. Nur die Berichte der ersten Biographen belegen die Erschütterung des Komponisten. Als »untröstlicher« Vater, der Tag und Nacht sein Töchterlein und dessen Spiele vermisste, hielt es ihn nicht in den Mauern des verödeten Hauses am Friedhofseingang. Sobald es der Dienst erlaubte, verließ er die Wohnung und unternahm anstrengende Wanderungen durch die Umgebung, um in der freien Natur Ablenkung von seinem Schmerz zu suchen. »Haydn war wie vernichtet, er erholte sich niemals mehr ganz von diesem Kummer«, schreibt ein früher Biograph. Die Schwermut begann sich über sein sonst stets heiteres Gemüt auszubreiten. Aber musikalisch verlieh Michael Haydn seiner Trauer einen überwältigenden Ausdruck, er setzte seinem »Töchterchen« ein unvergängliches Denkmal, wenn auch gewissermaßen unter fremdem Namen.