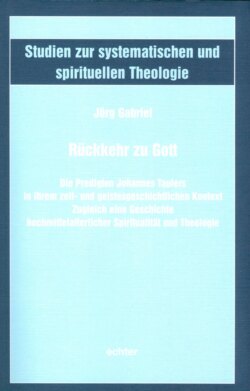Читать книгу Rückkehr zu Gott - Jörg Gabriel - Страница 39
V. Die Franziskaner
ОглавлениеEinen weiteren Wendepunkt stellt die Anerkennung der Gemeinschaft des hl. Franz von Assisi (1181/82-1226) dar:
„Bisher hatte es Innozenz III. immer mit Gruppen von Wander- predigern und religiösen Gemeinschaften zu tun gehabt, die seit langem bestanden und sich betätigten, durch die frühere Politik der Kurie aber aus der Kirche ausgeschlossen und zu Ketzern erklärt worden waren ... . Als Franziskus und seine Genossen an die Kurie herantraten, war es die Frage, ob die gleichen Zugeständnisse: Wanderpredigt, freiwillige Armut und Gemeindebildung, auch einer neu entstandenen Genossenschaft gemacht werden sollten, die noch nicht wie die Waldenser und Humiliaten durch die frühere Politik der Kurie gegen die religiöse Bewegung betroffen worden war, noch nicht durch Ungehorsam gegen päpstliche Verbote in die Gefahr gekommen war, als Ketzerei verfolgt zu werden, und bei der es sich also nicht um Rückgewinnung für die Kirche handelte.“354
In der Anerkennung der Gemeinschaft des Franziskus ging es um sehr viel, nämlich um eine offizielle Bestätigung der Armutsidee und der Wanderpredigt als solche durch die Kirche.
Die „Imitatio“ des armen, wandernden und predigenden Jesus Christus wurde, ausgelöst durch die Schriftlesung von Mt 10, 5-16, zum Lebensprogramm des Franz Bernardone. Ihm schlossen sich Gefährten an. Zu zweit zogen sie durch Stadt und Land und predigten die frohe Botschaft. Da Franziskus eine Lebensform gewählt hatte, die der der verfolgten „Ketzer“ ähnelte, blieben die Bischöfe misstrauisch. Franziskus wollte jedoch von der Kirche anerkannt werden. Deshalb pilgerte er 1206 nach Rom zum Papst.355 Der Papst jedoch entschied nicht sofort, sondern ließ die Gemeinschaft des Franziskus zunächst weiter gewähren. Erst 1210 erhielt Franziskus – mit Hilfe des in Rom weilenden Bischofs von Assisi und des Kardinals Johannes Colonna – von Innozenz die Anerkennung.356 Die Bestätigung wurde jedoch an zwei Bedingungen geknüpft: Franz und seine Gefährten mussten die Tonsur empfangen und zu Klerikern werden. Außerdem mussten Franz und seine Gefährten dem Papst den Gehorsam geloben.357 Weitere Verpflichtungen sowie Regeln über die Lebensgestaltung der Gemeinschaft legte ihnen der Papst nicht auf. Er gab ihnen auch keine schriftliche Erlaubnis zur Predigt bzw. irgendein formelles Privileg. Erst wenn die Genossenschaft größer geworden sei, solle sich Franz wieder an die Kurie wenden, um eine verbindlichere Regelung zu treffen.358
Der Papst gab Franziskus zwar nur eine mündliche Bestätigung, diese war aber faktisch die Anerkennung des evangelisch-apostolischen Lebensideals, wie es in den religiösen Bewegungen hervorgetreten war. Der Papst und die Kurie hatten endlich verstanden, dass ihnen „nicht nur die äußere Handhabe, sondern auch das religiöse Recht fehlte“359, diese Lebensform weiter zu unterdrücken. Erst 1223, Franziskus hatte sich bereits 1220 von der Leitung der Gemeinschaft zurückgezogen, erhielt die Gemeinschaft der Minderbrüder – so nannten sie sich nach ihrer Bestätigung – eine kirchlich-rechtliche Regel. Diese Regel wurde zum Grundgesetz des neuen Ordens.360 Zur gleichen Zeit, als Franziskus um Anerkennung seines Lebensideals bat, wurden auch die Weichen gestellt, die zur Gründung des anderen Bettelordens führte: des Predigerordens des hl. Dominikus (Dominikaner).
302 Zum Beispiel die Hospitaliter vom hl. Antonius (Antoniter), die Hospitaliter vom hl. Geist, die Johanniter; die Laienbruderschaft der Brückenbauer, die an Pilgerstrassen Brücken bauten, die Trinitarier widmeten sich der Befreiung der christlichen Gefangenen aus der Hand der Sarazenen sowie die zahlreichen Gildenbruderschaften. Siehe: Borst 2007, 495f.; Ders. 2004, 265 – 278; Hauschild I 1995, 329 – 332.
303 Vgl. Angenendt 2005. 59f.
304 Grundmann 1977, 79.
305 Vgl. Grundmann 1977, 65.
306 Grundmann 1977, 65.
307 Vgl. Grundmann 1977, 65f.
308 Vgl. Grundmann 1977, 72.
309 Vgl. Grundmann 1977, 91-100.
310 Ausführlicheres zur Versöhnung: Siehe Grundmann 1977, 72 – 91.
311 Grundmann 1977, 71.
312 Vgl. Grundmann 1977, 100.
313 Siehe hierzu dieses Kapitel, II.
314 Grundmann 1977, 81.
315 Vgl. Grundmann 1977, 82.
316 Grundmann 1977, 82.
317 Vgl. Grundmann 1977, 83.
318 Vgl. Grundmann 1977, 78.
319 Vgl. Grundmann 1977, 84.
320 Grundmann 1977, 89f.: Jakob von Vitry, Brief vom Jahre 1216, in Boehmer 1930, 65f.
321 Vgl. Grundmann 1977, 91.
322 Grundmann 1977, 91.
323 Grundmann 1977, 92.
324 Grundmann 1977, 9443. Vgl. Bernhard von Fontcaude (+ 1193), Liber contra Waldenses, PL 204, c. 4 – 5.8; Alanus von Lille (+ 1202), De fide contra hereticos, PL 210, c. 1.
325 Grundmann 1977, 9544. Vgl. Bernhard von Fontcaude (+ 1193), Liber contra Waldenses, PL 204, c. 2; Alanus von Lille (+1202), De fide contra hereticos, PL 210, c. 7-8.
326 Grundmann 1977, 9546. Vgl. Alanus von Lille (+1202), De fide contra hereticos, PL 210, c. 8.
327 Grundmann 1977, 9650. Vgl. Wilhelm von Puy-Laurens, Cronica (Prolog), ed. Beyssier 1904, 119.
328 Vgl. Grundmann 1977, 9954. AlberichL von Troisfontaines, MGScr. XXIII, 878, bezeichnet die Sektierer aus Metz als Waldenser.
329 Vgl. Grundmann 1977, 97: Der Brief des Bischofs ist nicht erhalten. Die Fragen ergeben sich jedoch aus dem Antwortbrief des Papstes an den Bischof und das Kapitel von Metz vom 12. Juli 1299 (PL 214, Sp. 698f.) und aus einem Hirtenbrief an Stadt und Bistum Metz (undatiert, PL 214, 695ff.).
330 Vgl. Grundmann 1977, 98.
331 Vgl. Grundmann 1977, 99.
332 Grundmann 1977, 10055. Vgl. PL 214, Sp. 698f.
333 Vgl. u.a. Hellmeier 2007; Angenendt 2005, 61; Jordan von Sachsten, Anfänge, 2002, 3; Wolter 1999, 219 – 223; Koudelka 1989; Grundmann 1977, 100 – 118.
334 Türkischsprachiges Steppenvolk (vom Kuma-Fluss [im Nordkaukasus]), das im 11. Jh. in Ungarn eindrang; um 1240 wurden die Kumanen z.T. von den Mongolen unterworfen bzw. siedelten sich fest in Ungarn zwischen Theiß und Donau an (Kumanien). Seit 1350 wurden sie christianisiert (vgl. Das aktuelle Wissen-Lexikon, Bd. 12, 2004).
335 Vgl. Koudelka 1989, 15.
336 Grundmann 10262. Vgl. Petrus von Vaux-Cernay, hist. Albigensis, ed. Luchaire 1908, c.3 S. 12.
337 Vgl. Grundmann 1977, 103.
338 Grundmann 1977, 10364. Vgl. Epistel 7, 76, PL 215, Sp. 358ff.
339 Grundmann 1977, 10466. Vgl. Epistel 9, 185, PL 215, Sp. 1024f.
340 Jordan, Anfänge, 2002, 41.
341 Jordan, Anfänge, 2002, 51f.
342 Ein Grund dafür war die nicht gelöste Frage der Frauenklöster: Siehe zweiter Teil, sechstes Kapitel, II.
343 Vgl. Grundmann 1977, 10158. Vgl. Petrus von Vaux-Cernay, hist. Albigensis, ed. Luchaire 1908, c.6 S. 20f.; Wilhelm von Puy-Laurens, Cronica, c.8, ed. Beyssier 1904, 127.
344 Grundmann 1977, 107.
345 Vgl. Grundmann 1977, 109.
346 Vgl. Grundmann 1977, 118: Im Jahre 1210 versöhnte sich die Kirche mit einer anderen Gruppe von Wanderpredigern unter der Führung des Bernard Prim und Wilhelm Arnaldi (Siehe ebd.118-127); im selben Jahr kam vermutlich auch Franz von Assisi mit elf Gleichgesinnten nach Rom, um die Erlaubnis zur apostolischen Predigt und zum Leben in Armut zu erhalten.
347 Vgl. Grundmann 1977, 110f.
348 Vgl. Grundmann 1977, 111.
349 Vgl. Grundmann 1977, 112.
350 Vgl. Grundmann 1977, 115.
351 Vgl. Grundmann 1977, 113.
352 Vgl. Grundmann 1977, 115f.: „In Aragonien werden die Prediger von den Zivilbehörden verfolgt. Fast überall sucht man ihnen die Almosen zu entziehen, von denen sie leben wollten. Immer von neuem wurden sie als Ketzer verdächtigt. Man versuchte ihnen gegen ihren Willen andere Vorsteher aufzudrängen.“
353 Vgl. Grundmann 1977, 116. 136. 140.
354 Grundmann 1977, 128; vgl. Hauschild 1995, 319 – 324.
355 Vgl. Wolter 1999, 224.
356 Franziskus erwies sich bei den Konsultationen als schwieriger Verhandlungspartner: So schlug ihm die Kurie z.B. vor, er und seine Gefährten sollten als Mönche und Eremiten leben und eine der bestehenden Ordensregeln übernehmen. Franziskus lehnte ab. Mit Hilfe von Kardinal Johann Colonna gab die Kurie den Wünschen des Franziskus nach. (Vgl. Grundmann 1977, 129 – 132).
357 Vgl. Grundmann 1977, 129.133.
358 Vgl. Grundmann 1977, 134.
359 Grundmann 1977, 133.
360 Vgl. Wolter 1999, 225.