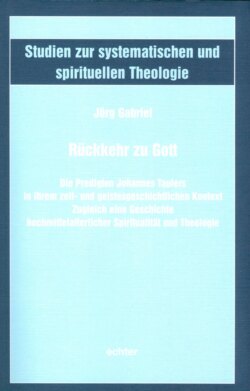Читать книгу Rückkehr zu Gott - Jörg Gabriel - Страница 41
I. Die Beginen
ОглавлениеIm 13. Jahrhundert waren die Frauenklöster der Zisterzienser wie die der Dominikaner und Franziskaner nicht in der Lage, alle Frauen aufzunehmen, die nach einem religiösen Leben strebten. Darüber hinaus war die Voraussetzung für die Anerkennung bzw. Inkorporation in einen bestehenden Orden die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauengemeinschaften. Aus diesem Grund nahmen die Frauenklöster – die ohnehin überfüllt waren – ausdrücklich einflussreiche und vermögende Frauen auf. Für sehr viele Frauen, die aus weniger begüterten Verhältnissen kamen, blieb dann der Weg in ein solches Kloster verschlossen.388 Darum bildeten sich neue Gemeinschaftsformen, in denen Frauen ein religiöses Leben führten, ohne zu einem klösterlichen Verband zu gehören. Diese frommen Frauen wurden seit den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts Beginen genannt.389 Trotz des Konzilsbeschlusses von 1215, es dürften keine neue Ordensformen gebildet werden, neue Gemeinschaften müssten sich vielmehr den bestehenden Ordensgemeinschaften anschließen390, gestattete Papst Honorius III. 1216 ausdrücklich diese neuen Lebensformen.
„Das Beginentum ist also nicht eine absichtlich und planvoll geschaffene Sonderform des religiösen Lebens, sondern das Ergebnis der religiösen Frauenbewegung, soweit sie nicht Aufnahme fand in den neuen Orden.“391
Obwohl die Beginen von einzelnen Förderern unterstützt wurden – wie z.B. Jakob von Vitry, Robert von Grosseteste, Robert von Sorbonne; Jakob Pantaleon hat sogar eine Regel für eine Beginengemeinschaft verfasst – existierte weder eine einheitliche Organisation mit einer gemeinsamen Regel, noch erhielten sie die Anerkennung als selbstständige Ordensform. So bildete das Beginenwesen eine
„seltsame Zwitterform zwischen den kirchlichen Ordnungen dieser Zeit, nicht eigentlich zu dem Mönchsstand der Religiosi gehörend, da es kein approbierter Orden war, aber auch nicht zum Laienstand der Saeculares, da die Beginen das saeculum verließen, Keuschheit gelobten und in Gemeinschaften eine vita religiosa führten.“392
Doch gerade diese Zwitterform zwischen den kirchlichen Ordnungen ist dem Beginentum zum Verhängnis geworden.393 Seit Beginn des 13. Jahrhunderts vermehren sich die kritischen Stimmen zum Beginentum, wobei die Stimmen, die von Gegnern der Beginen kommen, sehr kritisch gelesen werden müssen.394 Glaubwürdiger ist dagegen die Kritik Mechthilds von Magdeburg (1208/10 – 1282/94) am Lebensstil von Beginen. Mechthild lebte selbst als Begine und trat gegen Ende ihres Lebens in das Kloster zu Helfta ein. Ihre Kritik richtet sich gegen die Eigenwilligkeit im geistlichen Leben. Deshalb unterscheidet sie in ihrem Buch „Das Fließende Licht der Gottheit“395 zwischen einer „wahren geistlichen Schwester und ... einer weltlichen Begine“396:
„Die geistliche Schwester spricht aus dem Licht des Heiligen Geistes ohne Herzeleid, aber die weltliche Begine spricht aus ihrem Fleisch mit Luzifers Geist mit gräulichem Aufwand.“397
So berichtet Mechthild über eine verstorbene Begine, die sich aus Liebe zu Gott zu Tode kasteit hat. Als Mechthild für sie betete, sah sie „ihren Geist wie eine klare Sonne“398, aber gleichzeitig war er von einer „großen Finsternis umfangen“399:
„Sobald sie in einer Erhebung war, lagerte sich immer finstere Nacht davor. Das war der Eigenwille ohne Rat, der diesen vollkommenen Menschen so sehr (von Gott) zurückhielt ... . Da antwortete sie: ‚Ich wollte auf Erden keines Menschen Rat nach christlicher Ordnung folgen‘.“400
Mechthild ist von großer Sorge erfüllt über das geistige Leben ihrer Beginen-Schwestern:
„O ihr überaus törichten Beginen, was seid ihr so vermessen, dass ihr vor unserem allmächtigen Richter nicht zittert, wenn ihr Gottes Leib so oft in blinder Gewohnheit empfangt! Obwohl ich die Geringste unter euch bin, muss ich mich nicht schämen, erröten und beben.“401
Mechthild legte großen Wert darauf, sich als Begine einer geistlichen Führung zu unterstellen.402 Die Einbindung in die christliche Ordnung der Kirche war für sie ganz selbstverständlich und sollte geistige Verirrungen verhindern. Geistige Verirrungen blieben, wie auch bei anderen religiösen Gruppen, nicht aus. Vor allem aber wurden Beginen, wenn sie nicht in Beginenhöfen lebten und stattdessen beispielsweise bettelnd umherzogen, häufig der Ketzerei beschuldigt, z.B. der der Freigeisterei. Dies wurde auch dem geregelten Beginenwesen zum Verhängnis.403
Drei Gutachten aus dem Jahre 1273 über das religiöse Leben in Europa – erstellt für das Konzil von Lyon (1274) – befassen sich ebenfalls mit dem Beginenwesen und kommen zu einem übereinstimmenden Urteil. Der Dominikaner Humbert von Romans beschreibt die Situation der Kirche in Südfrankreich:
„Nach einer Klage über die maßlose Zunahme von Bettelmönchen, religiosi pauperi, die aller Welt zur Last fallen, vielfach nicht als Mönche, sondern als Landstreicher bezeichnet werden und das Ansehen des Mönchsstandes gefährden, wendet er sich gegen die mulieres religiosae pauperes, die in Dörfern und Städten herumziehen, um ihren Lebensunterhalt zu suchen. Um diese bedenkliche und anstößige Erscheinung zu beseitigen, soll die Kirche nach seinem Rat nur solche religiöse Frauen- gemeinschaften anerkennen, die bei strenger Klausur, ohne auf Almosen angewiesen zu sein, ihre Bedürfnisse aus eigenen Mitteln bestreiten können.“404
Auch Bischof Bruno von Olmütz, der über die religiösen Zustände im ostdeutschen Sprachgebiet ein Gutachten erstellt hat, erwähnt religiöse Erscheinungen, deren Zugehörigkeit zum Beginentum unverkennbar sei405:
„Er klagt über Leute, Männer sowohl als vor allem junge Frauen und Witwen, die sich, ohne einem päpstlich approbierten Orden anzugehören, als Religiosi aufführen, kleiden und bezeichnen. Sie schließen sich keinem gültigen Orden an, um niemanden gehorchen zu müssen und um, wie sie meinen, in solcher Freiheit Gott besser dienen zu können. Sie glauben sich aber andererseits auch dem Gehorsam gegen den Pfarrklerus enthoben, bei dem sie weder beichten noch von ihm die Sakramente empfangen wollen, als seien sie in seiner Hand unrein. Sie laufen überdies müßig und geschwätzig in den Städten herum und gefährden dadurch oft genug ihren Ruf und ihre Tugend.“406
Der Franziskaner Gilbert von Tournai schließlich befasst sich mit der Situation in Nordfrankreich und Belgien.407 Er weist in seinem Gutachten ausdrücklich auf die Gefahren unter den Frauen hin, „die man Beginen nennt“408. Er warnt vor häretischer Gefährdung des Beginentums: Sie beschäftigen sich mit theologischen Fragen und verwenden dazu in ihren Konventikeln religiöse Schriften in der Volkssprache und französische Bibelerklärungen, die Gilbert selbst gelesen und untersucht haben will. Diese seien „so voller Irrtümer und Ketzereien, zweifelhafter und falscher Schriftdeutung, dass bei den Beginen, die solche Schriften lesen, unvermeidlich irrige und ketzerische Meinungen überhand nehmen müssen.“409 Um den Gefahren zu begegnen, fordert Gilbert, solle man die gefährlichen Bücher vernichten. Gegen die theologischen Grübeleien der Beginen selbst vorzugehen, fordert er indes nicht. Darüber hinaus berichtet er über ein weit verbreitetes Gerücht, eine dieser Beginen habe die Wundmale Christi empfangen. Wenn das Gerücht zuträfe, solle dies öffentlich bekannt gemacht werden; anderenfalls müsse gegen die Heuchelei eingeschritten werden.410
Übereinstimmend fordern die drei Gutachter vom Konzil „kirchliche Maßregeln gegen das Beginentum“411 vorzunehmen. Das Konzil von Lyon (1274) aber ging auf die wirklichen Probleme des Beginentums nicht ein. Stattdessen erneuerte es den Beschluss des Konzils von 1215, nämlich das Verbot neuer Ordensformen. Man wollte damit das gesamte Beginenwesen treffen, erreichte so aber gar nichts. Denn viele Beginenhäuser konnten sich auf Schutzbriefe von Päpsten, Legaten und Bischöfen berufen, so dass der Konzilsbeschluss wirkungslos blieb:
„Ließ sich aber der Beschluss nicht grundsätzlich durchführen, so bot er auch keine Handhabe zur Bekämpfung der Schäden im Beginenwesen. Es wäre nötig gewesen, die Fragen der Aufsicht über die Beginen, die Zuständigkeit des Klerus oder der Orden für ihre Seelsorge und vor allem die Frage, wie man Beginen zur Klausur verpflichten, ihnen das Herumziehen und das Betteln verbieten konnte, durch allgemeine Verordnungen zu regeln.“412
Was dem Konzil nicht gelang, nämlich das Beginenwesen in seiner Ganzheit zu erfassen und eine einheitliche Ordnung zu schaffen, wurde dafür in einzelnen Regionen und Bistümern umgesetzt: Um 1284 befasste sich eine Diözesansynode in Eichstätt mit dem Beginenwesen. Die Synode sprach aus, was auf dem Konzil von Lyon nicht beachtet wurde: Das Beginentum habe sich durch das Fehlen einer einheitlichen Organisation zu so vielen Ausgestaltungen entwickelt. Darum sei es gar nicht möglich, eine allgemeine Regel für alle Beginen zu verfassen. Vielmehr komme es jetzt darauf an,
„die ehrbaren und unbescholtenen Beginen gegen die Verdächtigungen und Verleumdungen, denen sie ausgesetzt sind, zu schützen, indem gegen die verdorbenen und lasterhaften Beginen mit schärfsten Mitteln vorgegangen wird.“413
Aus den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts sind einige Beginenregeln erhalten, die einen Blick in das geregelte Beginenleben gestatten. Aus Straßburg sind die Statuten von drei Beginen-„Sammlungen“ von 1276 erhalten.414 Alle drei Beginenhäuser wurden von Dominikanern betreut. Mit Hilfe ihres Beichtvaters Friedrich von Ersteheim einigten sich die Beginen auf eine gemeinsame Regel:
„Alle Schwestern haben sich durch Handschlag auf diese Statuten verpflichtet, jede neu Eintretende hat dasselbe zu tun. Hält sich eine Frau länger als ein Jahr in der Gemeinschaft auf, so gilt sie dadurch als confessa et obligata. In erster Linie geloben alle Mitglieder, den Anordnungen der Magistra, der Subpriorin und des jeweiligen Beichtigers hinsichtlich der Ordnung und Aufsicht innerhalb des Hauses gehorsam zu sein. Wer sich diesen Anordnungen nicht fügt und die Statuten nicht befolgt oder die einträchtige Ordnung unter den Schwestern stört, ebenso wer sich eines unsittlichen Lebenswandels schuldig macht, wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen; die Entscheidung darüber hat die Magistra, die Subpriorin und die Mehrheit der Schwestern zu fällen.“415
Die meisten Bestimmungen der Regel gelten den Vermögensverhältnissen: Von einem Armutsgelübde oder vom Verzicht auf Privateigentum ist nicht die Rede, ebenso wenig von einem Gehorsamsgelübde gegenüber der Oberin. Dennoch sind die Regeln streng: Die Schwestern verlieren beim Eintritt in die Gemeinschaft die Verfügungsgewalt über ihr Vermögen. Wird eine Schwester ausgeschlossen, bleibt alles, was sie mitgebracht hat, Eigentum des Hauses. Auch Verwandte haben keinerlei Erbansprüche. Will eine Schwester, nachdem sie länger als ein Jahr in der Gemeinschaft gelebt hat oder falls sie als Kind in die Gemeinschaft eingetreten ist und nachdem sie das 14. Lebensjahr erreicht hat, die Gemeinschaft verlassen, darf sie nur ihre Kleidung und ihr Bettzeug mitnehmen. Tritt sie jedoch in einen Orden ein, erhält sie zusätzlich einen Geldbetrag von fünf Pfund.416 Wir sehen:
„Der Austritt aus der Gemeinschaft war also grundsätzlich nicht unmöglich, denn er war nicht durch bindende und ewige Gelübde verwehrt, aber er zog den Vermögensverlust nach sich.“417
Hier wird nochmals deutlich: Die Beginengemeinschaften verstanden sich nicht als Versorgungsstätten für unbemittelte und unverheiratete Frauen, aus denen der Austritt möglich war, wenn sich eine bessere Möglichkeit der Versorgung ergab. Die Rückkehr in ein weltliches Leben wird nicht in Betracht gezogen, höchstens der Eintritt in einen Orden.418 Andererseits wird vorausgesetzt, dass Frauen, die einer Beginengemeinschaft beitreten, Vermögen an beweglichem und unbeweglichem Gut mitbringen. Frauen, die nicht erbfähig sind, werden sogar ausdrücklich von der Aufnahme in die Gemeinschaft ausgeschlossen.419 D.h. der Eintritt stand eher nur vermögenden Frauen offen. Ähnliche Merkmale wie in den Statuten der drei Straßburger Beginenhäuser finden sich auch in Satzungen anderer Beginengemeinschaften dieser Zeit.420
„Die Statuten der Beginenhäuser des 13. Jahrhunderts legen also, soweit wir sie kennen, alle übereinstimmend den größten Wert auf die wirtschaftliche Sicherstellung der Gemeinschaften teils durch das Vermögen der Schwestern, teils durch den Ertrag ihrer Arbeit.“421
Die Konsequenzen dieses Grundsatzes waren: Betteln und Almosensammeln als Grundlage der Gemeinschaft wurden ausgeschlossen. Allerdings wurde armen und nichtvermögenden Frauen der Eintritt in die Gemeinschaft verwehrt; in Not geratene und bedürftige Frauen fanden kein Asyl. Diese Frauen zogen dann oft als wandernde Beginen weiter umher und waren dadurch anfällig für freigeistiges Gedankengut. Auch das Ideal der Armut wurde in den Beginenhäusern durch den Gedanken von einer gesicherten Versorgung ersetzt.422
„Das Beginentum hat also, auch ohne als ein religiöser Orden anerkannt zu sein und obgleich diese halbmönchische Lebensform in den Ordnungen der Kirche keine eindeutige Stelle fand, zum großen Teil seinen Bestand dadurch behauptet, dass sich die einzelnen Gemeinschaften an feste Statuten banden, sich wenigstens an eine lockere Form der Klausur gewöhnten, die im wesentlichen nur zum Zweck des Kirchgangs durchbrochen wurde, nicht aber das Almosensammeln gestattete, und dass sie sich der Aufsicht der Bettelorden unterstellten. Aber diese Entwicklung zum geregelten Beginentum hat sich nicht einheitlich und nicht vollständig vollzogen, und die Kreise religiöser Frauen, die nicht auf diese Weise in geordnete Verhältnisse einbezogen wurden, sind zu einer Gefahr für das ganze Beginentum geworden.“423