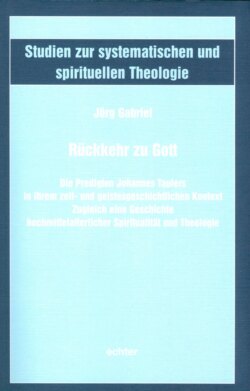Читать книгу Rückkehr zu Gott - Jörg Gabriel - Страница 42
II. Die Frauenklöster und die Frage der „Cura monialum“ im Dominikanerorden
ОглавлениеDie neuen Orden, die Bettelorden (Franziskaner und Dominikaner) und Zisterzienser, zogen neben den Beginengemeinschaften weiterhin zahlreiche Frauen an, die von der religiösen Bewegung erfasst worden waren. Da viele Beginengemeinschaften von den Bettelorden betreut wurden, ist es auch nicht verwunderlich, dass viele von diesen aufgrund ihrer ohnehin inzwischen eher klösterlichen Ordnung den direkten Anschluss an die Orden suchten und am Ende als weiblicher Zweig inkorporiert wurden:
„Bei einer großen Zahl deutscher Frauenklöster, die später dem Dominikanerorden eingegliedert wurden, ist über die Ursprungsgeschichte nur soviel festzustellen, dass das Kloster aus einem freien Zusammenschluss religiöser Frauen entstand, die zunächst ohne bestimmte Klosterregel und ohne Ordenszugehörigkeit aus eigenem Ansporn und aus eigner Kraft ihre religiösen Ideale der Armut und Keuschheit in solchen Gemeinschaften verwirklichen wollten. Man hat in solchen Fällen meist gesagt, an der Stelle des späteren Klosters habe vorher eine Gemeinschaft von Frauen bestanden, die nach ‚Art der Beginen‘ lebten; das Kloster sei aus einer ‚Beginensammlung‘ hervorgegangen.“424
Schon vor der Gründung des Predigerordens haben Bischof Diego und Dominikus in Südfrankreich eine Lebensform für religiöse Frauengemeinschaften geschaffen, um sie von den Irrlehrern fernzuhalten: 1206 gründeten sie das Frauenkloster von Prouille, in welchem die Frauen vermutlich nach der Augustinus-Regel lebten. Ob die Frauen auch Gelübde ablegten, ist nicht bekannt. 1214 übertrug Dominikus die Leitung des Klosters seinem Mitarbeiter Natalis. Papst Innozenz III. (1198 – 1216) stellte das Kloster unter päpstlichen Schutz. Nach der Gründung des Predigerordens ging das Kloster in den Besitz des Ordens über. In das Kloster zog auch ein Brüderkonvent. In den folgenden Jahren (bis 1221) gründete Dominikus noch weitere drei Frauenklöster: zwei in Spanien, in Madrid und Segovia (1218)425; in Rom wird Dominikus von Papst Honorius III. (1216 – 1227) beauftragt, das Benediktinerinnenkloster S. Maria in Trastevere zu reformieren. Hierzu soll im Auftrag des Papstes ein ganz neues Kloster (S. Sisto) errichtet werden, in das die Benediktinerinnen überführt und nach den Richtlinien des Klosters von Prouille reformiert werden sollen. Eine vierte Gründung in Bologna kam 1227 unter Dominikus Nachfolger Jordan von Sachsen (+1237) zustande.426 Sie verlief allerdings nicht ohne Widerstand, denn die Brüder sträubten sich gegen ein weiteres Frauenkloster.427 Papst Honorius III. forderte schließlich eindringlich und „in schroffem Ton“428, das S. Agnes Kloster in Bologna in den Orden zu inkorporieren.
Das Generalkapitel zu Paris (1228) lehnte sodann die Neuaufnahme von Frauenklöstern unter strengem Gehorsam und bei Strafe der Exkommunikation ab.429 Was führte zu solch einem Beschluss? Er richtete sich nicht gegen die schon bestehenden Frauenklöster, sondern er zielte vor allem auf die Verhältnisse in Deutschland: Der weibliche Zudrang zum Orden hatte in den nördlichen Provinzen des Ordens so stark zugenommen, dass – wie Jordan von Sachsen in einem Brief schreibt – die Predigerbrüder „fremde, eintrittswillige Frauen ... zu leichtfertig zum Haareabschneiden, zum Einkleiden und zu den Enthaltsamkeitsgelübden zuzulassen pflegten.“430 Schon Dominikus warnte auf dem Sterbebett, „verdächtigen Umgang mit Frauen, vor allem aber mit jungen Mädchen zu meiden.“431
Als die Predigerbrüder in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nach Deutschland kamen, fanden sie bereits zahlreiche Frauen- gemeinschaften vor, z.B. Klausnerinnen, denen sich der Orden sodann annahm. Aber es schlossen sich ihnen infolge der Predigttätigkeit weitere Frauen an, viele stammten aus adligen Familien, die als Gemeinschaften Nähe zum Dominikanerorden suchten.432 Nach geltendem Recht unterstanden die religiösen Frauengemeinschaften, solange sie nicht als selbstständige Klöster anerkannt waren, dem zuständigen Diözesanbischof und der ordentlichen Pfarrgeistlichkeit. Die Bischöfe sträubten sich gegen die Loslösung der Frauengemeinschaften aus dem Pfarrverband. Gegen diese Widerstände setzten sich die Frauen mit Hilfe der päpstlichen Kurie zur Wehr.433
Weitaus heftiger aber war der Widerstand von Seiten des Ordens. Er richtete sich gegen die Aufnahme von Frauenklöstern in den Ordensverband.434 Denn die Beschlüsse des Generalkapitels von 1228 blieben in Deutschland wirkungslos. Die Dominikaner verstießen dort ganz offen gegen den Beschluss, keine neuen Frauenklöster zu gründen und in den Orden zu inkorporieren. Aus diesem Grund erfolgte der Kapitelsbeschluss (vor 1236), sich aus der Frauenseelsorge, der cura mulierum, völlig zurückzuziehen und die Beziehungen zu den bereits bestehenden Frauenklöstern aufzukündigen.435 Daraufhin legten die Dominikaner die Leitung des Frauenklosters in Prouille nieder. Die Frauen Prouilles und auch die des Klosters in Madrid beschwerten sich daraufhin bei der Kurie in Rom. Papst Gregor IX. (1227 – 1241) wies den General des Dominikanerordens in einer päpstlichen Bulle zurecht und forderte, unverzüglich die Seelsorge in diesen Klöstern wieder zu übernehmen.436
In Deutschland wurde auch dieser Beschluss des Generalkapitels nicht beachtet. Das lag jedoch u.a. daran, dass dieser auch innerhalb der Ordensleitung keine einmütige Zustimmung fand. Der General des Ordens, Jordan von Sachsen, nahm an den Kapiteln, auf denen jener Beschluss gefasst worden sein muss, krankheitshalber nicht teil. Das Generalkapitel von 1236 – wieder unter seiner Leitung – lehnte ihn ab. Somit wurde dieser Beschluss wieder hinfällig.437 Aber damit war der Widerstand keinesfalls gebrochen. Die Gegner argumentierten, „dass alle solche Verpflichtungen die Ordensbrüder an der Erfüllung ihrer wesentlichen Aufgaben, der Predigt und der Kontemplation behindere.“438 Aus diesem Grund ließ sich der Orden 1239 von Gregor IX durch eine Bulle zusichern,
„dass er zur Übernahme von Seelsorgeverpflichtungen in Nonnenklöstern und bei anderen religiösen Frauen, ebenso zur Aufsicht und Visitation in Klöstern und Kirchen, zur Durchführung von Rechtshändeln und zur Verkündigung von Bannbullen künftig nicht mehr durch päpstliche Bullen verpflichtet werden dürfe, es werde denn die vorliegende Zusicherung ausdrücklich durch eine ‚Abrogationsklausel‘ außer Kraft gesetzt.“439
Trotz dieser Zusicherung zog sich der Orden nicht aus der Verantwortung gegenüber den Frauengemeinschaften und Frauenklöstern zurück. Zu Lebzeiten Gregors blieben die Verhältnisse in der Schwebe.
Das änderte sich nach seinem Tod 1241. Zur selben Zeit wurde ein neuer Ordensgeneral gewählt, der Deutsche Johannes von Wildeshausen. Johannes nutzte die Vakanz nach dem frühen Tod Papst Cölestins IV. (+1241), um klare Verhältnisse zu schaffen. Das Generalkapitel von 1242
„verhängte Strafen über alle Brüder, welche Nonnen oder anderen religiösen Frauen die Sterbesakramente gereicht, sich in ihre Leitung eingemischt oder Visitationspflichten bei ihnen übernommen hatten, und verbot allen weiteren Verkehr mit ihnen.“440
Der Ordensgeneral ließ darüber hinaus die Brüderkonvente aus den Frauenklöstern S. Sisto, Prouille und Madrid abziehen. Der neue Papst Innozenz IV. (1243 – 1254) war jedoch nicht gewillt, diesen Kapitelbeschluss hinzunehmen. Er begann Gegenmaßnahmen einzuleiten: Anstoß für diese gab das französische Kloster Montargis, in der Nähe von Orleans, das Anschluss an den Orden suchte.441 Da der Orden die Inkorporation verweigerte, wandte sich die Gründerin des Klosters, Amicie von Joigny, an die Kurie, die sich gerade in Lyon aufhielt. Mit einer Bulle vom 8. April 1245 verfügte der Papst die Inkorporation.442 Die Bulle – die auch die Franziskaner betraf – beinhaltete:
„Die Frauen werden sub magisterio et doctrina des Ordensgenerals und des betreffenden Provinzials gestellt; sie haben Anteil an allen den Orden verliehenen Privilegien. Der General und der Provinzial haben die sollicitudo et cura animarum in den Frauenklöstern zu übernehmen, persönlich oder durch geeignete Vertreter die Visitationspflicht zu erfüllen; die freie Wahl der Priorin oder Äbtissin steht aber dem Kloster allein zu. Sie haben bei den Nonnen Beichte zu hören und die Sakramente zu reichen. Weil aber die Ordensbrüder nicht verpflichtet sind, dauernd in den Frauenklöstern zu residieren, so sollen Ordens- instanzen geeignete Kapläne anstellen, die in dringenden Fällen die Beichte hören und die Sakramente spenden können. Die Klöster dürfen Besitz und Einkommen haben, auch wenn es die Gewohnheit oder die Statuten des betreffenden Ordens bisher anders bestimmt hatten.“443
Die Bulle enthielt für die Dominikaner zwei Zusätze: Bestimmungen der Ordens-Konstitutionen oder anderer päpstlicher Bullen, die der Verpflichtung zur Seelsorge in Frauenklöstern entgegenstehen, werden außer Kraft gesetzt; sodann werden die Ordensinstanzen beauftragt, in den Frauenklöstern, die dafür in Betracht kommen, die Ordenskonstitutionen einzuführen.444 Die päpstliche Bulle von 1245 hatte weitreichende Folgen:
„Dadurch war gleichsam der Damm gebrochen, der die Frauenklöster bis dahin außerhalb des Ordens gehalten hatte. Der Vorgang des Klosters Montargis war für die deutschen Frauengemeinschaften beispielgebend, und in rascher Folge erwirkte sich eine nach der andern durch die Kurie in Lyon die Aufnahme in den Orden.“445
Im Laufe von fünf Jahren (bis 1250) musste der Orden in Deutschland mindestens 32 Frauenklöster übernehmen.446 Auf die Dominikaner in Deutschland kamen Aufgaben zu, die nur sehr schwer zu bewältigen waren:
„Bedenkt man ..., dass während des ganzen Generalats Johann von Wildeshausen – 1241 bis 1252 – nur 4 neue Männerklöster in Deutschland entstanden sind und nur 24 in sämtlichen Ordens- provinzen, so lässt sich ermessen, welche außerordentliche Bürde dem Orden durch diese massenhafte Inkorporation übertragen wurde.“447
Der Orden musste sich auf diese Situation rasch einstellen.448 Die Ordensleitung war nicht gewillt, die Bestimmungen so einfach hinzunehmen. Die Dominikaner lehnten eine vollständige Inkorporation der Frauenklöster ab, weil sie sich „in der Erfüllung der Hauptaufgabe ihres Ordens, in der Predigt“449 behindert sahen.
Da die Frauenklöster, die von Dominikanern betreut wurden, zwar nach gleichartigen Konstitutionen lebten (St. Sisto oder St. Markus), aber keinen Ordensverband mit einer gemeinsamen Regulierung gebildet hatten, darüber hinaus die Bullen für die ersten beiden Klöster, die den Dominikanern unterstellt wurden, Montargis und St. Agnes, unterschiedliche Merkmale beinhalteten und sich dadurch von anderen Bullen abhoben, bat der Orden Anfang 1246 um Klärung, welche Verpflichtungen eigentlich bestünden.450 Denn Montargis und St. Agnes waren dem Orden inkorporiert, d.h. sie waren Teil des Ordens, und unterstanden deshalb in der Verwaltung von Besitz und Eigentum dem General bzw. Provinzial. Die anderen Klöster aber sollten dem Dominikanerorden nur „kommittiert“ werden, d.h. die Klöster sollten nur „in spiritualibus, durch Visitation und Seelsorge“451 betreut werden, nicht aber „in temporalibus, in der Verwaltung von Besitz und Einkommen.“452
Die Antwort des Papstes auf die Anfrage zeigt die schwankende Haltung der Kurie gegenüber den Frauenklöstern. In der Bulle vom 4. April 1246 legte der Papst fest,
„es sollten dem Orden durch die päpstliche ‚Kommission‘ von Frauenklöstern in Zukunft keine anderen Verpflichtungen erwachsen als eben jene Pflichten der Visitation, Seelsorge und Organisation, die in den päpstlichen ‚Kommissions‘-Bullen aufgezählt sind ..., nicht aber die Pflicht zur Verwaltung des Besitzes der Frauenklöster durch Ordensbrüder, die darüber hinaus in den ‚Inkorporations‘-Bullen für Montargis und S. Agnes festgesetzt wird.“453
Das bedeutet, der Orden musste sich zwar um die Seelsorge in den Klöstern kümmern, er konnte sich jedoch weigern, ein Kloster in den Ordensverband aufzunehmen. Durch die Bulle glaubte die Ordensleitung sich bestärkt, die Inkorporation der beiden Klöster Montargis und St. Agnes rückgängig machen zu können und in eine Kommission zu führen. Dem Einspruch dieser Klöster wurde vom Papst stattgegeben. Auch die beiden anderen Klöster, die schon früher zum Orden gehörten, ließen sich die Inkorporation durch eine Bulle bestätigen.454 Die andere Aufforderung des Papstes, in den Frauenklöstern die Ordenskonstitutionen einzuführen und eine gemeinsame geistliche Lebensgrundlage zu schaffen, befolgte der Orden unter dem Generalat Johannes von Wildeshausen (1241 – 1252) nicht. Außerdem waren die Konstitutionen von St. Sisto oder St. Markus nicht so einfach übertragbar, da in ihnen festgesetzt war, dass mindestens 6 Brüder dort einen Konvent bilden sollten. Diese Bestimmung war aber von der Bulle von 1246 abgeschafft.
Der Orden unternahm schließlich auf dem Generalkapitel von Bologna (Mai 1252) nochmals den Versuch, sich von allen Verpflichtungen gegenüber den Frauenklöstern zu befreien.455 Es war das letzte Generalkapitel unter dem Ordensgeneral Johannes von Wildeshausen. Zunächst versprach Innozenz IV. in der Bulle vom 15. Juli 1252, dem Orden in den nächsten zwanzig Jahren keine weiteren Frauenklöster zu unterstellen. Damit gab sich der Orden nicht zufrieden: Die durch frühere päpstliche Maßnahmen geschaffenen Zustände sollten rückgängig gemacht werden. In der Bulle vom 26. September gab der Papst nach:
„Er habe sich davon überzeugen lassen, dass der Orden in der Durchführung seiner wesentlichsten Aufgabe: der Predigt, vor allem gegen die Ketzer, behindert und beeinträchtigt werde durch die Verpflichtungen, die ihm Innozenz selbst in Berücksichtigung der dringenden Wünsche der Frauenklöster auferlegt habe. Da die große Aufgabe des Ordens den Vorrang habe und die Bedürfnisse der Frauenklöster auch auf anderem Wege erfüllt werden könnten, so entbindet der Papst den Orden von allen Verpflichtungen gegen die ihm inkorporierten oder kommittierten Frauenklöster mit Ausnahmen von S. Sisto in Rom und Prouille.“456
Damit verloren die Frauenklöster alles, wofür sie gekämpft hatten. Zwar wurden ihnen nicht alle Rechte genommen, die ihnen durch die Inkorporation teilhaftig geworden waren, doch auf die Seelsorge durch die Dominikaner hatten sie fortan keinen Anspruch mehr. Diese Sachlage war für die Frauenklöster inakzeptabel. Sie bestürmten den Papst und die Kurie leidenschaftlich.457 Mit dem Tod des Generaloberen Johannes von Wildeshausen verloren die Gegner der Cura-Pflicht dann jedoch eine bedeutende Stütze. Bis zum nächsten Generalkapitel (1254) gab es nun keine offizielle Ordensleitung. Dagegen kehrte Kardinal Hugo von St. Cher, selbst Dominikaner, als Legat aus Deutschland zurück. Hugo, der zwei Jahre in Deutschland verbrachte, kannte die Situation dort sehr genau. Und er war der religiösen Frauenbewegung zugetan. Zugleich war er aber auch ein Förderer dominikanischer Interessen in Deutschland. Er war für die Kurie deshalb der richtige Mann, um das Verhältnis zwischen Orden und Frauenklöstern neu zu ordnen. Kardinal Hugo erreichte zunächst eine Art „Stillhalteabkommen“, d.h. die Seelsorge sollte in allen Frauenklöstern zunächst in der bisherigen Weise weiter erfolgen. Auf dem zukünftigen Generalkapitel in Budapest (1254) sollten dann weitere Vereinbarungen verhandelt werden.458 Die Verhandlungen zogen sich bis zum Generalkapitel von 1256 (Paris) hin. Aber immerhin führten die bisherigen Verhandlungen zu dem Ergebnis, dass der Orden die Seelsorge in den Frauenklöstern weiterhin zu übernehmen bereit war, die vor 1254, ehe also Kardinal Hugo mit der Neuordnung beauftragt wurde, durch einen Generalmagister oder ein Generalkapitel in den Orden aufgenommen worden waren. Was der Kardinal jedoch nicht ahnte: Die Zahl solcher Frauenklöster war sehr viel geringer als angenommen, vor allem in Deutschland. Der Beschluss von 1256 bildete also keine rechtskräftige Grundlage für die Wiederaufnahme deutscher Frauenklöster in den Orden.459 Auf dem Generalkapitel von 1257 (Florenz) forderte der Kardinal daher, eine endgültige und feste Entscheidung zugunsten der Frauenklöster, auch derer, die nicht durch den Generalmagister oder durch ein Generalkapitel in den Orden aufgenommen waren. Drei aufeinanderfolgende Generalkapitel haben diesem Beschluss zugestimmt:
„Seit 1259 war es also endgültig entschieden, dass alle früher dem Orden unterstellten Frauenklöster wieder Anspruch auf seine Seelsorge hatten.“460
Darüber hinaus wurde beschlossen, „dass künftig Frauenklöster nur nach Zustimmung von 3 Generalkapiteln dem Orden unterstellt werden können.“461 Damit hatten die Frauenklöster ihren Anspruch auf dominikanische Leitung und Seelsorge durchgesetzt. 1267 wurde dieser Beschluss von Papst Clemens IV. (1265 – 1268) sanktioniert, indem er die Bulle von 1252, in welcher dem Orden die Cura-Pflichten erlassen worden waren, außer Kraft setzte.462
Jetzt musste sich der Orden noch zwei wichtigen Aufgaben widmen: Er musste – erstens – eine einheitliche Konstitution für alle Frauenklöster schaffen, wie bereits die Bullen von 1245 gefordert hatten; es musste – zweitens – bestimmt werden, welche der Frauenklöster überhaupt rechtmäßig Anspruch auf die Zugehörigkeit zum Orden hatten.463 Eine andere wichtige Sorge war die wirtschaftliche Sicherung der Klöster: Die Frauenklöster sollten wirtschaftlich auf eigenen Füssen stehen können. Ausreichende Mittel für den Unterhalt mussten vorhanden sein. Ein Kloster aber, das nicht über eine sichere wirtschaftliche Grundlage verfügte, durfte nicht in den Ordensverband aufgenommen werden. Außerdem durfte die einem Kloster zugewiesene Höchstzahl der Schwestern nicht überschritten werden.464
Der Anschluss an den Dominikanerorden brachte für die deutschen Frauenklöster zwar die wirtschaftliche Sicherheit, doch die ursprüngliche Armutsbewegung
„ging unter der organisatorischen Sicherung des Ordens in Gemeinschaftsform über, die den Einzelnen ein sicheres Auskommen gewährleistete und das religiöse Leben ordnete und disziplinierte. Ein großer Teil der Frauenbewegung in Deutschland hat dadurch ein neues und endgültiges Gepräge erhalten.“465