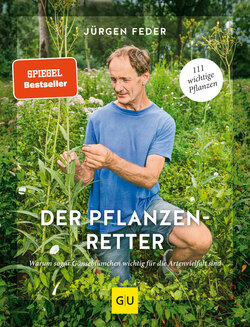Читать книгу Der Pflanzenretter - Jürgen Feder - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Wilde Karde ist von Kopf bis Fuß mit spitzen Stacheln übersät. Sie ist aber keine echte Distel.
WILDE KARDE
Dipsacus fullonum
Familie der Kardengewächse
(Dipsacaceae)
Fast wie ein Hochstapler kommt mir immer diese bis 2,5 Meter hohe Wilde Karde (Dipsacus fullonum) vor – ähnlich seinen Verwandten, der Behaarten Karde und der Geschlitztblättrigen Karde. Allen gemein ist, dass sie zweijährig sind und somit nach der Blüte absterben. Ein unerwartetes Ende, was man bei diesen starr-steifen, fast monumentalen Gebilden kaum für möglich hält. Diese Wilde Karde ist so wild, dass sie sich noch ein ganzes Jahr später völlig vertrocknet und ergraut neben neuen Blühpflanzen hält. Eine Pflanze also, die nicht loslassen kann.
Mich lässt diese distelartige Figur schon lange nicht mehr los, denn die Wilde Karde soll eine wehrhafte Pflanze gegen die schwer zu behandelnde Borreliose-Infektion sein. Die Wissenschaft ist sich da noch nicht so ganz sicher, aber erfahrene Heilkundler gehen von der Praxis aus – und haben da schon Erfolge verzeichnet.
Borreliose – durch Zecken übertragen – habe ich schon seit 1991, wenn sie auch erst 1997 nach einem für mich auffallend schlappen Jahr festgestellt wurde.
Aber überhaupt ist die Wilde Karde voller nützlicher Eigenschaften: Sie wirkt antibakteriell und entgiftend, weshalb ihre Wurzel traditionell gegen Hautkrankheiten, Lungenschwindsucht und selbst gegen die Syphilis eingesetzt wurde.
Zudem ist sie eine Art mit ausgefeilter Technik. In am Stängel verwachsenen Blättern wird per Zisterne Regenwasser gesammelt (»Waschbecken der Venus«, einst als Augenwasser genutzt). Die Gelehrten sind sich aber auch in diesem Fall noch nicht einig, warum man sich um ein solches Rüstzeug bei der Entwicklung der Pflanze bemüht hatte: Sollte das lokal die Luftfeuchte erhöhen? Ameisen den Aufstieg vermasseln? Oder wollte man in dieser Tränke gar diese Krabbler und anderes Getier ersäufen, zwecks zusätzlicher Proteinaufnahme? Vielleicht stimmen ja alle drei Erklärungen. Prächtig sind die vor allem unterseits stark bedornten Grundblätter und die Stechreihe auf der Unterseite der Stängelblattnerven. Die Facettenaugen der ausgeprägten Eierköpfe, der Blüten- und Fruchtstände, faszinieren mich nicht minder. Von weißlich bis rötlich blühen sie, beginnend immer in der Mitte und dann zu beiden Seiten nach oben und nach unten.
Apropos Techniker: Die Wilde Karde ist ein Wintersteher und verteilt seine Samen über mehrere Monate, man muss nur das pflanzliche Ungetüm leicht anstupsen. Meterweites Ausstreuen entsteht durch (An-)Spannung in der Pflanze, aber auch durch Mensch, Tier und Wind. Und mit der so drahtigen Karde kardierte man früher – das war das zuverlässige Aufrauen und Aufwickeln der Rohwolle auf Spindeln. Daher stammt der Begriff »Weber-Karde«, obwohl diese Pflnze noch eine ganz eigene Art ist.
Die Wurzeln der Wilden Karde werden in der Heilkunde für viele Erkrankungen eingesetzt.