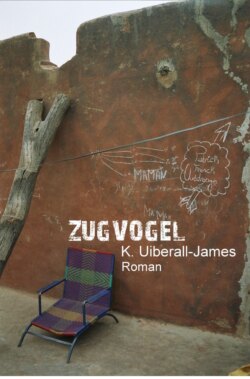Читать книгу ZUGVOGEL - K. Uiberall-James - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAus erster Hand
„Ihr müsst euch unbedingt eine deutsche Freundin zulegen.“
„Ja Mann, er hat Recht.“ Alle nicken beifällig.
„Aber dafür sind wir nicht hierhergekommen“, versucht Ibrahim einzuwenden, und Sekou fügt hinzu: „Wir wollen arbeiten und dann wieder zurück nach Hause.“
„Genau“, sagt Amadou, der zwischen Küche und Wohnzimmer alles mitbekommt, beipflichtend, „eine Freundin würde uns nur von unseren Zielen ablenken.“
„Was für Ziele denn?“ Aller Augen ruhen nun auf Amadou, der unschlüssig darüber, ob er über seine Wunschvorstellungen reden soll, zu der Gruppe am Tisch tritt.
„Na ja, ich möchte, ich dachte mir … ach, natürlich muss ich erst mal Arbeit finden.“ Mutlos senkt er den Kopf. Auf einmal findet er sein Ziel unerreichbar, Lichtjahre entfernt. Sekou springt seinem Freund bei.
„Amadou ist ein herausragender Tänzer und Musiker. Er möchte hier versuchen, damit Geld zu machen. Vielleicht könnt ihr ihm ja dafür auch ein paar Tipps geben?“ Anscheinend nicht; denn betretenes Schweigen ist die Antwort.
„Ähm, wie auch immer …“, meldet sich räuspernd ein schüchterner Landsmann zu Wort, „etwas Besseres als eine deutsche Freundin kann euch gar nicht passieren.“ Seine Freunde grinsen und klopfen ihm beifällig auf die Schulter.
„Apollinaire muss es ja wissen; er hat von uns allen das größte Los gezogen.“
„Wieso das denn?“ „Erzähl doch mal.“ Erwartungsvoll hängen die Augen der Neuankömmlinge an Apollinaires Lippen.
„Okay, wenn ihr unbedingt wollt, aber erst nach dem Essen.“
Etwas später tragen die ‚Köche’ dampfende, wohlriechende Schüsseln mit Reis und Gemüse, Fleisch und Soße auf. Einige Besucher erheben sich, um noch schnell die Hände zu waschen, andere strecken ihre Hände helfend beim Platzieren der Speisen aus.
Die Mahlzeit verläuft ruhig; jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach. Die Anwesenden, an den Platzmangel in Unterkünften für Afrikaner gewöhnt, bewegen sich langsam und rücksichtsvoll. „Ich wünschte, wir hätten eine größere Wohnung“, sagt Malik betrübt zu Ibrahim gewandt, „aber für Afrikaner gibt es so gut wie keine anständige, bezahlbare Wohnung.“ Er macht eine Beifall heischende Pause, aber niemand hat Lust, auf das Thema einzusteigen, also fährt er fort: „Die Deutschen schieben uns ab in Hochhäuser weit außerhalb der Stadt, sieh uns an. Wir wohnen in einem ethnischen Schmelztiegel, der sich schon allein wegen der unterschiedlichen Kulturen zu einem sozialen Krisengebiet entwickelt. In unserem Viertel leben Menschen aus allen Ländern der Erde; die meisten sind arbeitslos und von Heimweh geplagt; da kann eine Ungerechtigkeit der Behörden schnell der Funke sein, der die Lunte zum Brennen bringt.“
Apollinaire schaut Malik nachdenklich an. „Warum wertest du dieses Viertel so ab? Okay, wir befinden uns im Getto; aber das ist doch nichts typisch Deutsches.“
„Der Meinung bin ich auch. Die Großstädte in Afrika haben auch Gettos“, bestätigt Sekou Apollinaires Aussage, und Toucou sagt grinsend: „mit dem Unterschied, dass die dortige Regierung den Armen im Getto nicht die Miete zahlt und das Geld zum Überleben.“
Apollinaire klopft seinem Freund mitfühlend auf die Schulter. „Wisst ihr, Malik hat mit seiner Frau in einer sehr schönen Wohnung gelebt.“
Amadou hält es vor Hunger kaum noch aus. Sehnsüchtig schweift sein Blick über die gefüllten Schüsseln auf dem Tisch; da er fast eine Woche kaum etwas gegessen hat, ist der Nachholbedarf an Kalorien groß. Malik hat den Blick aufgefangen und sagt etwas unwirsch: „Na dann, guten Appetit.“
Das heimatliche Essen und die wohltuende Gesellschaft der Landsleute hat noch nie seine positive Wirkung verfehlt. Aber Amadou kann nicht abschalten; seine Gedanken kreisen immer noch um die Frage, warum eine deutsche Freundin so wichtig sein soll.
Nach dem Essen helfen alle mit, die Spuren der Mahlzeit zu beseitigen. Die Zeitungspapierunterlage wird mitsamt den abgenagten Hühnerknochen und anderen Speiseresten vorsichtig zusammengefaltet und im Mülleimer der Küche entsorgt; auf den Boden gefallene Reiskörner werden mit einem Stückchen Karton sorgfältig zusammengekratzt und aufgenommen. In der Küche sind Malik und zwei Freunde schon mit dem Vorspülen des Geschirrs beschäftigt. Sekou bietet seine Hilfe an, doch die wird lachend zurückgewiesen.
Als alle wieder zusammensitzen, zündet Malik sich eine Zigarette an und nimmt die Fernbedienung des Fernsehers in die Hand.
„Warte“, sagt Amadou und hält ihn am Arm fest, „Apollinaire hat uns doch eine Erklärung versprochen.“ Er kann seine Neugier nicht mehr zügeln. „Los, nun sag schon“, fordert er Apollinaire, sich ihm zuwendend, auf.
„Was denn? Ach so, das meinst du; also, da gibt’s nicht viel zu sagen; eine deutsche Freundin ist einfach hilfreich für alle eure Pläne; nicht mehr und nicht weniger.“
„Geht’s nicht etwas genauer?“
Die anderen mischen sich ein. „Das stimmt nicht ganz. Nicht alle deutschen Frauen sind gut für euch.“
„Ja, manche verstehen nichts von unseren Problemen.“ Leidgeprüft nicken einige der Anwesenden und blicken stumpf vor sich hin.
„Also, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher“, mault Amadou und blickt Hilfe suchend in Ibrahims und Sekous Richtung.
Ibrahim versteht die Aufforderung und nimmt bedächtig den Gesprächsfaden wieder auf: „Da komm’ ich jetzt aber auch nicht mehr mit. Erst soll es so wichtig sein, eine deutsche Freundin zu haben, und da sind sich alle einig, und im nächsten Moment sagt einer, dass aber manche deutsche Fr...“
„Ja, das ist schon erklärungsbedürftig“, unterbricht ihn Sekou. Sein Sitznachbar Toucou rafft sich zu einer Erklärung auf.
„Die meisten von uns haben die Erfahrung gemacht, dass es in Deutschland zwei Sorten von Frauen gibt, die mit Afrikanern zu tun haben wollen. Zum einen sind es die jungen Hübschen, die nur mal mit einem Schwarzen schlafen wollen, um herauszufinden, ob er im Bett wirklich besser als ein Europäer ist und …“ Er wird von allgemeinem Gelächter unterbrochen. „Hört mir doch erst mal zu. Also, … und ob es stimmt, was man in Deutschland über die Afrikaner sagt, nämlich dass sie einen größeren Penis haben; denn wenn es so wäre, hätten sie mehr Spaß am Sex; zum anderen …“
Ungläubig starren Amadou und seine Freunde Toucou an und können es sich nicht verkneifen, ihm auch ins Wort zu fallen.
„Du meinst, sie schlafen mit einem, nur mal so, ohne einander versprochen zu sein?“
„Na klar, sie tun es ständig und denken dabei nur an sich. Sie verlangen Sachen von dir …“ Diesmal unterbricht er sich selbst und macht eine bedeutungsschwangere Pause mit schräg nach oben verdrehten Augäpfeln und zusammengepressten Lippen.
„Komm schon, rede weiter.“ Etwas verlegen ringt er sich zu einer, wie es scheint, ausweichenden Bemerkung durch:
„Na ja, sie kennen keine Tabus beim Sex“.
„Keine Tabus? Was für Tabus denn? Was meinst du damit?“ Toucou fühlt sich in die Enge getrieben. Das geht ihm jetzt doch zu weit. Sollen doch die anderen den Neuen alles erklären. Er steht auf und fragt in die Runde: „Wer will Tee?“, und als alle nicken, verschwindet er in der Küche.
Die Atmosphäre im kleinen Wohnzimmer ist fiebrig, nicht nur wegen der schweißdurchtränkten verbrauchten Luft. Fast jeder der Anwesenden hat etwas zu dem Thema beizusteuern, und die Meinungen darüber gehen durchaus auseinander. Es herrscht ein heilloses Durcheinander, weil alle auf einmal reden. Die drei Freunde heften verwirrt ihre Blicke mal auf die, dann wieder auf jene Person. Endlich erbarmt sich einer, den sie ‚Professor’ nennen, und sagt laut in belehrendem Ton:
„Die jungen deutschen Frauen wollen emanzipiert sein.“
„Ja und?“, fragt Sekou, „ich meine, auch bei uns zu Hause gibt es eine Form von Gleichberechtigung.“
„Aber hier übertreiben sie maßlos.“ Er hebt emphatisch die Hände, um sie dann resigniert wieder fallen zu lassen. „Wie soll eine Beziehung funktionieren, wenn sie nicht auf ihren Freund oder Ehemann hören, wenn sie nur das machen, was sie wollen? Die jungen deutschen Frauen haben vor nichts und niemandem Respekt, nicht einmal vor ihren Eltern!“
„Was?“
„Und die älteren, sind die anders?“, will Ibrahim wissen.
„Ich bin noch nicht fertig mit den Jungen“, bremst der ‚Professor’ Ibrahim lehrerhaft aus und fährt fort: „ Also wenn ihnen ein Mann gefällt, in der Disco zum Beispiel, sprechen sie ihn ungeniert an und gehen vielleicht mit ihm noch in derselben Nacht ins Bett. Manche von ihnen haben jedes Wochenende einen neuen Freund“, zustimmendes Gemurmel aus der Zuhörerschaft, „sie benehmen sich schamlos in der Öffentlichkeit.“
„Wie denn?“ „Sie verlangen von uns, dass wir sie am helllichten Tag auf offener Straße oder auf der Tanzfläche vor allen Leuten küssen.“
„Und ihr macht das alles mit?“, staunt Sekou.
„Na ja, einige von uns haben es versucht, nur um der Freundin einen Gefallen zu tun, und auch, um sie nicht zu verlieren, aber die Frauen sind einfach nie zufrieden. Sie sind zu anspruchsvoll; ständig wollen sie etwas mit uns unternehmen, und das nicht nur am Wochenende wie bei uns zu Hause. Sie sind richtig vergnügungssüchtig. In der Woche wollen sie ins Kino gehen, Vorträge besuchen, Freunde einladen oder besuchen; sie nennen das ihr social life und unser Sozialleben interessiert sie einen feuchten Kehricht.“
„Und dann wollen sie auch noch stundenlang spazieren gehen“, wirft jemand entrüstet ein.
„Und wenn wir das alles mitmachen“, fährt der ‚Professor‘ unbeirrt fort, „ohne im Gegenzug den uns gebührenden Respekt zu erhalten, die eigene Kultur verleugnend, müssen wir uns zum Dank dafür noch anhören, dass sie aber die Freiheit, mit anderen Männern zu sprechen, nicht aufgeben wollen.“
„Ja, genau.“ „Stimmt; die mit ihrer Freiheit.“
Der ‚Professor’ fährt nachdenklich fort: „Wenn ihr mich fragt, ist diese Emanzipation nichts weiter als purer Egoismus; statt sich auf ihre Freunde oder Männer zu konzentrieren, denken sie nur an sich selbst.“
Aus der Küche ruft Toucou über seine Schulter in Richtung Wohnzimmer: „In Afrika wäre so eine Frau nur mit einer Prostituierten zu vergleichen.“
Er erntet johlende Zustimmung. Seine Freunde klatschen mit den Handflächen auf ihre Oberschenkel und lachen. „Genau, ich hatte am Anfang auch gedacht, dass es hier viele Huren gibt.“
„Aber sie sind es nicht?“, fragt Sekou.
„Nein, denn sie nehmen ja kein Geld für den Sex, und außerdem haben sie ja den meisten Spaß.“
„Hm, hm.“
„Also“, sagt Henri abschließend und klopft dem an seiner Seite sitzenden Ibrahim väterlich auf die Schulter, „es ist die reinste Zeitverschwendung sich mit den jungen Dingern abzugeben, weil sie dich nicht weiterbringen.“
„Aber die anderen, die zweite Sorte Frauen, wie ist die?“, fragt Amadou hoffnungsvoll und nimmt sofort wieder eine gleichgültige Körperhaltung ein, „ich meine, eigentlich interessieren mich die deutschen Frauen gar nicht, aber ihr habt uns richtig neugierig gemacht.“
Der ‚Professor’ holt tief Luft und hebt mit bedeutungsschwerer Stimme an: „Ja, die anderen, das sind die Älteren. Sie sind die richtigen Frauen für uns, solange wir hier in Deutschland wohnen.“ Er macht eine Pause, um sich zu sammeln. Er ist ehrlich bemüht, den Neuen keinen Mist zu erzählen. „Grob gesagt: Sie haben Verständnis für unsere Situation in dem für uns fremden Land; und als Konsequenz daraus helfen sie uns, wo sie nur können.“
„Und was soll das nun wieder heißen?“
„Das heißt, sie haben nichts gegen Ausländer. Egal, ob diese aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen hierher kommen. Nicht nur, dass sie fremde Kulturen und Religionen akzeptieren, nein, sie interessieren sich sogar dafür. Diese Frauen sind oft Künstlerinnen oder haben Berufe im sozialen Bereich. Sie können zum Beispiel Sozialpädagoginnen, Lehrerinnen, Krankenschwestern, Arzthelferin usw. sein. Und es ist ihnen geradezu ein Bedürfnis, sich für andere starkzumachen, sich für die Hilfebedürftigen in der Gesellschaft zu engagieren. Das ist an sich ja auch ganz lobenswert, aber diese Frauen tun das meistens nur, um ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Und wen brauchen sie dazu? Uns, den in allen Lebenslagen unwissenden Afrikaner.“
„Das verstehe ich nicht“, meint Amadou kopfschüttelnd, „es ist doch toll, wenn sie uns helfen wollen.“
„Denk doch mal weiter, Amadou“, hilft Ibrahim seinem Freund auf die Sprünge, „was passiert wohl, wenn die Frauen alles für uns erledigen?“
Henri klopft Ibrahim erneut, diesmal anerkennend, auf die Schulter. „Du hast es erfasst. Sie machen uns abhängig von sich, sie binden uns an sich, bis wir nichts mehr ohne sie tun können. Was dabei jedoch am meisten nervt ist, dass sie für jede Kleinigkeit, die sie für uns erledigen, unaufhörlich gelobt werden wollen. Das ist der Horror!“
Malik mischt sich ein: „Ja, das kommt noch dazu: Erst machen sie uns abhängig von ihrer Hilfe, und dann ist es auf einmal zu viel für sie. Sie demonstrieren mit endlosen Diskussionen, was sie alles für uns tun, und wollen unseren ewigen Dank. Wenn sie uns helfen wollen, weil sie in der Lage dazu sind, sollen sie es tun, wenn nicht, dann eben nicht. Was gibt’s da groß zu diskutieren?“
Etwas nachdenklich geworden fügt er hinzu: „Genau diese Abhängigkeit hat übrigens in meiner Ehe zur Trennung geführt. Meine Frau hat mir einfach alles abgenommen, Behördengänge, Kindererziehung, Wohnungssuche, Arbeitssuche, einfach alles. Ich kam mir vor wie ein Kind. Nur im Haushalt durfte oder musste ich mithelfen, und das mir, einem Afrikaner! Und was unsere Freizeit anging, wollte sie alles gemeinsam machen. Für sie gab es nur uns zwei. Okay, später dann eben uns drei, mit dem Kind. Und noch etwas: Als wir gerade mal drei Monate zusammen waren, hat sie doch tatsächlich von mir verlangt, meine Freunde nicht so oft zu treffen.“
Beifall heischend wegen dieser Ungeheuerlichkeit lässt er seinen Blick der Reihe nach über die Köpfe aller Anwesenden schweifen. Einige nicken erbost. Die Eifersucht der deutschen Frauen auf ihre durch nichts, aber auch wirklich nichts zu beeinflussende Männergemeinschaft ist ihnen allen ein Begriff.
„Als ich dann versucht habe, meine Probleme selbst in die Hand zu nehmen“, fährt Malik fort, „hat sie mich böse beschimpft: ‚Du bist undankbar, ich habe alles für dich getan, wo wärst du jetzt, wenn ich dir nicht immer wieder geholfen hätte? Du würdest wahrscheinlich immer noch in deiner Lehmhütte sitzen und darauf warten, dass der liebe Gott dir hilft.’ Das kann kein Mensch auf Dauer aushalten.“
„Nun übertreib aber nicht, Malik. Nicht alle deutschen Frauen sind so“, gibt jemand aus dem Kreis zu bedenken.
„Klar, es gibt immer Ausnahmen; es gibt auch sehr nette junge Frauen, und natürlich haben wir alle im Laufe der Jahre auch gute Erfahrungen mit den älteren Frauen gemacht.“
Malik nickt und fügt hinzu: „Ist ja gut. Meine ‚Ex’ ist ja auch ein nette junge Frau, aber ich weiß von anderen Landsleuten, dass die Älteren wenigstens nicht meckern, wenn wir wegen Schichtdienst selten ausgehen können, und sie ziehen auch nicht alleine los. Sie müssen eben nicht mehr jedes Wochenende in die Disco, weil sie das alles schon hinter sich haben.“
„Ich mag an den älteren Frauen ihre Lebenserfahrung. Man kann mit ihnen über alles reden und wertvolle Ratschläge erhalten“, sagt Apollinaire, den Blick schüchtern auf seine Sneakers geheftet. Auch diese Aussage erntet weitestgehend Zustimmung in der Runde.
„Sie erwarten keine Geschenke und auch nicht, dass wir sie einladen, weil sie wissen, dass wir jeden übrigen Cent nach Hause schicken wollen“, sagt jemand neben Amadou, „sie verstehen unseren Wunsch, unseren Leuten in Afrika ein besseres Leben zu ermöglichen. Viele helfen uns sogar dabei, sei es mit Geld oder auch Gütern. Die meisten von ihnen sind sehr sozial eingestellt.“
Der ‚Professor’ grinst und meint: „Ich brauche meiner Freundin nur mit feuchten Augen zu sagen, dass ich Heimweh nach meiner Mama habe, schon wird sie butterweich und hilft mir finanziell mit dem Flugticket oder kauft zumindest eine Telefonkarte.“ Alle lachen.
„Seht ihr?“, sagt Henri Beifall heischend, „das ist nur möglich, weil seine Freundin einen guten Job hat. Eine arme Studentin oder ein junges Mädchen in der Ausbildung könnte gar nicht helfen.“
„Meine Freundin packt eigenhändig die Pakete für meine Familie. Sie sagt immer, dass sie lieber jemandem hilft, den sie kennt - sie war schon einmal mit mir in Afrika -, als anonym zu spenden. Komisch, manchmal denke ich, die älteren Frauen haben alle ein schlechtes Gewissen, und um es zu beruhigen, spenden sie irgendeiner wohltätigen Institution, am besten gleich mit Lastschrifteinzugsverfahren, dann brauchen sie keinen Gedanken mehr daran zu verschwenden; oder sie machen es wie meine Freundin.“
„So sehe ich das auch“, meint Henri zu der Runde um den Tisch, „welche Freundin würde schon das Herz haben, nein zu sagen, wenn du sie um Geld für eine Operation deiner Mutter bittest?“
„Habt ihr auch mal an die Sprache gedacht? Mit einer deutschen Freundin lernt ihr viel schneller die Sprache, weil ihr natürlich daran interessiert seid, dass sie euch versteht. Da ist es zunächst auch egal, wie alt sie ist. Dazu kommt der nicht unwichtige Faktor, dass ihr leichter eine Arbeit finden könnt, wenn ihr in der Lage seid, euch zu verständigen. Aber nur die ältere Freundin wird mit euch üben, wenn sie Zeit hat und wenn nicht, weil sie berufstätig ist, organisiert sie einen Deutschkurs für euch, kümmert sich um alle Formalitäten, meldet euch an, bezahlt den Kurs wahrscheinlich auch noch und fährt euch, wenn sie ein Auto hat, sogar zum Unterricht.“
„Wow!!!“ kommt es dreistimmig von den Eingereisten. „Und was noch?“
„Sie waschen eure Wäsche, weil sie ja keine Maschine dafür haben und auch finden, dass es zu umständlich für euch wäre, in den Waschsalon zu gehen. Ihr braucht nur zu ihr zu sagen: ‚Liebling, du fehlst mir so und ich würde ja gerne zu dir kommen, aber ich muss noch in den Waschsalon; und du weißt ja, wie lange das dauert.’ Bisher hat noch keine meiner Freundinnen darauf gesagt: ‚Na, dann geh du mal schön in den Waschsalon und wir sehen uns vielleicht nächste Woche.’“
Auch dieser Wortbeitrag scheint die volle Zustimmung aller alten Hasen zu haben. Es hageln nur so die Bestätigungen: „Bei den älteren Frauen könnt ihr zum Beispiel bequem auf der Couch mit der Telefonkarte vom Festnetz telefonieren. Die Jungen haben meistens nur noch ihr Handy. Und manchmal, wenn ihr durchblicken lasst, dass ihr euch Sorgen um zuhause macht, lassen die älteren Ladys euch auch auf ihre Kosten telefonieren.“
„Ich habe auf diese Weise mal eine halbe Stunde mit meiner Freundin in Afrika telefoniert. Die Frau, mit der ich hier in Deutschland zu dem Zeitpunkt zusammen war, konnte ja meine Muttersprache nicht verstehen, aber irgendwann hat sie mich so komisch angesehen und hinterher war sie irgendwie schlecht gelaunt.“ Diesmal lacht keiner. Ibrahim macht ein saures Gesicht.
In der nun eintretenden Gesprächspause erhebt er sich und versucht hinter den Vorhängen mit großer Anstrengung das verklemmte Fenster zu öffnen. Malik hilft ihm unaufgefordert. Als es einen Spalt geöffnet ist, verschafft sich die herbstliche Luft, die Dunkelheit schon im Schlepptau, mit beißender Kälte Einlass in die Lungen der Anwesenden; die Gemütlichkeit ist dahin. Jemand betätigt den Lichtschalter, eine nackte Glühbirne an der Decke flammt auf. Toucou gesellt sich mit einem Tablett voller Teegläser, einer alten Keksdose, die jetzt für Zucker herhalten muss, und der Teekanne wieder zu der Gruppe im Wohnzimmer.
„Und was ist mit den Tabus?“, will Sekou wissen, aber keiner hat Lust, darauf zu antworten.
„Mann, lass es gut sein für heute. Darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal“, sagt Malik nachdrücklich.
„Aber eins möchte ich noch wissen“, sagt Ibrahim ruhig zu Malik, „wie alt sind denn so die älteren Frauen?“
„So um die 50.“
Die Neuankömmlinge sind wie vom Donner gerührt. Diese Aussage wirft nun wirklich viele neue Fragen auf.
Gedankenverloren genießen alle den starken Tee. Die ‚Neuen’ lassen immer so viele Erinnerungen hochkommen, an zu Hause oder an ihre eigenen ersten Tage im fremden Land.
Nach dem Tee erheben sich die ersten Gäste, um nach Hause zu gehen, „Ich habe heute Nachtschicht, muss noch etwas vorschlafen.“ „Wir reden nächstes Mal weiter.“ „Macht euch keine Sorgen.“ „Wir sehen uns morgen.“
Als alle weg sind, fragt Toucou die Freunde: „Seid ihr noch gar nicht müde?“ Sie nicken und er fährt fort: „Ich weiß noch genau, wie kaputt ich am ersten Tag war; die ganze Aufregung vorher und dann die Ankunft.“
Malik nimmt nun wieder die Fernbedienung des Fernsehers in die Hand und sie einigen sich stillschweigend auf einen relaxten Fernsehabend.
Bis in die späte Nacht flackert das bläuliche Licht des Fernsehbildschirms in der afrikanischen Enklave im vierten Stock des Hochhauses. Draußen, da ist der Dschungel, unbekannt und gefährlich.