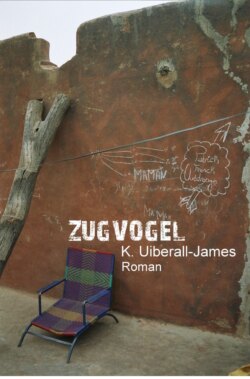Читать книгу ZUGVOGEL - K. Uiberall-James - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEin ganz normaler Tag
Sekou hat bei seinem Onkel geschlafen. Das macht er oft, um dem Stress mit seinem Vater zu entgehen. Es ist noch Nacht, als er sich von seinem Lager erhebt. Er tritt aus dem Haus und geht mit noch vom Schlaf verklebten Augen hinter die Büsche, um sich zu erleichtern. Dabei blickt er in den Himmel und sieht die Sterne in der beginnenden Morgendämmerung verblassen. Zurück im Haus, wirft er sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht, spült sich den Mund aus, nimmt ein paar Münzen aus einem Glas und schlüpft so leise wie möglich durch das knarrende Holztor.
Auf der Straße steuert er den Brotstand an, einen kleinen Holzverschlag mit einer Luke zum Herausreichen des Brotes. Hier schmeckt das Brot am besten. Beim Nachbarstand kauft er dann noch vier Eier, zwei Zwiebeln und etwas Erdnuss-Öl in einem kleinen Plastikbeutel. Der Verkäufer legt die Eier vorsichtig in einen zu einer Papiertüte zusammengedrehten Papierfetzen und lächelt Sekou freundlich an. „Vergiss nicht das Salz“, erinnert Sekou ihn mit ruhiger Stimme. Der Verkäufer knebelt einen Teelöffel voll Salz in einen noch kleineren Papierfetzen und packt alles in eine dünne Plastiktüte. „Grüß deinen Onkel von mir.“ Sekou nickt.
Der Verkäufer mag den Jungen, er ist immer hilfsbereit und höflich, und er ist sich für keine Arbeit zu schade. Manchmal, wenn abends noch Brot übrig ist, ruft er den Vorübergehenden zu sich und schenkt ihm ein oder zwei Brote - es wäre doch schade, wenn es altbacken würde - weil er weiß, dass Sekou seinen Stolz hat. ‚Tja, der Junge hat wirklich Pech gehabt’, denkt er und schaut ihm nachdenklich nach. ‚Ohne Mutter aufzuwachsen, ist schon schlimm genug, aber mit dem griesgrämigen Vater unter einem Dach zu leben, der mit dem Leben hadert und dem Sohn für jegliche Misere die Schuld gibt, ist nicht einfach.’
Er reicht der dreijährigen Tochter seiner Nachbarin eine volle Tüte hinunter in die ausgestreckten Ärmchen. „Kannst du das alleine tragen?“ „Ja“, antwortet sie stolz und balanciert auf dünnen Beinchen vorsichtig die Tüte auf dem Kopf.
‚Schließlich’, spinnt er seine Gedanken weiter, trifft den Jungen keine Schuld daran, dass seine Mutter von einem Verwandtenbesuch in Guinea nie mehr zurückkehrte. Er muss damals gerade mal fünf gewesen sein. Der einzige Lichtblick im Leben des Kindes war seither sein Onkel, ein Bruder seiner Mutter. Später hat der dann auch Sekous Begabung für das Kunsthandwerk entdeckt und ihn zu Baba Joel in die Ausbildung zum Instrumentenbauer geschickt. Alles schien sich für den Jungen endlich zum Guten zu wenden. Aber, wie das Leben so spielt.’ Er gibt sich seufzend einen Ruck, um seine trüben Gedanken abzuschütteln; er muss sich jetzt auf die Gegenwart konzentrieren; denn alle Dorfbewohner sind nun auf den Beinen und benötigen noch das eine oder andere zum Frühstück.
Mit dem duftenden Brot unterm Arm, und der Plastiktüte mit den übrigen Einkäufen in der Hand, stößt Sekou mit dem Ellenbogen das Tor zum Hof seines Onkels auf und legt seine Einkäufe in der Kochecke ab.
Bedächtig entfacht er ein kleines Kohlefeuer und setzt einen Topf mit Wasser für den Tee auf. In der Zwischenzeit verquirlt er die Eier in einer alten Tasse mit abgebrochenem Henkel und schneidet eine große Zwiebel in Streifen. Er hängt je einen Teebeutel in die bereitstehenden Becher, und als das Wasser kocht, nimmt er einen alten Lappen, um sich nicht an dem heißen Topf zu verbrennen und gießt es vorsichtig in die Becher. Er hebt den Kopf und lauscht auf die Geräusche aus dem Haus. Das Bett quietscht, eine Schranktür klappt, sein Onkel ist aufgestanden. Sekou setzt die flache Aluminiumpfanne auf das Feuer. Das Öl zischt, als er es in die heiße Pfanne gießt; zügig fügt er die Zwiebelstreifen hinzu, dünstet sie etwas an und schüttet die verrührten Eier darüber. Es duftet appetitlich.
Sein Onkel steht in der Türöffnung und schnuppert, während er sich das frisch gewaschene, geblümte Hemd zuknöpft.
„Gut geschlafen?“, fragt er und klopft Sekou freundlich auf die Schulter.
„Es geht so“, ist die vage Antwort, „und du?“
„Hervorragend.“ Sein Onkel nimmt die vollen Becher, zwei Teller und Gabeln mit an den kleinen Tisch auf der Veranda. „Bringst du das Brot mit?“, ruft er in Richtung Kochecke. „Hm“, kommt die Bestätigung.
Im Osten schiebt der herannahende Tag zartblau die Nacht wie eine Wand vor sich her, der Himmel färbt sich dort bereits leicht rosa, gleich wird die Sonne aufgehen. Die beiden Männer tauchen schweigend ihre Gabeln in die Pfanne und tunken Brotstückchen in die Soße.
„Hast du heute eine Tour über Nacht?“, fragt Sekou den Älteren respektvoll mit gesenktem Kopf und niedergeschlagenen Augen.
„Nein, ein Kollege wollte gerne mit mir tauschen; er hat eine Freundin in der Stadt. Warum fragst du? Du weißt doch, dass du immer hier sein kannst.“ Er schaut seinen Neffen forschend an. „Ich bin schon spät dran, lass uns heute Abend reden, in Ordnung?“
„Klar. Mach’ dir keine Sorgen, es eilt nicht.“
Onkel Louis erhebt sich etwas schwerfällig; sein Rücken ist nicht mehr der Beste. Seit mehr als 20 Jahren schon steuert er den großen Überlandbus durch die Dörfer bis zur Hauptstadt; jetzt nehmen ihm seine Knochen diese einseitige Tätigkeit übel. Aber er beklagt sich nicht, weil er seine Arbeit und die Menschen liebt. Jeder von hier bis zur Küste kennt ihn; er ist überall gern gesehen. Abgesehen davon verdient er genug, um seinem Neffen und seinem Schwager ab und an finanziell unter die Arme zu greifen.
Er holt seine Tasche aus dem Haus, stellt sie kurz ab, um mit einem Stofffetzen sorgfältig imaginäre Staubkörnchen von seinen hochglänzenden Schuhen zu entfernen und wirft das Tuch danach achtlos in die Ecke.
„Also dann …“; sie nicken sich zu. „Und schau nach deinem Vater; du kannst etwas Geld nehmen, um einige Lebensmittel für ihn zu kaufen“, fällt ihm noch ein, dann schlägt das Tor hinter ihm zu.
Zurück bleibt ein nachdenklicher Sekou, der sich mit einem Ruck erhebt und geistesabwesend mit mechanischen Handgriffen die Reste des Frühstücks abräumt. Er fühlt sich wie zerschlagen, denn er hat die halbe Nacht wach gelegen. Die harten Worte seines Freundes haben wie Heuschrecken in seinem Kopf herumgeschwirrt und ein heilloses Durcheinander angerichtet. Und gegen Heuschrecken ist man ja bekanntlich machtlos.
„Warum zerbreche ich mir eigentlich den Kopf?“, sagt er leise zu sich selbst, „es kommt sowieso, wie es kommen muss: Gott stellt uns auf die Probe; wir müssen durchhalten und abwarten, was er mit uns vorhat.“
Damit hat er dem Allmächtigen den Schwarzen Peter zugespielt, obwohl das sonst gar nicht seine Art ist, und ist fürs Erste aus dem Schneider. Erleichtert wäscht er ab und macht Ordnung im Hof. Er tut das gerne, weil er so seinem Onkel etwas von dessen Fürsorge zurückgeben kann; auch wenn Hausarbeiten nicht nur in dieser Region eher den Frauen überlassen werden. Mit einem letzten prüfenden Rundblick über den Hof vergewissert er sich, ob er auch alles erledigt hat, dann schließt er das Holztor von außen mit dem schweren Vorhängeschloss.
Auf der staubigen Straße lenkt er seine Schritte gleich, wie jeden Morgen, zu dem einzigen kleinen Supermarkt im Dorf.
„Wie ist es, habt ihr heute Arbeit für mich?“, fragt Sekou den vor der Tür stehenden Chef.
„Nein, komm morgen wieder; morgen bekomme ich eine größere Lieferung; da kann ich deine Hilfe gut gebrauchen.“ Er klopft dem Jungen wohlwollend auf die Schulter, dreht sich um und geht in den Laden.
Sekou macht sich auf den Weg nach Hause. Ab und zu hält er an, um mit Muße ein paar Früchte auszusuchen, die sein Vater gerne isst. Ja und dann kauft er noch Gemüse, Trockenfisch, einen Maggi-Brühwürfel und ein Beutelchen Reis. ‚Das reicht für heute Mittag und für heute Abend’, denkt er zufrieden, ‚verhungern müssen wir jedenfalls nicht.’
Seine Gedanken machen einen Abstecher zu seinen Freunden. Ibrahim schuftet sicher schon längst auf dem Feld und Amadou lässt sich wahrscheinlich in der Herberge herumkommandieren; so gesehen geht es ihm gar nicht so schlecht, aber er würde auch viel lieber hart arbeiten, um sein eigenes Geld nach Hause zu bringen.
Unterwegs versucht Sekou, sich innerlich gegen die immerwährende schlechte Laune seines Vaters zu wappnen. Eigentlich tut er ihm leid, so ganz alleine und ohne Geld. ‚Wenn er nur nicht immer so ungerecht wäre.’ Sekou kennt seine Pflichten als Sohn und würde sie liebend gerne erfüllen, aber ohne Arbeit … Dafür nimmt er sich heute vor, besonders liebevoll und nachsichtig mit ihm umgehen. So motiviert öffnet er schwungvoll das Tor zu seinem Zuhause und blickt geradewegs in die vorwurfsvoll aufgerissenen Augen seines Vaters.
„Mein Gott, hast du mich erschreckt! Musst du denn direkt hinter der Tür sitzen?“
„Ja, das muss ich wohl“, sagt der Alte mit hoher weinerlicher Stimme, „so kann ich wenigstens mit den Ohren am Leben auf der Straße teilhaben und gleichzeitig sichergehen, dass ich dich nicht verpasse.“ Und in anklagendem Ton fügt er hinzu: „Du gibst hier ja nur noch ein Gastspiel. Wer weiß, vielleicht kommst du auch eines Tages gar nicht wieder, wie deine Mutter.“
Sekou zwängt sich wortlos an ihm vorbei, um die mitgebrachten Lebensmittel in der Kochecke abzuladen. ‚Da hat er doch tatsächlich die schwere Bank bis zum Tor manövriert, nur um mir ein schlechtes Gewissen einzureden’, denkt er. Sein Vater folgt ihm humpelnd dicht auf den Fersen. Mit gestrecktem Hals meckert er vorwurfsvoll:
„Woher hast du das Geld, um all diese Sachen zu kaufen? Bist du jetzt unter die Diebe oder unter die Bettler geraten?“
Sekou dreht sich so abrupt um, dass sein Vater erschrocken fast über ihn fällt. „Warum denkst du immer nur das Grundschlechteste?“, herrscht er ihn dicht vor seinem Gesicht in scharfem Ton an. Für den Bruchteil einer Sekunde registriert er die ungepflegten weißen Bartstoppeln im Gesicht seines Vaters, nimmt dessen alte, grau verschleierte Augen wahr und fügt etwas verständnisvoller hinzu: „Du weißt doch, dass Onkel Louis aushilft, wenn ich keine Arbeit habe. Ich tue mein Bestes, um dir das Leben etwas leichter zu machen, aber du machst es mir wirklich schwer.“
Resolut dreht er sich um und beginnt geschäftig in der Kochecke zu hantieren. Etwas kleinlaut und beschämt setzt sich der Alte an den Tisch.
„Ich weiß, du bist ein guter Junge, du kommst ganz nach mir“, und beschwörend setzt er hinzu: „Du wirst mich nicht in Stich lassen.“
Sekou nickt und denkt dabei an seine Mutter, die er 15 Jahre nicht gesehen hat. Sie hat auch ihm all die Jahre gefehlt.
„Was ist nun, bekomme ich heute noch etwas zu essen?“, unterbricht sein Vater, plötzlich munter geworden, seine Gedankengänge.
„Sofort. Setz dich doch schon mal“; und er serviert ihm ein richtig gutes Frühstück, mit allem was dazugehört.
Derweil schleudert Amadou in der Herberge lustlos den Wischlappen in den Eimer mit Schmutzwasser. Er hat die Duschen und Toiletten gewischt, Papierrollen nachgefüllt - was machen die Touristen bloß mit dem ganzen Toilettenpapier? - alle Zimmer bis auf eins in Ordnung gebracht, und jetzt sind die Flure dran. Alle Türen stehen offen, damit der nasse Fußboden trocknen und Frischluft in die stickigen dunklen Flure strömen kann. Tagsüber gibt es manchmal keinen Strom, so auch jetzt. Nur ein schmaler Streifen diffusen Tageslichts schwächelt durch die vergitterten kleinen Lüftungsfenster in den Duschen und erhellt notdürftig den Flur. Für Amadou ist das kein Problem, er kennt jeden Winkel dieser Herberge; er könnte selbst mit verbundenen Augen noch seine Arbeit erledigen. Dabei nimmt er es auch nicht so genau, weil der allgegenwärtige Staub, kaum dass er den Rücken kehrt, sowieso alles wieder bedeckt. Er arbeitet mit eindrucksvoller Langsamkeit, schließlich muss er seine Kräfte für den ganzen Tag einteilen.
Als die Tür von Zimmer fünf aufgeht, fallen staubschwere Sonnenstrahlen schräg in den Flur. Amadou und der Gast, eine nachts eingetroffene deutsche Touristin, blinzeln sich an. Beide können im ersten Moment kaum etwas sehen.
„Guten Morgen Mademoiselle, haben Sie gut geschlafen?“, fragt er höflich auf Französisch. Lächelnd betrachtet er die junge Frau im Badelaken mit dem Kulturbeutel in der Armbeuge. Sie hat Schweißperlen auf Stirn und Oberlippe.
„Oh, ja, es war nur so heiß im Zimmer.“ Sie hat auf Französisch geantwortet. Verlegen blickt sie ihn aus hellgrauen Augen an. Amadou reckt den Hals, um einen Blick ins Zimmer zu erhaschen.
„Ist der Ventilator kaputt?“
„Nein, nein, ich habe ihn abgestellt, er war so laut und außerdem vertrage ich die Zugluft nicht.“
„Ja, aber dann ist es ja kein Wunder, dass es heiß in Ihrem Zimmer ist.“ Er schnalzt missbilligend mit der Zunge. „Sie haben die Vorhänge nicht zugezogen und die Glaslamellen sind auch geöffnet. So kann die Hitze natürlich eindringen.“
Sie fühlt sich wie ein Kind, dass man bei einer Dummheit ertappt hat, und darüber ärgert sie sich. „Ich bin nicht zum ersten Mal in Afrika“, ist daher auch die etwas patzige Antwort, „ich weiß, was die Afrikaner machen, um die Hitze ertragen zu können.“
Sie will an ihm vorbei, aber er steht wie festgewachsen im Weg. ‚Was bildet der sich ein’, denkt sie, und laut sagt sie zickig: „Ich hatte die Wahl, an Hitzschlag oder an Sauerstoffmangel einzugehen. Sie wissen ja, wofür ich mich entschieden habe. Würden Sie mich nun bitte vorbei lassen, damit ich endlich duschen kann?“
Amadou macht betreten ein paar Schritte zur Seite. Sie rauscht, so zivilisiert es eben geht mit dem alten Duschtuch, den strähnigen, verschwitzten Haaren und den ungeputzten Zähnen, an ihm vorbei. Fast wäre sie auf dem noch feuchten Steinfußboden ausgerutscht, aber Gott sei Dank hat sie sich noch rechtzeitig gefangen. Amadou ist das nicht entgangen. Er grinst und denkt: ‚So ergeht es einem, wenn man hochmütig ist’, und laut ruft er ihr hinterher:
„Wann kann ich Ihr Zimmer machen, Mademoiselle?“
Sie dreht den Kopf zur Seite und antwortet kühl: „Um zwölf bin ich weg.“
Amadou lässt prompt alles stehen und liegen, um bis zwölf Uhr andere Arbeiten zu erledigen. Als er die Tür zum Hof öffnet, schlägt ihm die Gluthitze des Vormittags entgegen. Missmutig macht er sich auf den Weg zur Küche.
„Was ist?“, empfängt ihn sein Kollege frotzelnd, „ist dir ein weißer Geist erschienen oder warum machst du so ein Gesicht?“
Amadou blickt auf den Berg schmutzigen Geschirrs, der auf ihn wartet, und, den kleinen Spaß ignorierend, blafft er seinen Kollegen an: „Wie soll ich denn meine Arbeit schaffen, wenn die Weiße von Zimmer fünf erst mittags aufsteht, und ich dann noch mal anfangen muss zu putzen?“ Sie beide wissen, dass das nicht der einzige Grund für Amadous Frust ist.
Um zwölf Uhr mittags bringt Aissatou Ibrahim das Mittagessen und eine Flasche Wasser zum Feld. Sie trägt alles auf dem Kopf in einer mit einem Tuch und einem Teller abgedeckten Emailschüssel. Ibrahim erwartet sie bereits erschöpft unter dem Baobab, der um diese Jahreszeit zwar kaum Schatten spendet, dafür aber eine bequeme Anlehnmöglichkeit bietet. Aissatou breitet ein Tuch auf dem Boden aus und stellt das Mitgebrachte vor Ibrahim. Als er bedächtig zu essen beginnt, setzt sie sich in ein paar Metern Entfernung ins Gras, um auf die leere Schüssel zu warten. Ibrahim genießt das fruchtige, scharf gewürzte Essen. Es belebt seine müden Lebensgeister.
Als sich Aissatou langsam wieder auf den Heimweg macht, folgen Ibrahims Augen ihr mit abwesendem Blick so lange, bis die kleine, hoch aufgerichtete Gestalt am Horizont verschwunden ist. Er gähnt und streckt sich für einen Moment aus. Bevor er die Augen schließt, nimmt er sich vor, sobald wie möglich mit seinen Freunden ein ernsthaftes Gespräch über ihre missliche Lage zu führen. Wenn nicht heute, dann eben morgen, oder übermorgen.
Sekou ist nachmittags wieder zum Haus seines Onkels gegangen, hat das Abendessen gekocht und einen Teil davon in einem kleinen Emailtopf für seinen Vater beiseite gestellt. Er wird es ihm nachher bringen und hat sich vorgenommen, einmal wieder zu Hause zu schlafen.
Müde wischt er sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Ihm ist gar nicht wohl bei dem Gedanken an das Gespräch, dass er mit seinem Onkel zu führen gedenkt. Das frisch angezogene T-Shirt klebt schon nach fünf Minuten wie eine zweite Haut an seinem Körper. Hunger hat er auch keinen. Wen wundert’s, wenn die Sonne noch nicht aufgibt und wie die Öffnung eines Backofens am Horizont glüht.
Geduldig starrt er auf das Hoftor; vor ihm das Abendessen unter sauberen Tüchern. Als es endlich aufgeht, liegt die frühe Nacht schon grau-lila über den Bodensenken.
Sie essen schweigend. Es gibt für alles eine Zeit und jetzt ist die Zeit des Essens.
Nach einer angemessenen Erholungspause eröffnet der Ältere das Gespräch. „Also, worüber möchtest du mit mir reden?“
„Onkel Louis, du weißt, dass ich dir sehr dankbar bin für die fortwährende finanzielle und moralische Unterstützung. Aber du weißt auch, dass es nichts Schlimmeres für einen Sohn gibt, als dass er nicht für seine Eltern sorgen kann. Vater lässt mich das jeden Tag aufs Neue spüren.“ Sein Onkel lehnt sich vorsichtig auf dem klapperigen Stuhl zurück, verschränkt die Arme vor der Brust und schaut ihn nachdenklich an.
„Worauf willst du hinaus, Junge?“
„Na ja, ich möchte einfach endlich wieder mit meiner Arbeit anfangen.“
„Und wie stellst du dir das vor? Du bist zwar der beste Instrumentenbauer in der Gegend, aber …“
„Ich weiß, ich habe kein Atelier, kein Material und keine Leute mehr.“
Onkel Louis schlägt eine Hand auf den Oberschenkel „Siehst du, also was soll’s?“
Er erhebt sich, um seine Zigaretten aus der Küche zu holen. Sekou schaut ihm ruhig nach und wartet, bis sein Onkel wieder am Tisch sitzt und sich eine angezündet hat.
„Aber genau darum geht’s; ich brauche nicht alles auf einmal zu haben. Für den Anfang würde das Geld für Material reichen.“
So, jetzt war’s raus, und bevor Onkel Louis nur den Mund aufmachen kann, fügt Sekou hastig hinzu: „Arbeiten könnte ich fürs Erste hier oder zu Hause, und verkaufen könnte ich in der Stadt. Es gibt da einen kleinen Laden; ich kenne den Besitzer von früher, als ich noch mein eigenes Atelier im Süden hatte. Er weiß, dass ich durch den Bürgerkrieg alles verloren habe, und will mir helfen. Er hat mir angeboten, alle Instrumente, die ich anfertige, in Kommission zu nehmen, und auch Bestellungen für mich anzunehmen. Die Touristen kommen wieder ins Land und ich habe früher mit meiner Arbeit genug verdient, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten; warum sollte das jetzt nicht wieder möglich sein?“ Sekou lehnt sich zurück, atmet tief ein und langsam wieder aus.
Eine kleine Ewigkeit herrscht tiefes Schweigen. Nebenan wird eine Öllampe angezündet. Trotz der zwei Meter hohen Mauer strahlt ein wenig von ihrem sanften Licht herüber; denn direkt an der Mauer auf der anderen Seite steht ein kleiner Baum, dessen staubig grünes Blätterdach das Licht einfängt und wieder zerstreut. Im Osten geht der Abendstern wie ein kleiner Edelstein auf.
Als Onkel Idrissa seine Haltung verändert, huscht eine Maus erschrocken im Zickzack über den Hof. „Wir sollten jetzt auch die Lampe anzünden“, sagt er lachend.
Sekou erhebt sich schleppend, um die vertraute Blechlampe zu holen. Er kehrt mit dem flackernden Licht zurück, hängt es an den rostigen Haken für die Wäscheleine und versucht dann, wieder eine günstige Sitzposition in dem unbequemen Plastikstuhl zu finden.
„Du willst also, dass ich dir dieses Startkapital leihe. Und an wie viel hattest du dabei gedacht?“
Mutig antwortet Sekou mit fester Stimme: „Nachdem ich alles durchgerechnet habe, denke ich, sollten 500 Euro reichen.“
Sein Onkel schluckt und streicht sich nachdenklich über das Kinn. „Dafür müsste ich einen Kredit aufnehmen, soviel habe ich nicht auf der Bank.“
Hoffnungsvoll beugt Sekou sich vor und sagt beschwörend: „Du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Ich habe es genau ausgerechnet: Nach drei Monaten kann ich mit der Rückzahlung beginnen.“ Beherrscht und bis zum Äußersten angespannt lehnt er sich wieder zurück und schaut seinen Onkel erwartungsvoll an.
„Ich glaube dir, aber ich möchte trotzdem wissen, wie deine Rechnung aussieht.“
Während Onkel und Neffe sich ausführlich über das Für und Wider eines Kredits beraten, spannt sich kühl und unbeteiligt das Sternenzelt über den weiten Himmel und Sekous Vater geht hungrig zu Bett.