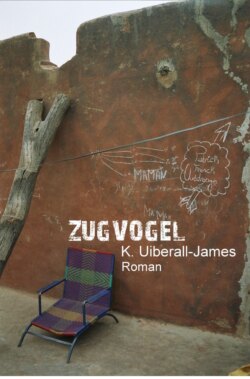Читать книгу ZUGVOGEL - K. Uiberall-James - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWestafrika, ein Dorf im Landesinneren in der Nähe einer Kleinstadt - Feierabend
Die Abenddämmerung treibt die widerspenstige Sonne gelassen vor sich her. Dieses allabendliche Machtspiel geht immer gleich aus; am Ende ist sie die Gewinnerin. Ihre Kontrahentin kann die Lehmwände der Rundhütten noch so wichtigtuerisch in ein Flammenmeertauchen, die Abendbrise hat ihr Mütchen heruntergekühlt und ihr Feuer aufs Dekorative reduziert.
Ibrahim ist auf dem Heimweg. Den ganzen Tag hat er bei der Feldarbeit unter der erbarmungslosen Sonne gelitten. Seine trockenen Augen brennen und er spürt die Müdigkeit in allen Knochen. Doch ein wenig kühles Wasser und eine anständige Mahlzeit werden ihn wieder fit für den Feierabend machen.
Der einzige Zugang zum Hof seiner Familie, ein zweieinhalb Meter hohes, verbeultes Blechtor, quietscht in den verrosteten Angeln, als Ibrahim es aufstößt und den Hof betritt. Er nickt den Anwesenden im Hof einen Gruß zu und geht geradewegs zu seiner Hütte.
Mit der Feldhacke noch auf der Schulter hebt er den verblichenen Vorhang und beugt müde den Kopf, um den Eingang zu betreten. Dabei streift sein Blick missmutig die Wand neben der Tür. Dort, wo die Lehmziegel verputzt sind, zeigen sich Risse wie feines Gespinst; kleine Insekten haben sich dort eingenistet und ein Gecko lauert bewegungslos auf die Chance einer Mahlzeit. Schweißperlen lösen sich von seiner Stirn und bahnen sich ihren Weg am Hals entlang. Er spitzt die Lippen und macht den typischen Schnalzlaut für Unmut, während er die Hütte betritt. ‚Ich muss die Risse noch vor der Regenzeit ausbessern.'
Als er wieder herauskommt, hat er ein buntes Tuch locker um die Hüften geschlungen, einen Handtuchfetzen über der Schulter und ein Bröckchen Seife in einer Hand. In abgetretenen Plastiksandalen schlappt er zu dem großen Tonkrug in der Ecke des Hofes, der jeden Tag vom Wasserlieferanten mit frischem Wasser aufgefüllt wird. Eine geblümte, mit kleinen Rostflecken gesprenkelte Emailschüssel deckt das kühle Nass ab. Ibrahim nimmt die Schüssel in die Hand und schöpft mit einer im Behälter schwimmenden Kalebasse Wasser in sie hinein. Als sie halb voll ist, stellt er sie auf der Mauer ab, die die Hütten und den Hirsespeicher seiner Familie umschließt.
Nachdem er auch das Hüfttuch auf der Mauer abgelegt hat, klatscht er sich prustend etwas Wasser ins Gesicht und seift sich dann akribisch ein. Seine wie in Zeitlupe ablaufenden Bewegungen haben dabei einen zeremoniellen, fast rituellen Charakter. Immer wieder füllt er die kleine Kalebasse mit dem Wasser aus der Schüssel und spült die Seife mit einem dünnen Strahl sorgfältig wieder von seinem Körper. Das letzte Licht des sinkenden Sonnenballs lässt seine Haut durch die in ihr gespeicherte Glut des Tages kupferrot aufleuchten, und bei jeder Bewegung versprühen die auf ihr perlenden Wassertropfen funkelnde Blinklichter in die ausgetrocknete Umgebung. Ibrahim streift sie mit der flachen Hand vom Körper und benötigt so kaum noch das Handtuch. Mit sparsamen Bewegungen schlägt er das Tuch wieder um die Hüften. Seine schmalen Hände haben auffallend lange, feingliedrige Finger, denen man die Arbeit auf dem Feld kaum zutraut, doch deren lederartige, rissige Haut verrät ihre wahre Tätigkeit. Ibrahim breitet das Handtuch zum Trocknen auf der Mauer aus und schüttet den Rest des Waschwassers mit Schwung und einem satten Platsch unter den staubigen Oleanderbusch.
Die dort dösende buntgefleckte Hauskatze hechtet fauchend aus dem dürftigen Schatten des Busches mitten unter die Frauen im Hof. Ibrahims Mutter springt, trotz ihres stattlichen Gewichtes, in Windeseile von ihrem Hocker bei den Kochsteinen auf, wo sie das Gemüse in ihrer Hand klein geschnitten hatte.
„Pass doch auf, was du tust“, schimpft sie und deutet mit dem Kochmesser in der Hand auf die umgefallene Blechschüssel mit dem schon geputzten Gemüse, „jetzt muss ich alles noch einmal waschen.“ Sie schnalzt ärgerlich mit der Zunge und klaubt das Gemüse aus dem Sand. „Tz, tz, da soll doch …“ Sie richtet sich schwerfällig auf und starrt auf vier Katzenbabys, die klatschnass und kläglich miauend orientierungslos zwischen den Kochutensilien herumwuseln. Ihre Mutter hat sie schmählich in Stich gelassen, als die ‚große Flut‘ über sie hereinbrach. Mit rollenden Augen und wild mit dem Messer fuchtelnd, versucht Ibrahims Mutter sie zu verscheuchen.
„Morgen kommt ihr weg!“, blafft sie die erbärmlich aussehenden Knäuel an, und zu Ibrahim gewandt: „Sieh nur was du angerichtet hast.“ Sie muss sich einfach Luft machen, um die durch den Schreck aufgebaute Spannung loszuwerden. Ibrahim eilt herbei und scheucht die Katzenbabys mit einem seiner ausgezogenen Latschen aus der Kochzone; dabei fällt die ohnehin schon brüchige Sandale vollends auseinander. Ein Teil von ihr fliegt haarscharf am Kochtopf vorbei, ‚und Action’, denkt Ibrahim und grinst.
„Das ist nicht witzig“, tobt seine Mutter mit gefährlich verrutschendem Pagne über den prallen Brüsten und erneuert den Knoten ihres Tuches. Ibrahim wirft ärgerlich die andere Hälfte der Sandale hinterher und entzieht sich jeder weiteren Diskussion, indem er in seiner Hütte verschwindet.
Die vierzehnjährige Aissatou kichert hinter vorgehaltener Hand. Ein Blick von Ibrahims Mutter genügt, und Aissatou schnappt sich die nassen Katzenbündel, rubbelt sie mit einem Zipfel ihres Pagne trocken und setzt sie in sicherer Entfernung bei ihrer aus dem Versteck wieder aufgetauchten Mutter ab.
Ibrahims zweijährige Nichte Fatou und sein knapp dreijähriger Neffe Marufo sitzen auf dem Sandboden und schauen dem Treiben mit großen Augen zu. Die Mutter der beiden, seine Schwester Dzuera, ist mit ihrem Baby beschäftigt. Die Kleinen lassen spielend Sand und Blätter aus ihren über dem Kopf erhobenen Händchen rieseln. Dabei bekommt Fatou Sand in die Augen. Schreiend reibt sie sich die kleinen Fäuste ins Gesicht. Aissatou lässt wieder ihre Töpfe in Stich und eilt tröstend an Fatous Seite. Sie nimmt sie auf den Arm und wischt ihr mit der flachen Hand den Sand aus dem Gesichtchen, drückt ihr die Augenlider zu und pustet liebevoll noch verbliebene Sandkörner um die Augen herum fort.
„Müsst ihr denn immer gleich so ein Geschrei machen?“, zetert Ibrahims gebrechlicher Vater von der ebenso hinfälligen Holzbank im Schatten der Hauswand. Kopfschüttelnd, die Hände auf seinen Stock gestützt, murmelt er: „Dieser Junge, wo der hinkommt, gibt es Unruhe“; und etwas lauter in Richtung Ibrahims Hütte: „Wo bleibt der Respekt gegenüber deinem alten Vater? Habe ich nicht das Recht auf einen ruhigen Abend im Kreise meiner Familie?“ Keine Antwort.
Stattdessen trägt die Abendbrise nun die friedlichen Geräusche der Nachbarn in die eintretende Stille seines Hofes. Nebenan wird Hirse gestampft, Kinder planschen mit dem Waschwasser, die Blechtore knarzen von den heimkehrenden Männern und Gesprächsfetzen wehen herüber.
‚So sollte es auch hier sein’, denkt Ibrahims Vater neidisch und steht mühsam auf. Eigentlich ist dies die angenehmste Stunde seines sonst eher eintönigen Tages; alle sind zu Hause und sein Sohn muss Rechenschaft über die ihm aufgetragenen Arbeiten ablegen. Das gibt ihm das Gefühl, noch der Herr im Hof zu sein. Außerdem schätzt er es, wenn die leichte, fast ätherische Abendluft sanft über sein zerfurchtes Gesicht streicht und ihm das Atmen erleichtert; er genießt die verführerischen Kochdünste, die seine Sinne wieder beleben, wenn er den Frauen beim Kochen zuschaut; aber vor allem liebt er es, von der kleinen Anhöhe den Blick über den Hof in die Savanne bis zum Horizont schweifen zu lassen und dabei seinen Gedanken nachzuhängen. Das alles hat ihm Ibrahim durch sein unbedachtes Handeln verdorben.
Der alte Ärger über seinen Sohn kommt wieder hoch: „Wir reden noch“, ruft er in Richtung Ibrahims Hütte und stakst steifbeinig zu seiner eigenen Hütte; dabei wendet er noch einmal den Kopf zu den Frauen und knurrt über die Schulter: „Ruft mich, wenn das Essen fertig ist.“
Schon ist die Nacht den verblassenden Rottönen des Tages hart auf den Fersen, während das Treiben im Hof wieder seinen normalen Gang geht. Dzuera ist dabei, das Tragetuch mit Baby Jean Léopold neu zu ordnen, um sicherzugehen, dass ihr das Kind, wenn sie sich beim Kochen bückt, nicht verrutscht. Während dieser Prozedur schwankt Baby Jean
Léopolds Kopf halsbrecherisch hin und her; aber Baby ‚Jelo’, so nennen es alle der Einfachheit halber, hält es nicht einmal für nötig, die Augen zu öffnen, denn es hat seit seiner Geburt die Erfahrung gemacht, dass es auf dem Rücken der Mutter sicher ist und viel interessanter als allein auf dem großen Bett in der Hütte, wo die älteren Kinder auf es aufpassen sollen, es kitzeln und an den Zehen ziehen, liebevoll, aber nicht gerade zimperlich.
Inzwischen ist das Essen fertig. Aissatou hat den Boden mit einem alten Stück Stoff ausgelegt, die gefüllte große Kalebasse und einen kleinen Topf mit Soße bereitgestellt und zwei Stangen Baguette danebengelegt. Die Holzschemel werden im Kreis darum angeordnet und wer keinen hat, hockt sich auf den Boden, sitzt seitwärts auf dem Tuch. So auch Ibrahim.
„Willst du noch weg?“, fragt ihn seine Mutter und mustert ihren Jüngsten von der Seite, der gebügelte Jeans und sein bestes T-Shirt trägt.
„Hm“, antwortet ihr Sohn einsilbig, was so viel wie ‚ja’ heißen soll.
Es gibt Reis mit Gemüse, Fisch und Huhn. Für diejenigen, die es scharf mögen, gibt es noch eine kleine Schüssel mit scharfer Soße. Fürsorglich lösen die männlichen Familienmitglieder, Ibrahims Schwager Massamba ist inzwischen auch zu ihnen gestoßen, Stückchen vom Fisch oder Fleisch und legen es den Frauen und Kindern dorthin, wo sie ihre Hand in die Schüssel tauchen. Es wird schweigend gegessen. Nur gelegentliches, zufriedenes Schmatzen, das Rascheln der Stoffe, wenn die Frauen sich bewegen und Fatous leises Quengeln ist zu hören. Ibrahim langt kräftig zu; er leistet die Schwerarbeit auf dem Feld und muss daher mehr essen. Als die Schüssel fast leer ist, löst sich die Runde nach und nach auf; die Frauen räumen auf. Sie werfen dem Hund die Reste hin, der sich mit einem Huhn darum streitet. Ibrahim verscheucht das Huhn, und, bevor wieder etwas passiert und er die Schuld daran trägt, oder sein Vater noch etwas sagen kann, verlässt er mit langen federnden Schritten erfrischt und gestärkt den Hof. Das alte Tor scheppert und rumpelt unter Protest gegen die grobe Behandlung.
Die Nacht wirft nun gemächlich ihr schwarzes Tuch über den Himmel. Am Straßenrand erhellen die kleinen Petroleumlampen der Händler und die Kohlefeuer der Garküchen notdürftig die angebotene Ware und werfen lange, von unzähligen Schlaglöchern unterbrochene Schatten auf die holprige Sandpiste. Die Garküchen haben Hochbetrieb und vor den aus alten Brettern zusammengenagelten Verkaufsständen drängen sich große und kleine Kinder, um ein Bonbon oder zwei Zigaretten für den Vater zu erstehen. Es gibt dort Kekse, Kaugummi und Moskitospiralen zu kaufen; eben alles, was der Mensch so zum Feierabend braucht.
Ibrahim weicht geschickt den im Schatten liegenden Löchern der Straße aus. Zielstrebig geht er auf die kleine Bar an der Ecke zu, eine Bretterbude, die an zwei Seiten die Luken geöffnet hat. Dort warten seine Freunde schon auf ihn. Sie hocken auf einer windschiefen Holzbank, jeder mit einem einheimischen Softdrink vor sich.
Zur Begrüßung klatschen sie sich grinsend mit erhobener Hand in die Handflächen. Die coole Begrüßung täuscht aber nicht über die latent vorhandene schlechte Laune der schon Anwesenden hinweg.
Ibrahim stützt seine Ellenbogen auf den hohen Holztresen, ordert eine Limonade und mustert seine Freunde über die Schulter von der Seite. „Was gibt’s Neues, alles okay?“ Er schiebt ein paar kleine Münzen über die Theke und setzt sich mit dem Getränk zu seinen Freunden.
„Ja, ja, was soll schon sein?“, kommt etwas unwirsch von Amadou zurück. „Immer dasselbe“, ergänzt Sekou und nimmt ergeben einen Schluck aus seiner Flasche.
Jeder hängt seinen Gedanken nach, bis Amadou in trotzigem Ton das Schweigen bricht: „Ich hab Lust auf eine Zigarette; habt ihr noch ein paar Münzen?“ Er schaut Sekou und Ibrahim fordernd mit geöffneter Hand an. Sekou krempelt bedauernd seine Hosentaschen nach außen und Ibrahim gesteht, dass er auch pleite ist. Die Freunde verfallen in unheilvolles Schweigen.
Sekou studiert aufmerksam das Etikett der Flasche in seiner rechten Hand; Amadou säuselt ohne Erfolg einer vorbeigehenden Dorfschönheit Komplimente hinterher.
„Vergiss es. Bei der wirst du nie landen“, belehrt Sekou seinen Freund, und mit verächtlicher Stimme: „Die geht nur mit einem Typen aus, der ein Auto hat und ihr Geschenke machen kann.“
Mit dieser Aussage tritt er nichts ahnend eine Lawine von angestautem Frust los. „Oh Mann“, stöhnt Amadou, „ich kann so nicht weitermachen. Jeden Tag, den Gott mir schenkt, arbeite ich von morgens bis abends, putze den Touristen das Klo, mache jede Dreckarbeit in der Herberge, und wofür? Für einen Hungerlohn! Und am Ende eines harten Tages kann ich mir nicht mal eine Zigarette leisten.“
„Aber du rauchst doch gar nicht“, versucht Sekou ihn zu beruhigen.
„Na und?“, schnarrt Amadou, „darum geht’s doch gar nicht.“
Die grellen Scheinwerfer eines luxuriösen Jeeps streifen für den Bruchteil einer Sekunde sein wütendes Gesicht und degradieren es zu einer Fratze; sie tauchen im unregelmäßigen Rhythmus der Schlaglöcher immer wieder auf und ab. Mit hochgekurbelten Fenstern bahnt sich der Jeep wie ein ungelenkes Erkundungsmobil auf dem Mars im Schritttempo seinen Weg an der Bar vorbei.
Die Augen der Freunde folgen wie hypnotisiert diesem fahrenden Alien, so nah und doch Lichtjahre entfernt.
„Die haben‘s gut“, mault Amadou, „da drinnen gibt es weder Staub noch Hitze.“ Dann springt er auf und kreischt: „Das glaub ich nicht. Seht mal, wer da neben ‚Mr. Right’ sitzt.“ Er will auf die Straße laufen und das Auto anhalten, doch Ibrahim und Sekou halten ihn fest. Die Insassen des Jeeps haben ihre Blicke stur nach vorne gerichtet, während das Fahrzeug langsam an ihnen vorbeizieht und sich an der Ecke den Blicken der drei Freunde entzieht.
Völlig fertig von seinem Ausbruch, lehnt Amadou sich an die Bretterwand der Bar. „Kein Wunder, dass Miriam auf den Affen reinfällt; ich kann ihr ja nicht mal ne Fanta spendieren“, fügt er, etwas ruhiger geworden, hinzu. „Das bisschen, dass ich verdiene, reicht kaum für Lebensmittel und die Medikamente meiner Mutter.“
„Ach beklag dich nicht immer“, wirft Sekou mürrisch ein, „du hast wenigstens noch Arbeit. Sieh mich an, ich renn den ganzen Tag durch die Stadt auf der Suche nach irgendwelchen Gelegenheitsarbeiten; und wenn ich dann todmüde nach Hause komme, fragt mein Alter mich, wovon ich denn müde sei, ich hätte ja den ganzen Tag nichts getan. Dann bin ich erst richtig frustriert. Wenn mein Onkel mir nicht hin und wieder etwas zustecken würde, dann könnte ich mich gar nicht mehr zu Hause sehen lassen.“
„Hey, hört auf damit“, wirft Ibrahim beschwichtigend ein, „lasst uns nicht Trübsal blasen; das führt doch zu nichts.“ Er blickt seine Freunde mit ruhigen, dunklen Augen an. Nur die immer präsente senkrechte Falte zwischen seinen Brauen und die nahezu chronisch nach unten gezogenen Mundwinkel zeugen von seinem eigenen, schon lange währenden Frust.
„Ich verstehe nicht, wie du das aushältst“, poltert Amadou und projiziert seinen Ärger über die fahnenflüchtige Freundin auf den immer geduldigen, besonnenen Ibrahim. „Du schuftest tagein tagaus auf dem Feld, tanzt wie ein Sklave nach der Pfeife deines Vaters und darfst obendrein auch noch die Verantwortung für alles tragen. Ich an deiner Stelle wäre schon längst abgehauen.“
„Eines Tages …“, beginnt Ibrahim, aber Amadou schneidet seinem Freund ungeduldig das Wort ab, „eines Tages, eines Tages, wie lange willst du noch warten? Du bist der Älteste von uns. Glaubst du wirklich, dass sich etwas ändert, wenn dein Vater dir auch offiziell die Verfügungsgewalt über Hof und Feld gibt?“
„Nein, das wohl nicht, aber eines Tages, so Gott will, werde ich das Dorf verlassen und einen eigenen Laden in der Stadt haben.“
„Klar, und ich bin dein bester Kunde“, witzelt Amadou übertrieben optimistisch, „und als dein langjähriger Freund habe ich selbstverständlich lebenslangen Kredit, oder?“ Alle drei lachen.
Seit der Schulzeit sind sie unzertrennlich, und, obwohl sie sich nicht nur äußerlich sehr voneinander unterscheiden, haben sie doch eines gemeinsam: Sie sorgen für ihre Familie und leben am Existenzminimum.
„Ach Leute, was ist nur aus unseren Träumen geworden?“, seufzt Amadou.
„Was für Träume?“, stichelt Ibrahim, „Träume sind Schäume und wir haben es mit der harten Realität zu tun.“ Als Antwort breitet Amadou die Arme aus und erhebt sich halb von der wackeligen Bank, als wolle er abheben. Sekou kann gerade noch seine halb volle schwankende Flasche festhalten.
„Die Welt dreht sich und wir sitzen hier wie der Pickel am Arsch fest“, tönt Amadou theatralisch und richtet den Blick dann wütend in die Runde.
„Was kannst du denn nicht ab, das Drehen oder das Festsitzen?“, fragt Sekou ironisch grinsend und zieht seinen Freund zurück auf die Bank.
Amadou lässt aber nicht locker. „Ich komme mir vor wie eine blöde Ameise in ihrer Mini Welt von Arbeit und Familie. Es gibt doch auch noch Anderes im Leben.“
Sekou und Ibrahim klopfen dem Freund beruhigend auf die Schulter. „Ich bin aber ein Mensch“, insistiert Amadou bockig, die Hände der Freunde von seinen Schultern abschüttelnd.
„Klar, wissen wir doch …“, feixen Sekou und Ibrahim.
„Ich will Spaß haben und etwas von der Welt sehen, und tolle Klamotten kaufen.“ Jetzt reißt Ibrahim der Geduldsfaden.
„Aber sonst geht’s dir gut?“ Sie schweigen wieder.
Später versucht der Barkeeper, ihnen die leeren Flaschen abzunehmen, doch sie finden noch ein paar Tropfen auf dem Boden des Glases. „Für heute ist Feierabend, Jungs; geht nach Hause“, sagt er väterlich und fängt ohne zu drängen an, die Holzklappen herunterzulassen.
„Ich muss in ein paar Stunden schon wieder aufstehen“, sagt Ibrahim und erhebt sich.
Vor der Bar trennen sich die Freunde. Jeder geht in eine andere Richtung. Schon nach ein paar Metern hat die afrikanische Nacht ihre Gestalten verschluckt; die kleinen Feuer der Garküchen verglühen langsam, während sich der Rand des Mondes in die Nacht schiebt. Es sind nur noch wenige Menschen unterwegs.
Auf dem Heimweg denkt Ibrahim mit gesenktem Kopf darüber nach, wie schlecht seine Chancen stehen, in absehbarer Zeit seinen Traum vom Import- und Exportladen zu verwirklichen.
‚Sekou und Amadou haben recht; ich werde das Startkapital nie zusammenbekommen’, denkt er verzweifelt, ‚trotz der harten Arbeit. Wenn Papa mir wenigstens erlauben würde, etwas anzubauen, das mehr Geld einbringen könnte. Aber nein. Das wäre ja ein Risiko.’ Wütend kickt er einen Stein aus dem Weg und knickt im nächsten Schlagloch mit dem Fuß um.
„Au! Verdammter Mist!“ Noch etwas humpelnd erreicht er das heimatliche Tor. Seine Wut verraucht, als er seine Mutter sieht, die die letzte Wäsche von der Leine nimmt und ihm über die Schulter mit erhobenen Armen zulächelt. „Mama können wir reden?“
„Wann, jetzt?“, fragt sie mit einem forschenden Blick in sein Gesicht.
„Ja, wenn du fertig bist.“
Sie sitzen nebeneinander auf der schmalen Holzbank, lauschen in die Nacht hinein; alle Hühner sind nun still, nur die Grillen zirpen und der Wind spielt mit dem dürren Laub des Oleanderbusches. „Du brauchst nichts zu sagen, mein Sohn; ich verstehe dich.“
„Ja, aber …“
„Warte noch ein wenig, wir müssen erst noch das Dach vor der Regenzeit reparieren und die Wände ausbessern“, flüstert sie, „danach werde ich mit deinem Vater reden.“
„Ach Mama, es wird immer etwas dazwischen kommen“, stellt Ibrahim mit harter Stimme klar, so als wäre er dabei, die Geduld zu verlieren, „und Papa erwartet von mir, dass ich die Landwirtschaft auch in Zukunft in den Mittelpunkt meines Lebens stelle. Du weißt doch, was er immer sagt, wenn ich mal wieder einen Vorstoß in Richtung Selbstständigkeit wage, ‚von deinen Flausen im Kopf werden wir nicht satt.’ Und damit ist für ihn das Thema erledigt, ich halte wie immer den Mund und gehe lustlos wieder an die Arbeit.“
Seine Mutter seufzt und schaut in den schwarzen Nachthimmel. Dort ist nicht viel zu sehen; Hilfe ist von dort auch nicht zu erwarten, also wendet sie sich wieder ihrem Sohn zu. Mitleid und sehr viel Liebe schwingen in ihrer Stimme, als sie vorsichtig sagt:
„Vielleicht kannst du das alles viel besser ertragen, wenn du endlich heiratest.“
„Ach Mama, fang doch nicht wieder damit an. Warum habe ich wohl nicht einmal eine feste Freundin? Weil ich mich erst gar nicht auf ein Leben im Dorf einstellen will.“
Enttäuscht über den Ausgang des Gesprächs und etwas ärgerlich erhebt Ibrahim sich; seine Mutter hält ihn besorgt am Ärmel fest.
„So Gott will, wird schon alles gut werden, mein Sohn“, versucht sie ihn wieder versöhnlich zu stimmen.
Ibrahim hält seine Mutter liebevoll bei den Schultern, schaut ihr fest in die Augen und sagt: „Keine Angst Mama, ich werde immer für dich sorgen; aber ich muss meinen Weg gehen.“
Er verschwindet, von den sorgenvollen Blicken seiner Mutter begleitet, in seiner Hütte. ‚Morgen ist auch noch ein Tag’, denkt Ibrahims Mutter und wischt verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel.
Amadou überlegt, ob er noch bei Miriam vorbeigehen soll, um seine Freundin wegen der Fahrt im Jeep zur Rede zu stellen. Aber es ist schon spät; ihre Eltern sind sehr streng und außerdem muss er nach Hause, um nach seiner kranken Mutter zu sehen.
Sein Vater sitzt noch draußen auf der Bank. „Na, Papa, noch nicht müde?“ Er setzt sich neben ihn und versucht, sich seinen Kummer und Frust nicht anmerken zu lassen.
„Ich habe auf dich gewartet, Amadou“, antwortet sein Vater, „deiner Mutter geht es gar nicht gut, kannst du …“
Amadou erhebt sich sofort wieder und lauscht am mit Stoff verhangenen Eingang zur Hütte seiner Mutter. Leise fragt er durch den Vorhang: „Mama, bist du noch wach?“
Jaa, komm’ nur herein“, flüstert sie schwach. Er setzt sich ans Kopfende der Schlafstätte zu ihr auf den Boden.
„Miriam war hier“, fügt sie hinzu und schließt vor Schwäche die Augen.
„Mama, du sollst dich nicht anstrengen“, lenkt Amadou ab, weil er nicht möchte, dass seine Mutter sich aufregt. Er taucht einen Stofffetzen in die neben dem Bett stehende Wasserschüssel, wringt ihn aus und betupft behutsam die heiße Stirn seiner Mutter. „Soll ich den Doktor holen?“, fragt Amadou mit besorgter Miene.
„Nein, nein, so schlimm ist es nicht.“ Sie versucht sich etwas aufzurichten, „aber ich muss mit dir reden.“ Amadou setzt sich zu ihr auf das Bett und hält stützend den rechten Arm um die Schultern seiner Mutter. „Es geht um Miriam“, beginnt sie und macht erschöpft eine Pause, „sie ist solch ein liebes Mädchen.“
„Da bin ich mir nicht mehr so sicher; ich habe sie heute Abend im Jeep von dem Typen gesehen, der in Deutschland lebt und zu Besuch bei seiner Familie ist.“
„Ach Junge, das hat nichts zu sagen; er hat sie nur ein Stück mitgenommen, weil sie so viel zu tragen hatte. Das hat sie uns selbst erzählt.“ Amadou schweigt. „Aber du solltest nicht mehr zu lange mit dem Heiraten warten, sie liebt dich wirklich und hat es nicht verdient, so hingehalten zu werden.“
Amadou antwortet nicht; seine Gedanken driften, wie schon so oft, zurück zu dem Afrikafestival, das vor einigen Jahren live im Fernsehen übertragen worden war. ‚Wo hatte das noch stattgefunden?’, versucht er sich zu erinnern, ‚auf jeden Fall in Europa.’
Der Besitzer vom ‚Paradies’ hatte damals in einem Anfall von Großzügigkeit und der Erwartung eines festtagsähnlichen, hemmungslosen Getränkeumsatzes, seinen Fernseher mit drei gefährlich brüchigen Verlängerungskabeln unter dem Mangobaum aufgestellt. Das ganze Dorf hatte, auf dem nackten Boden hockend, fasziniert die Funken sprühende Show von tanzenden und singenden Afrikanern verfolgt. Begeisterung und Stolz waren auf den Gesichtern des Publikums abzulesen.
Nur einmal wurde diese friedvolle Einträchtigkeit unter den Schaulustigen von etwas wirklich Trivialem empfindlich gestört: von einem dicken Vogelschiss direkt auf den Fernseher. Den Besitzer des Fernsehers traf fast der Schlag. Er sprang vom einzigen Stuhl auf und brüllte in die verunsicherte Menge: „Macht das weg oder ich mach den Kasten aus!“ Ein Tumult entstand; einige waren der Meinung, dass der Besitzer das selber machen sollte, andere waren der Meinung, den Vogelschiss nicht weiter zu beachten, um die Show nicht zu verpassen, andere wiederum konnten sich vor Lachen kaum halten, und noch andere waren wütend, weil die Palavernden den Bildschirm verdeckten. Schließlich wurde der Barkeeper, der nichts Böses ahnend weitere Getränke herausbrachte, dazu verdonnert, die Schweinerei zu beseitigen. Sein angeekeltes Gesicht dabei provozierte die Anwesenden prompt erneut zu einer Vielzahl von Bemerkungen mitfühlender, aufziehender oder höhnischer Art. Amadou schmunzelt bei dem Gedanken an die Szene.
„Amadou, woran denkst du?“ Seine Mutter legt ihre verschwitzte Hand leicht auf den Arm ihres Sohnes. In ihren Augen flackert ein Lächeln.
Erfreut nutzt er die Gelegenheit, um seine Mutter etwas aufzuheitern. „Ach, kannst du dich noch an den Vogelschiss auf dem Fernseher der ‚Paradies‘-Bar erinnern?“ Natürlich kann sie das, und für eine kleine Weile denken beide nicht an Krankheit.
Als Amadous Mutter erschöpft ihre Augen schließt, kehren seine Gedanken wieder zurück zu den afrikanischen Künstlern.
‚Die haben es geschafft’, hatte er damals gedacht, ‚dabei machten sie dort auf der Bühne in Europa nichts anderes als zu Hause. Nur, dass sie dort Geld dafür bekamen. Sie nannten sich ‚Botschafter der afrikanischen Kultur’ und die Weißen fuhren total darauf ab.’
Amadou ist ein Tagträumer.
Seine Gedanken driften in seinen Lieblingstraum ab, wo auch er Botschafter seiner Kultur ist, wo er als Tänzer um die Welt reist und sich auf internationalen Bühnen feiern lässt. Er würde erst dann zurückkommen, wenn er das nötige Geld hätte, um die besten europäischen Ärzte und eine Pflegerin für seine Mutter zu engagieren, und wenn er seinen Eltern ein schönes, kühles Haus bauen könnte.
„Amadou, hörst du mich? Ich rede mit dir.“ Amadou hört sie nicht; sein Körper ist zwar anwesend aber sein Geist hat den afrikanischen Kontinent verlassen. ‚Ja, und er würde auch etwas für sein Dorf tun. Nicht wie die anderen, die nur an sich selbst denken, die gerade mal das Nötigste aus dem reichen Europa schicken. Zugegeben, um es richtig zu machen, müsste er zunächst in der Hauptstadt eine traditionelle Tanzausbildung absolvieren, um sein Talent professionell umzusetzen; tanzen kann ja jeder.’
„Amadou.“
„Ja, Mama“, er wendet ihr schleppend den Kopf zu, die Augen folgen verzögert, als müssten sie sich gewaltsam von seinem schönen Zukunftstraum losreißen. „Tut mir leid; was hast du gesagt?“
Sie seufzt. „Ich wünsche mir so sehr, dass du Miriam heiratest.“
„Mama, ich bin noch zu jung zum Heiraten, und abgesehen davon haben wir kein Geld für eine Hochzeit.“
Das Petroleumlämpchen neben dem Bett seiner Mutter flackert und erlischt dann ganz. Mutter und Sohn lassen die vollkommene Dunkelheit zu. Reglos verharren sie in Schweigen; die unausgesprochenen Worte hängen abwartend in der stickigen Luft. Sie haben keine Eile. Dann entschließt Amadou sich doch, für Licht zu sorgen. Er tastet auf dem Regal neben dem Bett nach Streichhölzern, steht auf, hebt den Vorhang vor dem Eingang zur Seite und befestigt ihn an einem dafür vorgesehenen Nagel. „Ich hole nur Öl für die Lampe, bin gleich wieder da“, sagt er leise in Richtung Bett.
Als er zurückkommt, ist seine Mutter in einen leichten Schlaf gefallen. Er sorgt dafür, dass die Lampe wieder brennt, fächelt mit einem Stück Pappe etwas frische Luft in die Hütte und gesellt sich dann zu seinem Vater draußen auf die Bank. „Schläft sie?“ „Ja.“ Ihre Blicke wandern bedächtig hoch zum Himmel, wo unzählige Sterne nach und nach ihre Position einnehmen.