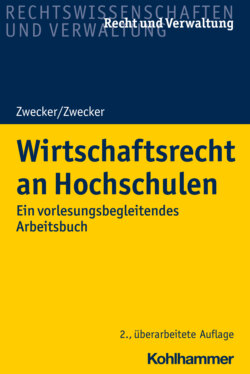Читать книгу Wirtschaftsrecht an Hochschulen - Kai-Thorsten Zwecker - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.Anspruchsgrundlagen
Оглавление19Wenn ein Anspruchsteller etwas von einem Anspruchsgegner möchte, braucht er eine gesetzliche Grundlage, die sein Begehren trägt. Diese Normen heißen in der juristischen Fachsprache Anspruchsgrundlagen. Anspruchsgrundlagen erkennen Sie daran, dass diese unter gewissen Voraussetzungen zu einer bestimmten (der vom Anspruchsteller gewollten) Rechtsfolge führen.
Beachten Sie:
Anspruchsgrundlagen sind immer Normen, die als „WENN – DANN“-Sätze aufgebaut sind.
Beispiel: So lautet etwa § 280 Abs. 1 BGB wie folgt:
„Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen“.
Mit anderen Worten:
– wenn der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt und hierdurch ein Schaden entsteht (= Tatbestandsvoraussetzungen),
– dann kann der Gläubiger diesen Schaden ersetzt verlangen (= Rechtsfolge).
20Man kann Anspruchsgrundlagen also in Tatbestandsvoraussetzungen (Wenn) und Rechtsfolgen (Dann) zerlegen. Das Auffinden der richtigen Anspruchsgrundlage bereitet vielen Studierenden große Schwierigkeiten. Je besser Sie die Systematik eines Gesetzes verstehen, desto einfacher wird das Suchen und Finden der richtigen Anspruchsgrundlage.
Tipps für Anfänger:
21– Schauen Sie sich immer genau an, was der Anspruchsteller will und fragen Sie sich, warum der Anspruchsteller meint, einen Anspruch zu haben.
Beispiel: B will Schadenersatz, weil A den Vertrag nicht erfüllt hat.
– Benutzen Sie das Stichwortverzeichnis des Gesetzes.
Beispiel: Im Stichwortverzeichnis finden Sie unter „Schadenersatz wegen Nichterfüllung“ den Verweis auf § 280 BGB.
– Mit anderen Worten: Denken Sie immer von der Rechtsfolge her und suchen Sie eine Norm, die genau diese Rechtsfolge abbildet.
Beispiel: Wenn A eine Internetbestellung widerrufen hat und seinen bereits gezahlten Kaufpreis zurückhaben will, ist nicht § 355 Abs. 1 BGB die Anspruchsgrundlage. Denn diese Norm regelt, dass bei einem berechtigten Widerruf der Verbraucher an seine Willenserklärung nicht mehr gebunden ist. Sie regelt aber nicht, dass dann der Kaufpreis zurückzuzahlen ist. Diese Rechtsfolge ergibt sich aus § 355 Abs. 3 BGB („Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich zurück zu gewähren“). § 355 Abs. 3 BGB bildet also genau die Rechtsfolge ab, die A haben willen (Geld zurück) und ist daher die Anspruchsgrundlage.
Tipps für Fortgeschrittene:
22– Überlegen Sie sich, ob es sich um einen vertraglichen oder einen gesetzlichen Anspruch handelt. Oft kommen auch mehrere Anspruchsgrundlagen in Betracht, dann spricht man von sogenannter Anspruchskonkurrenz.
– Vertragliche Ansprüche werden immer zuerst geprüft. Dann kommen gesetzliche Ansprüche in folgender Reihenfolge: dingliche Ansprüche, Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung, Ansprüche aus Delikt, Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag.
– Schauen Sie bei vertraglichen Ansprüchen immer in den Regelungen des jeweiligen Vertragstyps (Kaufvertrag, Mietvertrag etc.) nach und unterscheiden Sie zwischen Primäransprüchen (Erfüllungsansprüchen) und Sekundäransprüchen. Die Anspruchsgrundlage für Erfüllungsansprüche ist meist die erste Norm des jeweiligen Vertragstyps.
Beispiel:
– Anspruch auf Kaufpreiszahlung § 433 Abs. 2 BGB,
– Anspruch auf Mietzins § 535 BGB,
– Anspruch auf Arbeitslohn § 611 BGB etc.
Lösung zu Fallbeispiel 2:
B möchte von A Schadenersatz, weil A den Vertrag über den Kauf des Porsches mit ihm nicht erfüllt hat. A hat also eine Pflicht aus dem Vertrag mit B verletzt. Die richtige Anspruchsgrundlage wäre in diesem Falle § 280 Abs. 1 BGB Schadenersatz wegen Pflichtverletzung.