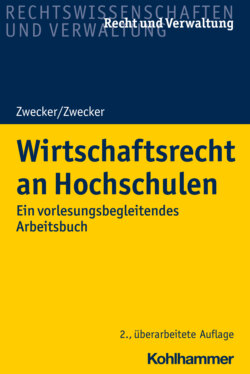Читать книгу Wirtschaftsrecht an Hochschulen - Kai-Thorsten Zwecker - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.Allgemeines Schuldrecht
Оглавление38Das allgemeine Schuldrecht ist in den §§ 241–432 BGB geregelt. Die dort enthaltenen Normen gelten grundsätzlich für alle Schuldverhältnisse. Der dritte Abschnitt des BGB, also die §§ 311–360 BGB, gilt jedoch nur für vertragliche Schuldverhältnisse.
39Das allgemeine Schuldrecht umfasst dabei Regelungen
– zu den Inhalten von Schuldverhältnissen (bspw. §§ 241–271 BGB),
– zu Störungen innerhalb von Schuldverhältnissen (bspw. §§ 280–292 BGB) und
– zum Erlöschen von Schuldverhältnissen (bspw. §§ 362–397 BGB).
40Weiterhin enthält das allgemeine Schuldrecht Regelungen zur Übertragung von Forderungen (§§ 398–413 BGB) und über die Verhältnisse bei einer Mehrheit von Schuldnern oder Gläubigern (§§ 420–432 BGB).
41Aus § 241 BGB ergibt sich, dass kraft des Schuldverhältnisses der Gläubiger berechtigt ist, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Hieraus kann man entnehmen, dass ein Schuldverhältnis die Beziehung zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner einer Forderung ist, die nach § 241 Abs. 1 Satz 2 BGB auch in einem Unterlassen bestehen kann. Bei einem gegenseitigen Vertrag sind in der Regel beide Parteien sowohl Gläubiger als auch Schuldner.
Beispiel: Bei einem Kaufvertrag (§ 433 Abs. 1 BGB) ist der Verkäufer verpflichtet, die verkaufte Sache an den Käufer zu übergeben und zu übereignen. Insoweit ist er Schuldner der Übergabe- und Übereignungspflicht. Nach § 433 Abs. 2 BGB hat der Verkäufer aber auch einen Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Kaufpreises. Er ist daher Gläubiger des Kaufpreisanspruchs.
Beispiel: Der Käufer hingegen muss nach § 433 Abs. 2 BGB den Kaufpreis bezahlen. Er ist Schuldner des Kaufpreisanspruchs. Im Gegenzug hat er den bereits dargestellten Anspruch auf Übergabe und Übereignung der verkauften Sache (§ 433 Abs. 1 BGB). Er ist mithin Gläubiger des Übergabe- und Übereignungsanspruchs.
42Schuldverhältnisse begründen und gestalten im Wirtschaftsleben also Rechtsbeziehungen zwischen Rechtssubjekten und sind damit die zentrale Grundlage für den Austausch von Gütern. Das wichtigste Gestaltungsmittel ist hierbei der Vertrag. Schuldrechtliche Rechtsbeziehungen unterliegen – anders als im Sachenrecht – keinem gesetzlichen Typenzwang. D. h., es kann grundsätzlich jedes beliebige Schuldverhältnis vereinbart werden, und jeder Rechtsteilnehmer kann frei neue Vertragstypen schaffen.
Beispiel: Im besonderen Schuldrecht ist bspw. der Kaufvertrag gesetzlich geregelt (§§ 433 ff. BGB). Für Leasingverträge, Lizenzverträge oder Franchiseverträge existieren aber keine gesetzlichen Regelungen. Diese Vertragstypen hat die Praxis frei geschaffen.
43Die Typenfreiheit von Verträgen ergibt sich aus der verfassungsrechtlich garantierten Privatautonomie (Art. 2 GG). Aus dieser lässt sich auch ableiten, dass viele Bestimmungen des BGB durch die Vertragsparteien per Vereinbarung abdingbar, also durch andere Vereinbarungen veränderbar, sind. Man spricht hier auch vom dispositiven Recht. Allerdings sind nicht alle Regelungen des Schuldrechts dispositiv. Dies gilt insbesondere für solche Regelungen, die die Allgemeinheit oder Verbraucher schützen.
Beispiel: Verträge, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nach § 138 BGB zwingend nichtig. So ist etwa ein Vertrag über die Begehung einer Straftat immer unwirksam.
Beispiel: Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Auch diese Regelung ist zwingend. Das erkennen Sie daran, dass § 307 Abs. 3 BGB dies ausdrücklich regelt.