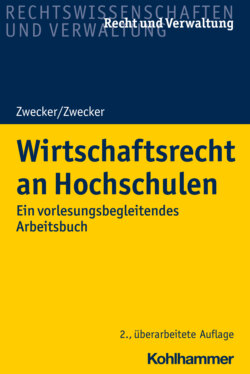Читать книгу Wirtschaftsrecht an Hochschulen - Kai-Thorsten Zwecker - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.Darstellung in der Klausur
Оглавление31Für Sie ist nun wichtig, wie Sie die dargestellten fünf Schritte der juristischen Fallbearbeitung in Ihrer Klausur anwenden können. Das Vorgehen ist nachfolgend dargestellt.
Schritt 1: Anspruchsgrundlage
32Die Darstellung der dargestellten Arbeitsschritte in der Falllösung und Klausur erfolgt im sogenannten „Gutachtenstil“. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Obersätze im Konjunktiv formuliert werden. Dies liegt daran, dass zu Beginn der Prüfung noch nicht klar ist, ob der begehrte Anspruch tatsächlich besteht oder nicht.
In der Einleitung (Obersatz) sind grundsätzlich
– Anspruchsteller (Wer?),
– Anspruchsziel (Was?),
– Anspruchsgegner (Von wem?) und
– Anspruchsgrundlage (Woraus?)
darzustellen.
Beachten Sie:
Als Hilfestellung in der Klausur sollten Sie sich bei der Fallbearbeitung immer die Frage stellen:
„Wer will was von wem woraus?“
Fortsetzung der Lösung zu Fallbeispiel 2:
Wenden wir diese Frage nun auf unser Fallbeispiel an, lautet der Obersatz für die Fallbearbeitung:
– „B (Anspruchssteller = Wer?)
– könnte einen Anspruch auf Schadenersatz (Anspruchsziel = Was?)
– gegen A (Anspruchsgegner = Von wem?)
– aus § 280 Abs. 1 BGB (Anspruchsgrundlage = Woraus?) haben.“
Schritt 2: Tatbestandsvoraussetzungen
33Die Darstellung der Tatbestandsvoraussetzungen können Sie als Stereotyp mit dem Satz „Voraussetzung hierfür ist …“ einleiten.
Fortsetzung der Lösung zu Fallbeispiel 2:
Wenden wir dies auf die vier vorab definierten Tatbestandsmerkmale des § 280 Abs. 1 BGB an, ergibt sich bspw. folgende Formulierung:
Voraussetzung hierfür ist
(1) das Vorliegen eines Schuldverhältnisses zwischen A und B,
(2) eine Pflichtverletzung des A und,
(3) dass bei B ein Schaden eingetreten ist.
(4) Weiterhin muss A die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
Schritt 3: Subsumtion
34Wenn Sie nach der Definition des jeweiligen Tatbestandsmerkmals die konkrete Sachverhaltsprüfung vornehmen, können Sie diese mit der Formulierung: „im vorliegenden Fall …“ einleiten. Eine ausführlichere Diskussion können Sie mit der Wendung: „fraglich ist …“ beginnen.
Beachten Sie:
Insbesondere bei den Definitionen der Tatbestandsvoraussetzungen sollten Sie großen Wert auf sprachliche Präzision legen. Viele Formulierungen des Gesetzes sind abstrakt und nicht mehr unbedingt den heutigen Sprachgebräuchen entsprechend. Dies liegt daran, dass das BGB bspw. in seiner Grundform aus dem Jahr 1900 stammt und dann im Laufe der Jahre erweitert und ergänzt wurde.
Denken Sie hierbei insbesondere daran, dass Begriffe, die in der Alltagssprache oft undifferenziert verwendet werden, in der Rechtssprache mit einer exakten Bedeutung belegt sind.
Beispiel: In der Alltagssprache wird nicht zwischen Einwilligung und Genehmigung unterschieden („Meine Eltern haben eingewilligt“ oder „Meine Eltern haben das genehmigt“). In der Rechtssprache haben die Begriffe aber unterschiedliche Bedeutungen. So bedeutet Einwilligung eine Zustimmung vor der Vornahme eines Rechtsgeschäfts (§ 183 BGB) und Genehmigung die Zustimmung nach der Vornahme eines Rechtsgeschäfts (§ 184 Abs. 1 BGB).
In der Alltagssprache macht es auch bspw. keinen Unterschied, ob Sie sagen, ich bin Eigentümer oder Besitzer eines Fahrrads. In der Rechtssprache haben diese Begriffe allerdings völlig unterschiedliche Bedeutungen. So ist Eigentümer derjenige, dem die Rechtsordnung die Sachherrschaft über eine Sache zuweist (§ 903 BGB), während der Besitzer derjenige ist, der die tatsächliche Gewalt über eine Sache hat (§ 854 Abs. 1 BGB). Wenn A dem B ein Fahrrad klaut, ist A bspw. Besitzer, jedoch B Eigentümer.
35Wenn sie im Rahmen einer Fallbearbeitung eine Definition nicht kennen, versuchen Sie diese aus dem Wortlaut der Norm, dem Bedeutungszusammenhang mit anderen Vorschriften und dem Sinn und Zweck des Gesetzes zu ermitteln.
Fortsetzung der Lösung zu Fallbeispiel 2:
Im vorliegenden Fall hat A den Porsche an C übergeben und übereignet. Er kann daher seine vertragliche Verpflichtung gegenüber B nicht mehr erfüllen. Fraglich ist allerdings, ob A diese Pflichtverletzung verschuldet hat, denn er hat die Mail ja nicht mehr vor seinem Urlaub gelesen. Es entspricht jedoch einem allgemeinen Sorgfaltsmaßstab, dass sich derjenige, der eine Angebotsfrist setzt, die Kenntnis darüber verschaffen muss, ob sein Angebot innerhalb der gesetzten Angebotsfrist angenommen wurde oder nicht. Daher hat A im vorliegenden Fall zumindest fahrlässig im Sinne von § 276 Abs. 2 BGB gehandelt.
Beachten Sie:
In der Falllösung sollten Sie großen Wert darauflegen, dass Sie Gesetze exakt zitieren. Oftmals sind gesetzliche Vorschriften sehr lang und enthalten viele Alternativen. Zitieren Sie daher präzise nur den für Ihren Fall relevanten Teil.
In der Falllösung können Sie bspw.
– den Absatz mit einer römischen und den Satz mit einer arabischen Ziffer oder alternativ
– den Absatz mit dem Kürzel „Abs.“ und den Satz mit dem Kürzel „S.“
angeben, um dem Leser eine genaue Differenzierung zu ermöglichen. Klären Sie unbedingt die in Ihrem Kurs gängige Zitierweise ab und halten Sie diese dann konsequent durch.
Beispiel: Wenn Sie darauf hinweisen wollen, dass der Verkäufer einer Sache diese frei von Sachmängeln zu übergeben hat, zitieren Sie § 433 Abs. 1 Satz 2 BGB (alternativ: § 433 I, 2 BGB).
Schritt 4: Folgerungen und Ergebnis
36Wenn Sie im Rahmen der Subsumtion geprüft haben, ob der von Ihnen zu beurteilende Sachverhalt mit den gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen übereinstimmt, können Sie hieraus die Schlussfolgerung ziehen, ob die vom Anspruchsteller begehrte Rechtsfolge eintritt oder nicht.
Beispiel: Die Voraussetzungen des § 280 BGB sind im vorliegenden Fall erfüllt, daher besteht ein Anspruch auf Schadenersatz in Höhe von 9.000 €.
Beispiel: Im vorliegenden Fall fehlt es daher an einer Pflichtverletzung im Sinne des § 280 BGB, daher besteht kein Anspruch auf Schadenersatz.
Beachten Sie:
Bei manchen Anspruchsgrundlagen müssen alle Anspruchsvoraussetzungen gemeinsam (kumulativ) vorliegen. So muss bei § 280 BGB ein „Schuldverhältnis“ und eine „Pflichtverletzung“ und ein „Schaden“ und das „Vertreten müssen“ des Schuldners vorliegen, damit die gewünschte Rechtsfolge eintritt. Bei anderen Vorschriften wiederum sind die Voraussetzungen alternativ (entweder oder). So muss bspw. bei einem Anspruch auf Herausgabe wegen ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 BGB jemand durch die Leistung oder in sonstiger Weise auf Kosten eines anderen etwas ohne rechtlichen Grund erlangt haben.