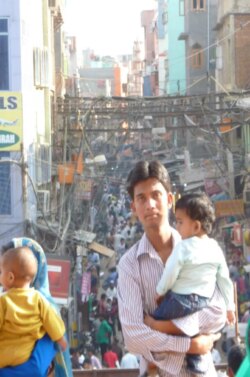Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 191
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Daseinsundank und Dankeszynismus
ОглавлениеAuch wenn unser Leben voller Bedrängnis sein mag: Es gebe immer einen Grund für adresselosen Dank – Dank dafür, dass uns etwas gelingt, etwa aus der Not herauszufinden. In seinen Gedanken zur Dankbarkeit will Dieter Henrich durchaus „nicht vergessen, dass viele Menschen ihr Dasein als Last, dass manche es sogar als Fluch erfahren, von dem sich freizumachen sie nur nicht die Kraft finden – und dass Religionen, insonderheit die des Buddha, es ihre erste Wahrheitslehre sein lassen, das Dasein müsse als Leiden erkannt werden.“ (Dieter Henrich, Gedanken zur Dankbarkeit, S. 166) Demnach müsste der Buddhist von Daseinsundank erfüllt sein, bedauernd, dass man ihn gezeugt und geboren hat? Henrich stellt uns das Remedium des Hinayana-Buddhismus vor:
„Im Lichte dessen also, dass ich selbst mögliches non ens bin, erfahre ich nun allererst, was es heißt, dass Gelingen gewährt ist. So könnte wohl sogar ein Buddhist des kleinen Fahrzeugs für sein Dasein dankbar sein. Denn wenn ihm auch dies Dasein für sich Leiden ist, so ist es / gleichwohl die Voraussetzung dafür, dass er die Seligkeit der Erleuchtung an der Schwelle des Ausgangs aus dem Kreislauf des Karma gewinnt, in der die Nichtigkeit des Lebensgrundes als solche sich erschließt.“ (S. 171f)
Hier versucht Henrich, gegen den Daseinsundank ein Tauschgeschäft zu etablieren, das unlauter scheint: Der Buddhist weiß, dass es im Leben kein dauerhaftes Glück gibt, wie kann Henrich da seine Leiderfahrungen mit dem Augenblick der Erleuchtung vor dem Eintritt ins Nirvana-Nichts kompensieren wollen?
Und was rät Henrich den nicht im (karmischen) Glauben stehenden Elenden der Erde oder gar einem aufgeklärten Antinatalisten? „Die Not und die Lebenskatastrophen der anderen schließen gerade für die mitfühlende Teilnahme den Dank fraglos und gänzlich aus. Aber auch das je eigene Leben ist vielfach solchem ausgesetzt, was, wenn dies denn möglich ist, nur ertragen und ausgestanden werden kann. Für die Kraft des Überstehens, nicht aber für das, was in die Not zog, kann dann Dankbarkeit aufkommen. Wenn also trotz alledem von der Erfahrung die Rede ist, dem ganzen Lebensgang in Dankbarkeit zu entsprechen, so in einem Sinn, der nicht dementieren muss, was so offenkundig außer Frage steht.“ (S. 188) Aus Henrichs Anempfehlung, zwar nicht daseinsdankbar zu sein, wenn Andere in Not geraten und sich aus der Not befreien, wohl aber daseinsdankbar zu sein, wenn man selbst die Kraft hatte, eigene tiefe Not zu überstehen, spricht tiefgehende Nichtseinsblindheit: Hätte eine Person P niemals zu existieren begonnen, so wäre keine Person P dagewesen, der dies geschadet (oder genutzt) hätte. Da der bloße Dank für eine gelungene Überwindung einer Notsituation („Dankbarkeit, in der sich unser Lebensgang unter Einschluss der Not zu sammeln vermag“ (S. 190)) ungeeignet ist, Daseinsundankbarkeit in Ansehung von Leid zu überwinden, rettet sich Henrich in letzter Instanz offenbar in die Arme eines Gottes, auf den er daraus schließt, dass die Welt als Natur keinen Dank entgegennehmen kann, die Welt als Schöpfung aber sehr wohl:
„Wer in seinem Weltverhältnis zur Dankbarkeit findet, wird kaum im ganzen Ernst daran festhalten können, dass er seinen Dank der Welt gibt, in Dank ihr also nicht nur zugewendet ist. Setzt doch Dank zu sagen wirklich voraus, dass man von einem solchen weiß, das diesen Dank auf- und anzunehmen vermag. Soweit der Dank als kommunaler verstanden wird, müsste er also eine Adresse haben, welche nicht die Welt selbst sein kann, sondern das sein müsste, woraus sich die Welt bildet und erschließt – also ein Grund dem Züge der Personalität zuerkannt werden können.“ (S. 189f) Liest man hier Klartext, so ergibt sich die Aufforderung: Seien wir dankbar gegen den göttlichen Welturheber, die die Welt so einrichtete, dass wir unverdient in Not gerieten, aus der wir uns letzten Endes befreien konnten.
Bezeichnenderweise blenden Henrichs metaphysische Gedankengänge den schlichten Sachverhalt aus, dass wir uns weniger einer wie immer personalisierten Welt „verdanken“, sondern vielmehr unsere Eltern für unser Dasein verantwortlich zeichnen, woraus sich die von ihm unbehandelten Kategorien des Elternundanks und der Elternschuld ergeben.
Elterntabu, Elternverwünschung