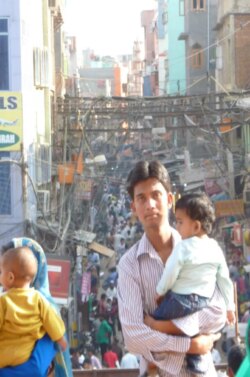Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 198
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDestruktivkraftentwicklung und Produktivkraftentwicklung
Gern denkt man sich die menschliche Geschichte von einer erst unendlich langsamen, dann immer rasanter ablaufenden Entwicklung der Produktivkräfte begleitet oder getragen. Ihr Movens ist jedoch immer auch die Entwicklung von Destruktivkräften, was Balzac in folgende Worte fasste: „Der Triumphwagen der Zivilisation ist grausam, wie jener des Götzenbildes von Jaggernat.“ (Balzac, Vater Goriot, S. 5)
Die Verflechtung von Produktivität und Destruktivität ist nicht etwa Sache dunkler Vergangenheit, sondern erhellt vorzüglich aus der genetischen und funktionellen Struktur des Kapitalismus. – Derjenigen gesellschaftlichen Formation also, deren raison d’être nichts Geringeres als die von Schumpeter so genannte kreative Zerstörung ist: „Creative Destruction is the essential fact about capitalism.“ (Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, S. 83) Nun ist aber kreative Zerstörung nicht nur das bestimmende funktionelle Moment des Kapitalismus, sondern der Kapitalismus selbst scheint aus einem Prozess gesteigerter „kreativer“ Zerstörung hervorgegangen: Mit seinem Buch „Krieg und Kapitalismus“ scheint Werner Sombart der Nachweis gelungen, dass der – stets zerstörerische – Krieg auf ganz unmittelbare Weise am Aufbau des kapitalistischen Wirtschaftssystems beteiligt ist, weil er mit den modernen Heeren eine wichtige Triebkraft kapitalistischer Wirtschaftsentwicklung geschaffen hat. Insbesondere, so Sombart, fungierte der Krieg über die Ausbildung moderner Heere als „Marktbildner“.
Büchner, Georg (1813–1837)
Von seiner Warte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus erkennt Büchner eine Verschränkung von Produktiv- und Destruktivkraftentwicklung, die ihn eine Fortsetzung der Menschheit im Zeichen des Fortschritts hinterfragen lässt:
„Die Schritte der Menschheit sind langsam, man kann sie nur nach Jahrhunderten zählen, hinter jedem erheben sich die Gräber von Generationen. Das Gelangen zu den einfachsten Erfindungen und Grundsätzen hat Millionen das Leben gekostet, die auf dem Wege starben.“ (Büchner, Werke und Briefe, S. 41)
Früher als andere zeigt sich Büchner willens, die Opfer von Fortschritt und Kulturschaffen ins Kalkül zu ziehen, die somit als Basis für eine Verteidigung des Schöpfers nicht länger in Frage kommen: „... Sie müssen mir zugestehen, dass es gerade nicht viel um die himmlische Majestät ist, wenn der liebe Herrgott in jedem von uns Zahnweh kriegen, den Tripper haben, lebendig begraben werden oder wenigstens die sehr unangenehmen Vorstellungen davon haben kann.“ (S. 43)
Heine, Heinrich (1797–1856)
Eindeutiger als Büchner im Vorhof des Antinatalismus angesiedelt ist Heine mit seiner Formulierung zur Verschränkung von Fortschritt und Destruktion: „Aber ach! jeder Zoll, den die Menschheit weiterrückt, kostet Ströme Blutes; und ist das nicht etwas zu teuer? Ist das Leben des Individuums nicht vielleicht ebensoviel wert wie das des ganzen Geschlechtes? Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.“(Heine, Reisebilder, Dritter Teil, in: Werke und Briefe, Bd. 3, S. 261) Mit der Frage, ob die bisherigen „Ströme Blutes“ kein zu teurer Preis seien, insinuiert Heine eine Einstellung der Fortzeugung.
Gattungsgesamtleid(ensbilanz), Grenzwert, neganthropischer, Kantischer Limes