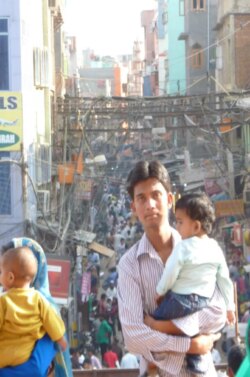Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 205
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dizee-Transformation bei Kant
ОглавлениеSeit der „Kritik der reinen Vernunft“ von 1781gilt für Kant, was er in der Kritik der Urteilskraft von 1790 folgendermaßen resümiert: „dass für das Dasein des Urwesens, als einer Gottheit, oder der Seele, als eines unsterblichen Geistes“ kein theoretischer Beweis möglich ist. (vgl. Kant, Werkausgabe, Bd. 10, S. 433) Wenn Kant gleichwohl auch nach seiner alle metaphysischen Aussagen tangierenden kritischen Wende an Gott und der Unsterblichkeit der Seele als Postulaten festhält, so ist dies mit Bezug auf praktisch-ethische Aspekte seines Denkens zu begründen. Wobei uns diesbezüglich Kants Blick auf die bisherige menschliche Geschichte interessiert: Ohne diese Postulate nämlich wären die Greuel der menschlichen Geschichte derart überwältigend und unvermittelt, dass man sich nur entsetzt von ihr abwenden könne, wie ein scheinbar unbefangen metaphysischer Kant in seiner Schrift „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ von 1784 es ausdrückt:
„Denn was hilft’s, die Herrlichkeit und Weisheit der Schöpfung im vernunftlosen Naturreiche zu preisen und der Betrachtung zu empfehlen: wenn der Teil des großen Schauplatzes der obersten Weisheit, der von allen diesem den Zweck enthält, – die Geschichte des menschlichen Geschlechts – ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben soll, dessen Anblick uns nötigt, unsere Augen von ihm mit Unwillen wegzuwenden…“ (Kant, Schriften zur Geschichtsphilosophie, S. 38)
Soll die Vorsehung gerechtfertigt werden (Theodizee), müsse ein besonderer „Gesichtspunkt der Weltbetrachtung“ (ebd.) gewählt werden. Betrachtet man die Geschichte so, als unterliege ihr eine „vernünftige Absicht“ (ebd.), so müsse man an ihrem Lauf nicht verzweifeln und den Blick nicht abwenden, sondern könne sich Hoffnung machen, dass es einst besser sein wird: „Man kann sich die Geschichte der Menschengattung im Großen als die Vollziehung eines verborgenen Plans der Natur ansehen, um eine innerlich - und zu diesem Zwecke auch äußerlich - vollkommene Staatsverfassung zu Stande zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann.“{54} (A.a.O., S. 33)
In seiner Schrift „Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte“ von 1786 erläutert Kant den „verborgenen Plan“ und spricht (wie es scheint wiederum unter Hintanstellung von Einsichten seiner metaphysikkritischen Philosophie) „von der größten Wichtigkeit: mit der Vorsehung zufrieden zu sein“ (a.a.O., S. 81): „Der denkende Mensch fühlt einen Kummer, der wohl gar Sittenverderbnis werden kann…: nämlich Unzufriedenheit mit der Vorsehung, die den Weltlauf im Ganzen regiert, wenn er die Übel überschlägt, die das menschliche Geschlecht so sehr und (wie es scheint) ohne Hoffnung eines Bessern drücken.“ (Ebd.) Als das größte Übel nennt Kant hier Kriege und die Kriegsrüstung. Gleichwohl sei auf unserer Kulturstufe „der Krieg ein unentbehrliches Mittel, diese noch weiter zu bringen; und nur nach einer (Gott weiß wann) vollendeten Kultur würde ein immerwährender Friede für uns heilsam und auch durch jene allein möglich sein. Also sind wir, was diesen Punkt betrifft, an den Übeln doch wohl selbst schuld, über die wir so bittere Klage erheben.“ (A.a.O., S. 82) Diesem Argumentationsgang kann man eine gewisse Ungeheuerlichkeit nicht absprechen: Einerseits soll die bisherige Geschichte einem verborgenen Plan/der Vorsehung unterliegen (die für den metaphysikkritischen Kant längst hinfällig und nur mehr ein Als-Ob ist), andererseits seien die Menschen aufgrund ihrer Freiheitsbegabung selbst daran schuld, es noch nicht zu „vollendeter Kultur“ gebracht zu haben und sich bis auf Weiteres bekriegen zu müssen. Wobei der „ewige Friede“, dem Kant später eine eigenständige Schrift widmet, zuallererst verdient werden muss und nicht auf jeder Kulturstufe „heilsam“ wäre.
Eine von Kant registrierte „zweite Unzufriedenheit des Menschen“ (a.a.O., S. 82) betrifft die Kürze des Lebens, mit der sich jeder gezeugte Mensch konfrontiert sieht. Doch erhofft Kant sich nichts von einer „Verlängerung eines mit lauter Mühseligkeiten beständig ringenden Spiels“ (S. 82) und malt aus, zu was für Zuständen die ungesellige Geselligkeit auf unserer niedrigen Kulturstufe führen würde, wenn die Lebenszeit auf 800 Jahre erhöht würde. Er gelangt zu dem Schluss, „dass die Laster eines so lange lebenden Menschengeschlechts zu einer Höhe steigen müssten, wodurch sie keines bessern Schicksals würdig sein würden, als in einer allgemeinen Überschwemmung von der Erde getilgt zu werden.“ (a.a.O., S. 83)
An diesem Befund zur Nichtswürdigkeit der Gattung auf dem derzeitigen Kulturstand hält Kant noch in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ von 1795 fest. Es sei nicht möglich, Gott zu rechtfertigen, derartige Wesen geschaffen zu haben. Eine Theodizee wäre also dann unmöglich, wenn gewiss wäre, dass keine höhere Kultur möglich ist. Da aber diese Gewissheit nicht gegeben sei, bestehe Hoffnung:
„Die Schöpfung allein: daß nämlich ein solcher Schlag von verderbten Wesen überhaupt hat auf Erden sein sollen, scheint durch keine Theodizee gerechtfertigt werden zu können (wenn wir annehmen, daß es mit dem Menschengeschlechte nie besser bestellt sein werde noch könne); aber dieser Standpunkt der Beurteilung ist für uns viel zu hoch, als daß wir unsere Begriffe (von Weisheit) der obersten uns unerforschlichen Macht in theoretischer Absicht unterlegen könnten.“ (Zum ewigen Frieden, S. 325)
Kant begab sich offenbar in eine Pattsituation: Gibt es Gott, so ist nicht zu rechtfertigen, dass er derart miserable Wesen erschuf, wie wir es derzeit sind. Was bleibt, ist jedoch die vage Hoffnung auf eine nicht auszuschließende bessere Zukunft des Menschengeschlechts. Aus dieser Pattsituation heraus weisen Ausführungen Kants in seiner Schrift „Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee“ von 1791. Dieser Schrift kommt ein herausragender Rang zu, da ihre Reflexionen Kant dichter an einen historisch informierten Antinatalismus heranführen als andere seiner Schriften. Auch in seiner Misslingensschrift macht Kant in kritischer Manier geltend, dass wir es bei Gott mit einem Gegenstand zu tun haben, „der auf dem Wege des Wissens (theoretischer Einsicht) gar nicht erreichbar ist…“ Weil nun aber das Postulat der Existenz Gottes für den moralischen Haushalt der Menschen unverzichtbar sei, baut Kant seinen Text zum Misslingen der Theodizee so auf, als sei eine Verhandlung über die Taten und Unterlassungen Gottes (dessen Existenz/Nichtexistenz ihm zugleich als unbeweisbar gelten) vor dem Gerichtshof der Vernunft möglich. Kant bringt Argumente der Verteidiger Gottes vor, um sie dergestalt zu widerlegen, dass sie das Scheitern aller Theodizee anzeigen.
Ein Verteidiger Gottes vor dem Gerichtshofe der Vernunft kann vorbringen, so Kant, das Leben sei gar nicht so schlimm und schmerzerfüllt, wie die Ankläger Gottes behaupten, die eine Theodizee verlangen. Kant formuliert diese Position so, „dass in den Schicksalen der Menschen ein Übergewicht des Übels über den angenehmen Genuß des Lebens fälschlich angenommen werde, weil doch ein Jeder, so schlimm es ihm auch ergeht, lieber leben als tot sein will…“ Dieser Gottesverteidigung stellt Kant nun anklagend gegenüber:
„Allein man kann die Beantwortung dieser Sophisterei sicher dem Ausspruche eines jeden Menschen von gesundem Verstande, der lange genug gelebt und über den Werth des Lebens nachgedacht hat, um hierüber ein Urtheil fällen zu können, überlassen, wenn man ihn fragt: ob er wohl, ich will nicht sagen auf dieselbe, sondern auf jede andre ihm beliebige Bedingungen (nur nicht etwa einer Feen-, sondern dieser unserer Erdenwelt) das Spiel des Lebens noch einmal durchzuspielen Lust hätte.“
Während also die Verteidiger Gottes vorbringen, wer einmal ins Dasein getreten ist, wolle selbst dann nicht aus dem Dasein scheiden, wenn dieses von Schmerzen erfüllt ist, glaubt Kant anführen zu können, dass niemand erneut in ein – wie immer modifiziertes – Dasein eintreten wollen würde, nachdem er das Leben gründlich kennengelernt und darüber nachgedacht hat. Wer hierin nur eine Privatmeinung Kants erkennt, sollte bedenken, dass Kants Argument argumentationslogisch überlegen ist: Wer einmal existiert, wird durch einen vernunftfernen, sich philosophischer Aufklärung weitgehend entziehenden biologischen Imperativ – bionom – im Dasein festgehalten; wer darüber reflektiert, so Kant, würde nicht nochmals zu existieren beginnen und leben wollen. Ob Kant Recht hat, ließe sich nur durch eine repräsentative Umfrage ermitteln.
Kant lässt die Verteidiger Gottes nun als weiteres Argument vorbringen, dass „das Übergewicht der schmerzhaften Gefühle über die angenehmen von der Natur eines tierischen Geschöpfes, wie der Mensch ist, nicht könne getrennt werden…“ – Was besagt, dass die Anwesenheit von Menschen auf Erden nicht ohne körperlichen Schmerz zu haben ist. Hiergegen bringt Kant die entscheidende und scharf an den historisch informierten Antinatalismus grenzende Gegenfrage vor: „dass, wenn dem also ist, sich eine andre Frage einfinde, woher nämlich der Urheber unsers Daseins uns überhaupt ins Leben gerufen, wenn es nach unserm richtigen Überschlage für uns nicht wünschenswerth ist.“ An dieser Stelle vollführt Kant eine beachtliche Distanzierung von der kaum je hinterfragten Voraussetzung des Seinsollens von Menschen. Zieht man von dieser Infragestellung des Seinsollens von Menschen Kants transzendentaltheologische Überbauung ab, so bleibt – anstelle des nur mehr postulierten göttlichen „Urhebers unseres Daseins“ – der sich fortpflanzende Mensch, der Gott und Unsterblichkeit weder widerlegen noch beweisen kann. Betonen wir die Fragwürdigkeit des nur noch als Postulat mitgeführten Schöpfers mit seinem Heilsbeiwerk, steht jetzt unversehens nicht mehr Gott vor dem von Kant einberufenen Gerichtshof der Vernunft, sondern die sich fortpflanzenden Menschen.
Kants Ausführungen inhäriert die Verpflichtung, nicht ohne Rechtfertigung (Anthropodizee) Menschen zu zeugen. Zudem trifft der gegen Gott gerichtete Vorwurf, er hätte besser gar keine Menschen schaffen sollen als leidende, den Menschen stärker als Gott, da Menschen nicht die Möglichkeit haben, ihren Kindern einen Jenseitsausgleich zuzusichern. Wobei, um dies zu wiederholen, auch der Jenseitsausgleich bei Kant in Frage steht: Laut Kritik der praktischen Vernunft von 1788 ist das Jenseits eben nicht ohne Weiteres als paradiesische Entschädigungsanstalt für irdische Mühsal zu denken, sondern vielmehr als Gelegenheit zu weiterer Pflichterfüllung im Fortschritt der unsterblichen Seelen zum Besseren (vgl. KpV, Dialektik, 2. Hauptstück, IV. Die Unsterblichkeit der Seele, als ein Postulat der reinen praktischen Vernunft).
Haben nun aber die bislang gezeugten menschlichen Seelen postmortal Gelegenheit zum Besseren fortzuschreiten, so fragt es sich, warum Kant zugleich noch an der Notwendigkeit festhält, das irdische Jammertal mit seinen im Dienste des Kulturfortschritts stehenden Kriegshandlungen bis zum Eintreten eines nebulösen ewigen Friedens zu verlängern. Genügt es nicht, darauf zu hoffen, dass die bislang existierenden Seelen posthum zum immer besser werden?
Ohne dass Kant dies so ausgesprochen hätte, legt seine kritische Philosophie in Kombination mit seinem realistischen Blick auf die bisherige Geschichte nahe, dass wir statt einer Theodizee einer Anthropodizee bedürfen – einer Rechtfertigung der Hervorbringung von Menschen durch Menschen in Anbetracht des bisherigen und zu erwartenden Geschichtsverlaufs. An dieser Stelle könnte man versuchen, Kants Gedanken zur Erziehung als Baustein für eine Anthropodizee ins Spiel zu bringen. Einerseits müssten Eltern alles ihnen zu Gebote Stehende tun, um ihre Kinder bis zur Volljährigkeit mit der elternverordneten Existenz derart zufrieden zu machen, dass die Kinder das Dasein gegenüber dem Nichtsein gewählt haben würden, hätten sie die Wahl gehabt (Natalschuldumkehr (retrospektive Elternabsolution)). Allerdings müsste man diesen präexistentiellen Kindern mit Kant davon abraten, das irdische Dasein zu wählen, da er selbst sagt, niemand, der kennt, würde ein irdisches Dasein erneut durchmachen wollen!
In seiner Schrift „Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ von 1793 stützt sich Kant auf „meine angeborne Pflicht, in jedem Gliede der Reihe der Zeugungen (…) so auf die Nachkommenschaft zu wirken, daß sie immer besser werde (wovon also auch die Möglichkeit angenommen werden muß), und dass so diese Pflicht von einem Gliede der Zeugungen zum andern sich rechtmäßig vererben könne. Es mögen nun auch noch so viel Zweifel gegen meine Hoffnungen aus der Geschichte gemacht werden, die, wenn sie beweisend wären, mich bewegen könnten, von einer dem Anschein nach vergeblichen Arbeit abzulassen: so kann ich doch, so lange dieses nur nicht ganz gewiß gemacht werden kann, die Pflicht (als das Liquidum) gegen die Klugheitsregel, aufs Untunliche nicht hinzuarbeiten, (als das Illiquidum, weil es bloße Hypothese ist) nicht vertauschen; und, so ungewiß ich immer sein und bleiben mag, ob für das menschliche Geschlecht das Bessere zu hoffen sei, so kann dieses doch nicht der Maxime, mithin auch nicht der notwendigen Voraussetzung derselben in praktischer Absicht, daß es tunlich sei, Abbruch tun.“ (Schriften zur Geschichtsphilosophie, S. 160)
Hier legt Kant gegen einen mit Blick auf die bisherige Geschichte ins Blickfeld drängenden historisch informierten Antinatalismus (siehe insbesondere seine Formulierung: „von einer dem Anschein nach vergeblichen Arbeit abzulassen“) nahe, die Kette der Fortzeugungen deswegen nicht abbrechen zu lassen, weil ja für Eltern die vage Aussicht besteht, durch Erziehung an einer künftigen besseren Welt mitzuwirken und niemand apodiktisch sagen dürfe, dass bessere Zeiten nicht kommen würden.
Aber auch dieser Gedanke schafft nicht aus der Welt, was Kant in seiner Theodizeeschrift fragte: Warum man uns überhaupt ins Dasein treten lässt. Warum sollte es von Belang sein, etwa durch gute Erziehung jenen hypothetischen „für unsere Nachkommen so erfreulichen Zeitpunkt schneller herbeizuführen“ (a.a.O., S. 34), wenn auf dem Wege dorthin Milliarden Menschen leiden und sterben mussten, ohne dass sich für ihre Zeugung ein außeregoistischer Grund anführen ließe?
Mit seinem Standpunkt, die „ungesellige Geselligkeit“ (a.a.O.,S. 25) des Menschen mit der Folge unabsehbarer Kriege verrate „die Anordnung eines weisen Schöpfers; und nicht etwa die Hand eines bösartigen Geistes“ (a.a.O., S. 27) überschreitet Kant die spätestens in der Kritik der reinen Vernunft gezogenen Grenzen, denen zufolge wir von Gott nichts wissen können und nicht einmal seine Existenz als wissbar unterstellen dürfen. So gesehen aber scheint es ebenso gerechtfertigt, von einem bösen Schöpfer auszugehen. Mit seiner Rede vom „bösartigen Geist“ gibt Kant das im Weiteren auszuführende Thema vor.