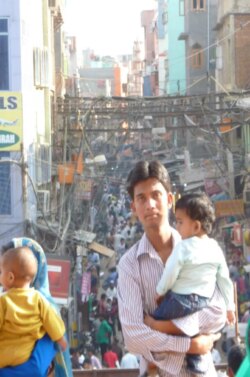Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 200
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDiktat der Geburt (Diktat des Daseins)
Mit der Rede vom Diktat der Geburt{50} liegt – mit erheblicher Verspätung – auf metaphorischer Ebene der antinatalistische Gegenspieler zur pronatalistischen Rede vom Geschenk des Lebens vor. Die Rede vom Diktat der Geburt ist zugleich eine prägnante Formel für wesentliche Aspekte des Kantischen Nataltheorems (Natalschuldumkehr). „Diktat der Geburt“ besagt: Wir sind einwilligungslos da, ohne dass wir unserem Existenzbeginn zugestimmt hätten. Da jeder Mensch mehrere Monate vor seiner Geburt zu existieren beginnt, spricht man ontologisch präziser statt vom Diktat der Geburt vom Diktat des Daseins oder Daseinsdiktat.
Der Ausdruck „Diktat der Geburt“ gehört zu den metaphorischen Antinatalismen. In außermetaphorischer Hinsicht hingegen – ontologisch – kann von einem Geburtsdiktat nicht die Rede sein. Denn man tat uns nichts an – uns widerfuhr nichts – als man unseren Existenzbeginn bewirkte. Man zerrte uns nicht aus einer Grauzone der Existenz (Guf-Raum) ins grelle Licht des Daseins. Wenn wir unter Geburt den Existenzbeginn verstehen (und nicht den Austritt aus dem Mutterleib), so war schlicht niemand da, dem man das Existieren hätte auferlegen können; keine Subjektivität, die ihm hätte widerstreben oder es anstreben können. Mit größtem Recht begreift Lütkehaus daher das Diktat der Geburt „nicht in dem Sinn, dass hier jemandem etwas diktiert würde; diesen Jemand gibt es vor der Geburt und ohne sie nicht…, sondern in dem Sinn, dass dieser Jemand selber und als solcher diktiert wird.“ Alternativ könne man vom „Verhängt-Sein der Geburt“ sprechen (Lütkehaus, Vom Anfang und vom Ende, S. 21) Zu beachten ist indes, dass unsere Existenz nicht mit der Geburt beginnt, sondern zwischen Zeugung und Geburt: nämlich dann, wenn erstmals ein Ich präsent ist, also wenn das fötale Gehirn erstmals Bewusstsein realisiert. Unmetaphorisch gesprochen haben wir es folglich nicht mit einem „Diktat der Geburt“ zu tun, sondern mit dem Bewirken eines Lebensbeginns.
Ein Vorläufer der Metapher vom Diktat der Geburt ist Julio Cabreras Rede von der Manipulation des Daseins eines anderen. Auch Cabrera ist allerdings zu widersprechen, wenn er ausführt, wir verfügten über das Sein eines Anderen nicht nur, wenn wir ihn töten, sondern ebenso, wenn wir ihn ins Dasein treten lassen. (Vgl. Cabrera, S. 63) Es wird also verfügt, dass ein Mensch zu existieren beginnt.
Und doch hat die Rede vom „Diktat der Geburt“ nicht allein als Antagonist zum „Geschenk des Lebens“ ihre Berechtigung: Das Leben wurde zwar nicht „uns“ (also nicht einer bestimmten Person) diktiert; doch beschlossen Kleindemiurgen (oder es ereignete sich „zufällig“), dass ein weiterer Mensch zu leben und zu sterben haben würde. Mit jeder progenerativen Entscheidung wird entschieden, dass ein weiterer Mensch zu leben und zu sterben haben wird. Die betreffende Entscheidung oder der „Zufall“ setzt nicht am betreffenden Menschen an, sondern am umgreifenden Sein.
Ihren vielleicht präzisesten Sinn erfährt die Rede vom „Diktat der Geburt“ durch den bionomischen Satz Ernst Blochs, der besagt, keiner habe zu leben begonnen, weil er es wollte – aber nachdem er einmal zu leben begonnen hat, müsse er dies auch wollen. Als rationaler Kern der Rede vom Diktat der Geburt erweist sich somit: das Diktat des Lebens. Das heißt paradox gefasst: Wer lebt, will leben – ob er will oder nicht! Unsere Körper melden jederzeit Ansprüche an, die uns zum Weiterleben treiben, ob wir dies intellektuell gutheißen oder nicht. Diktat der Geburt bedeutet sodann: Einmal da diktiert uns der eigene Organismus das Fortleben – ob wir wollen oder nicht.
Patt, nativistisches
Chayyam, Omar (1048–1131)
Omar Chayyam, der Voltaire des Orients, zählt zu den unerschrockensten Gottesanklägern des Monotheismus und wartet hier mit seinen Versionen des Diktats der Geburt auf:
„Ohne meinen Willen hat er mir zuerst das Sein gegeben,
Und mit Staunen und Verwundrung schau' ich an mein eignes Leben.
Uns zum Kummer aus der Welt dann werden wir hinweggerissen,
Ohne unsres Kommens, unsres Gehens Zweck und Ziel zu wissen.“
(Omar Chayyam: Vierzeiler, S. 6)
Thanatalität
„Dem Brüten über dieses Sein, ich rat' euch, daß ihr ihm entsagt,
Und mit Gedanken solcher Art euch, Freunde, nicht mehr nutzlos plagt;
Sucht zu zerstreun euch und seid froh! Denn, als der ganze Erdenkram
Erschaffen wurde, hat man euch vielleicht um euern Rat gefragt?“
(Omar Chayyam: Vierzeiler, S. 36)
Oino-Theodizee
Shakespeare (1564–1616)
Shakespeare ruft eine besondere Form der Geburtsvergessenheit in Erinnerung: Dass wir nämlich nur das Sterbenmüssen zu beklagen pflegen, nicht hingegen, das Geborenwordensein:
„Dulden muß der Mensch / Sein Scheiden aus der Welt, wie seine Ankunft.“ (König Lear, Fünfter Aufzug, Ende zweite Szene, Bd. 4, S. 593)
Milton, John (1608–1674)
Gegen das Diktat der Geburt lehnt bereits Miltons Adam in einer seinsverwünschenden Schmährede gegen den Schöpfer sich auf:
„Bat ich dich etwa, Schöpfer, mich aus Ton / Zum Menschen zu gestalten, aus dem Dunkel mich zu erheben oder mich hierher / Ins Paradies zu setzen? Nein, ich war, / Ward ohne meinen Willen.“ (Das verlorene Paradies, Zehntes Buch, 743ff)
Fontane (1819–1898)
Fontane gestaltet die Doppeltragik, die dann gegeben ist, wenn Personen (zumal Frauen) nicht nur zum eigenen Dasein nicht Nein sagen konnte, sondern zudem nicht in der Lage sind, zu verhindern, dass sie selbst zu Komplizinnen einer Diktatur der Geburt gemacht werden. Das „Nein zum Leben“ (Neuffer) erfordert eine Abstandnahme gegen Vorgaben, wie sie sich theoretisch in der Philosophie Schopenhauers, gesellschaftlich in der Anmeldung, Erstreitung und Gewährung von Frauenrechten sowie ihrer Gleichstellung und praktisch mit der Ubiquität von Verhütungsmitteln und dem Aufkommen kontrazeptiver Gesellschaften etablierte:
„Arme Cécile! Sie hat sich dies Leben nicht ausgesucht, sie war darin geboren, sie kannt es nicht anders, und als der Langerwartete kam, nach dem man vielleicht schon bei Lebzeiten des Vaters ausgeschaut hatte, da hat sie nicht nein gesagt. Woher sollte sie dies ›Nein‹ auch nehmen? Ich wette, sie hat nicht einmal an die Möglichkeit gedacht, daß man auch ›nein‹ sagen könne; die Mutter hätte sie für närrisch gehalten und sie sich selber auch.“ (Fontane Cécile, a.a.O., S. 464)
Jaspers, Karl (1883–1969)
In Grenzsituationen, so Jaspers, verzweifeln wir an Sinn und Gehalt jeglichen Daseins:
„Ich habe nicht zugestimmt, dass ich dieses Leben will, und vermag nichts zu sehen, das mich zum Ja bestimmen könnte.“ (Jaspers, Philosophie II, S. 304) Wo dieser Gedanke zum Suizid treibt, könne der Lebensmüde jedoch zugleich eine neue, lebenserhaltende Erfahrung machen: die Erfahrung der Freiheit, sich das Leben nehmen zu können, vermag aufzuzeigen, dass die in Gestalt dieser Freiheit entdeckte Substanz des Lebens schwerer wiegt als die Gründe, die dazu bewogen, es sich zu nehmen. Jaspers lässt das Diktat von Geburt und Lebenwollenmüssen an einer Wand der Freiheit abprallen. Gegen Jaspers bleibt indes zu bedenken, dass der Lebensmüde, dem in der Entschlossenheit zum Suizid die Freiheit aufscheint, sich nicht von Verzweiflung oder Schmerz befreit hat, wenn er vom Selbstmord Abstand nimmt.
Nachstehend bedenkt Jaspers denn auch das Diktat der Geburt, insofern wir zwar die Freiheit haben mögen, uns das Leben zu nehmen, dass wir aber nicht die Freiheit hatten, uns das Leben zu geben. Von daher existieren wir wesentlich unfrei aus der Unfreiheit heraus – und sind wir so frei, uns die Freiheit zu nehmen, aus dieser Unfreiheit auszutreten, so hören wir auf zu existieren: „Da ich mir das Leben nicht selbst gegeben habe, entscheide ich nur, bestehen zu lassen, was schon ist. Es gibt keine entsprechende Totalhandlung, in der ich mir das Leben gebe, wie es die Handlung ist, in der ich es mir nehme.“ (Philosophie II, S. 308)
Arendt, Hannah (1906–1975)
Unter Außerachtlassung der Einsichten ihres „Lehrers“ Jaspers versucht sich Hannah Arendt an einer Inversion des Diktats der Geburt hin zu einer Freiheitsschaffung: „Mit der Erschaffung des Menschen erschien das Prinzip des Anfangs, das bei der Schöpfung der Welt noch gleichsam in der Hand Gottes und damit außerhalb der Welt verblieb, in der Welt selbst und wird ihr immanent bleiben, solange es Menschen gibt; was natürlich letztlich nichts anderes sagen will, als daß die Erschaffung des Menschen als eines Jemands mit der Erschaffung der Freiheit zusammenfällt.“ (Arendt, Vita activa, S. 166)
Ganz offensichtlich vergisst Arendt, dass jeder Mensch auf das Geheiß anderer, als Konsequenz des Tuns oder Unterlassens anderer zu existieren beginnt und nicht Causa sui ist. Selbst wenn der auf elterliche Verfügung hin entstandene Mensch frei sein sollte, so ist er doch viel eher zur Freiheit verurteilt als frei gewesen, frei zu sein – denn diese Freiheit müsste die Freiheit implizieren, nicht zu sein.
Aichinger, Ilse (1921–2016)
Aichinger verdanken wir eine weitere Version der Rede vom Diktat der Geburt:
„Ich habe meine Existenz immer als Überrumpelung begriffen und mit dem Wunsch zu verschwinden darauf reagiert.“ (Ilse Aichinger, Es muss gar nichts bleiben, S. 179)
Ebenso wenig wie Jemandem das Dasein diktiert wird, gäbe es freilich Jemanden, der dadurch überrumpelt würde, dass man seinen Existenzbeginn bewirkt. Gleichwohl ist die Kritik daran berechtigt, dass die je eigenen Eltern den Existenzbeginn eines Menschen bewirkten, dessen Einverständnis sie nicht einholen konnten und dem nichts bleibt, als sich irgendwann vorzufinden.
Verschwindenwollen